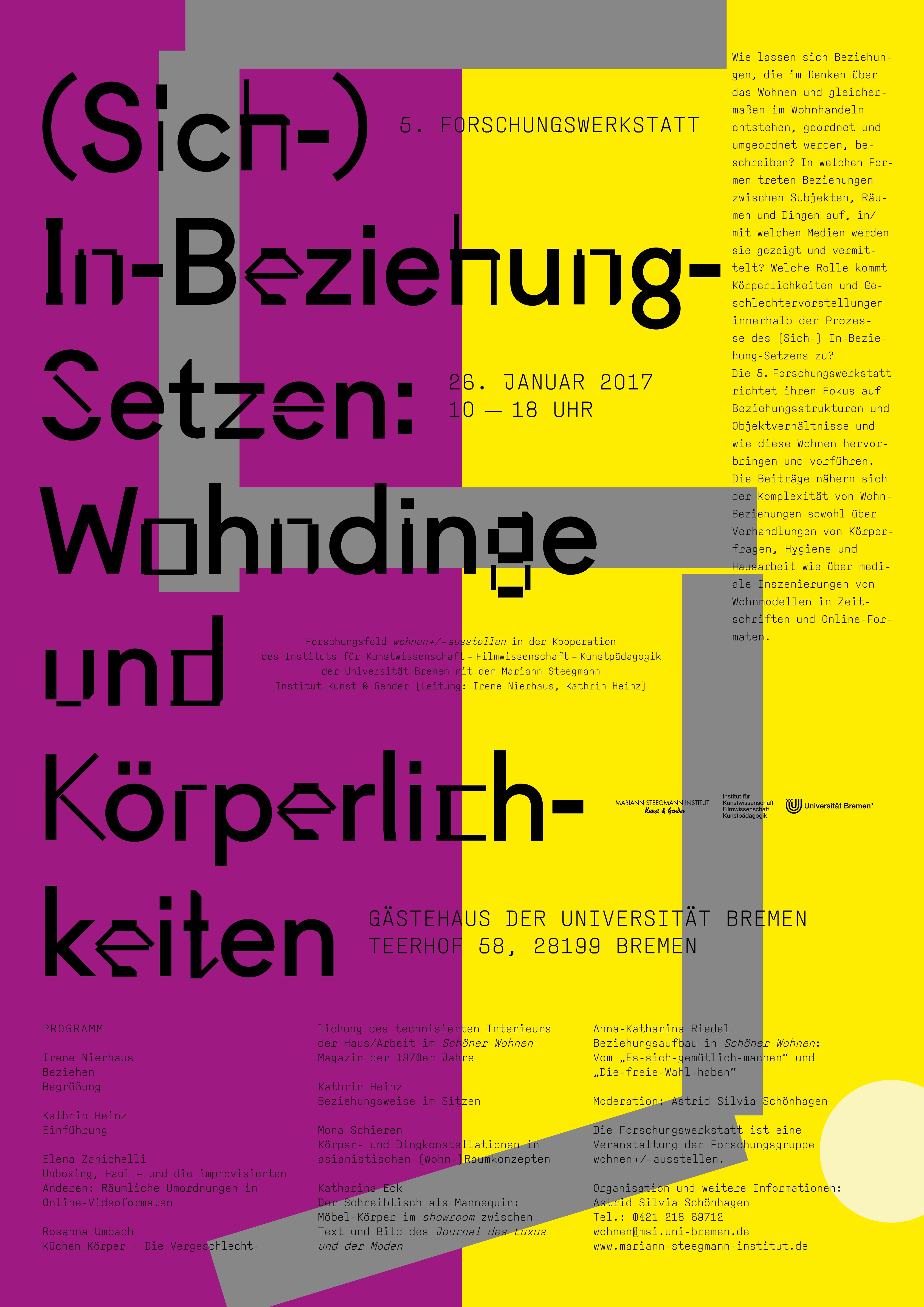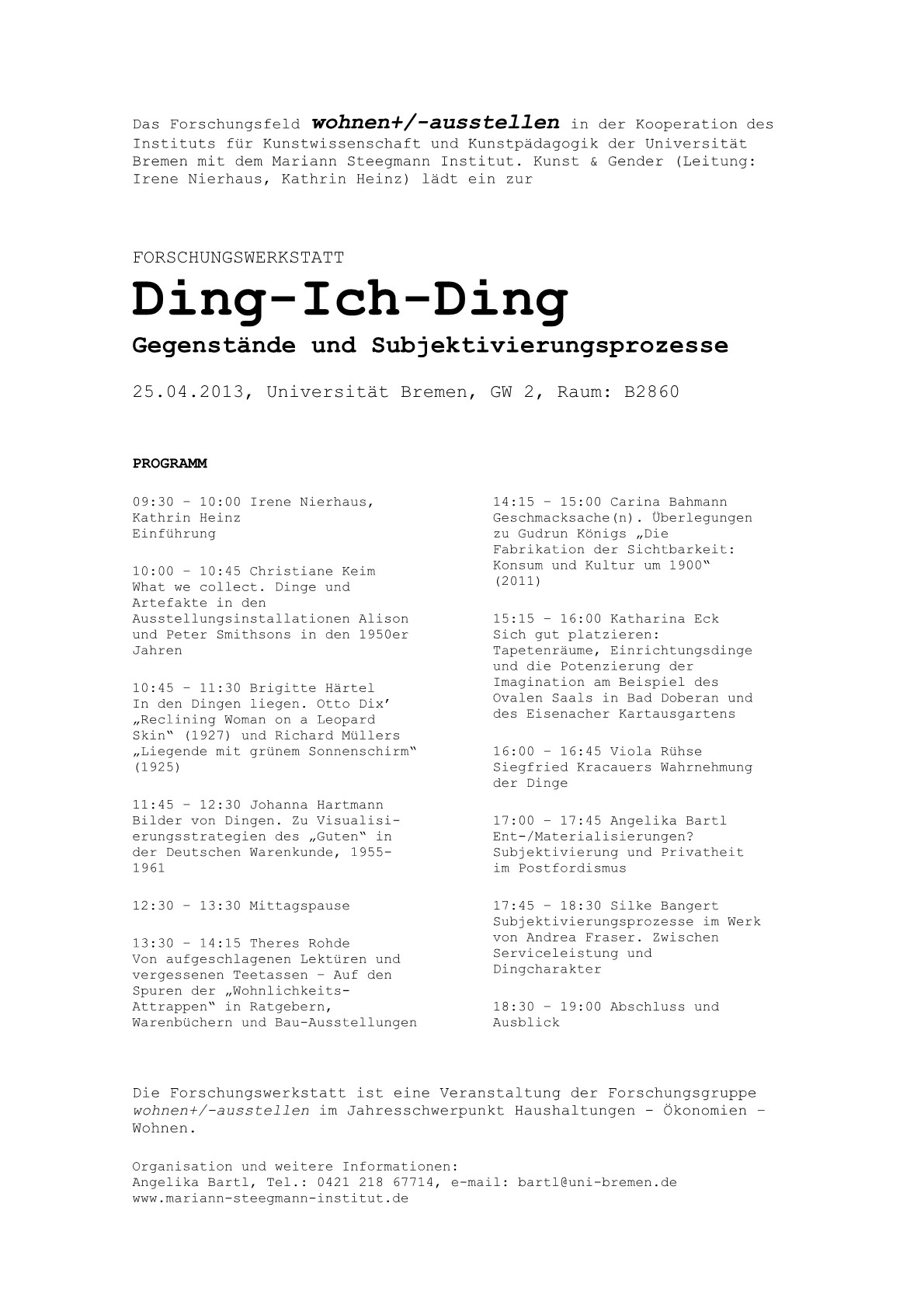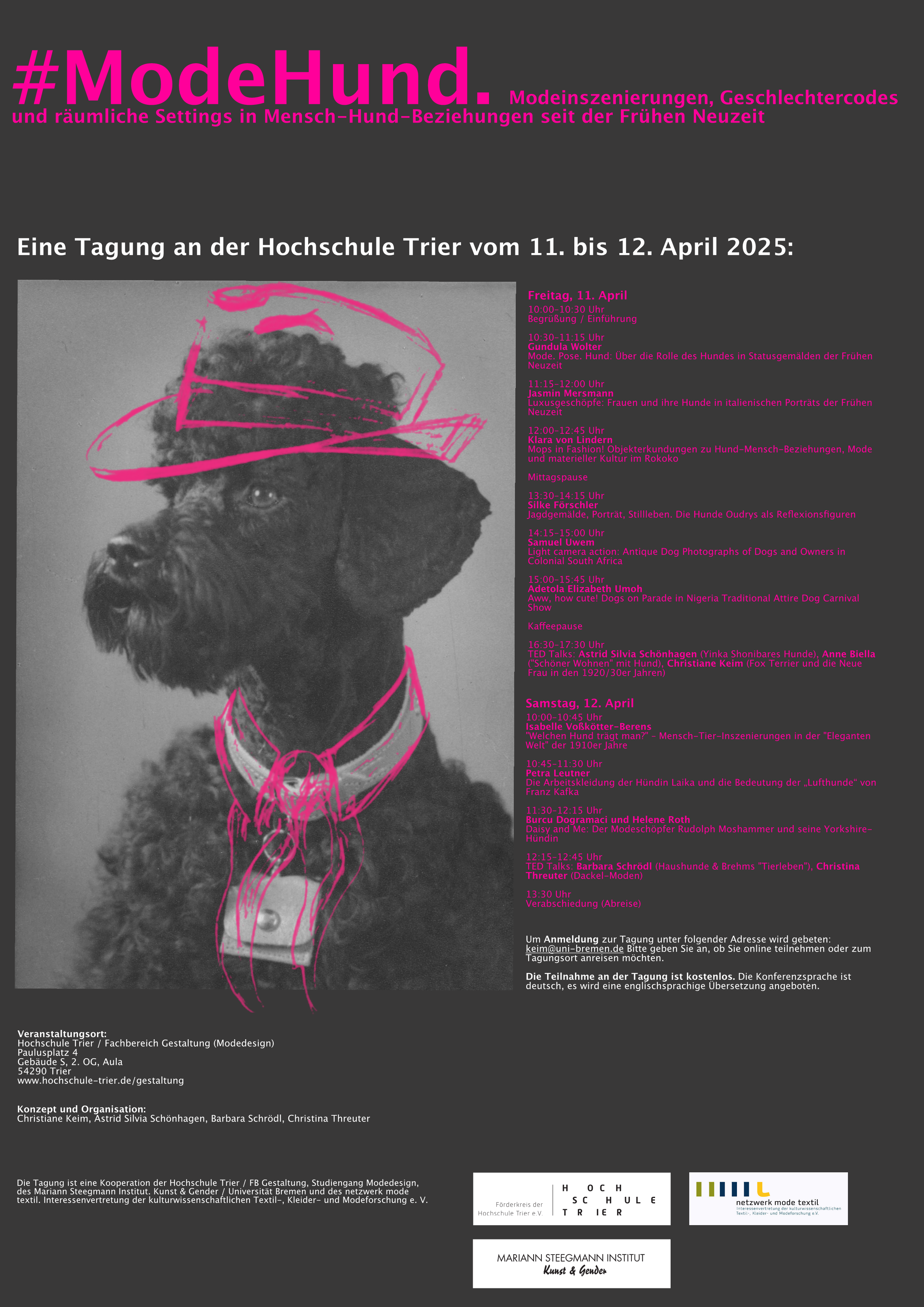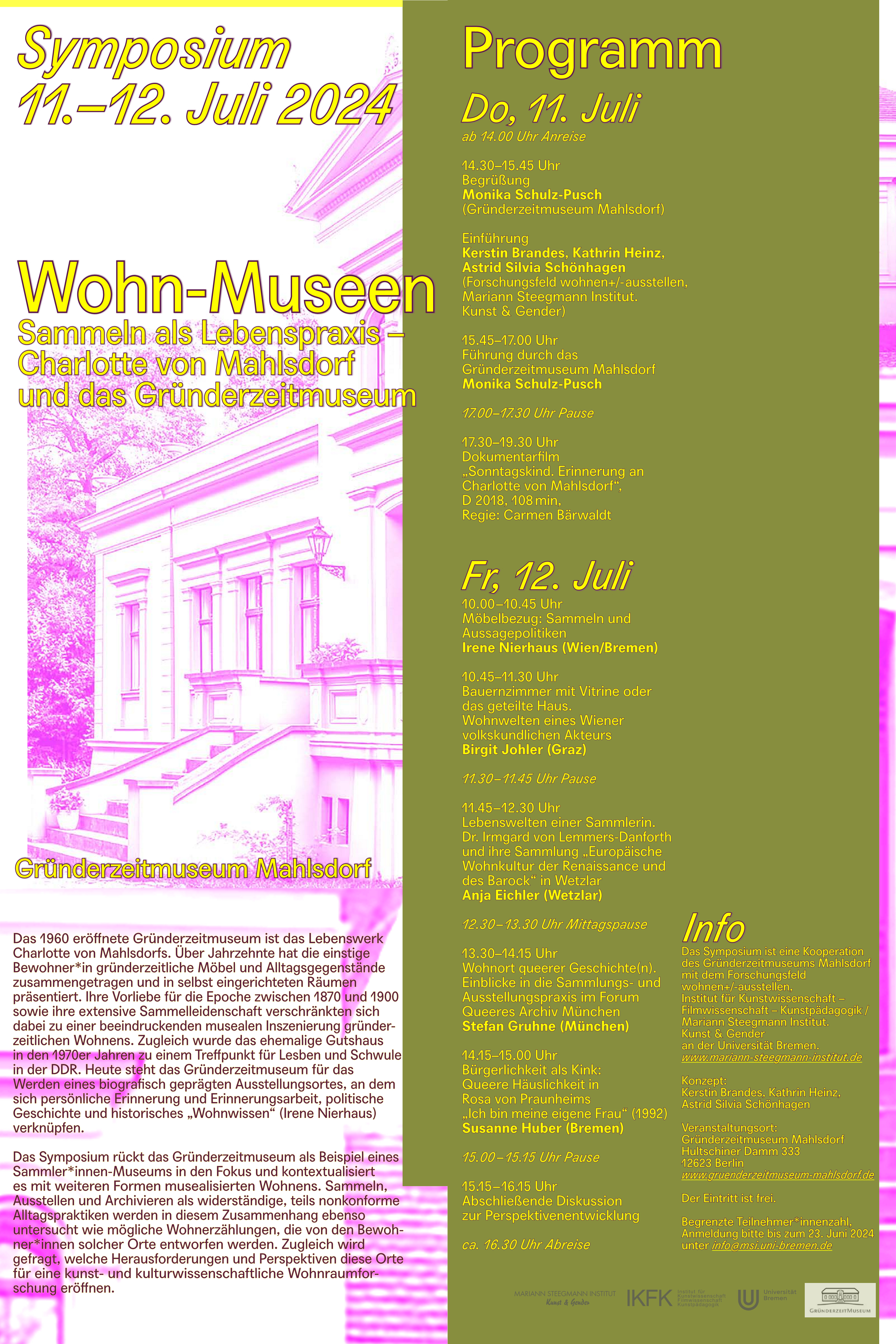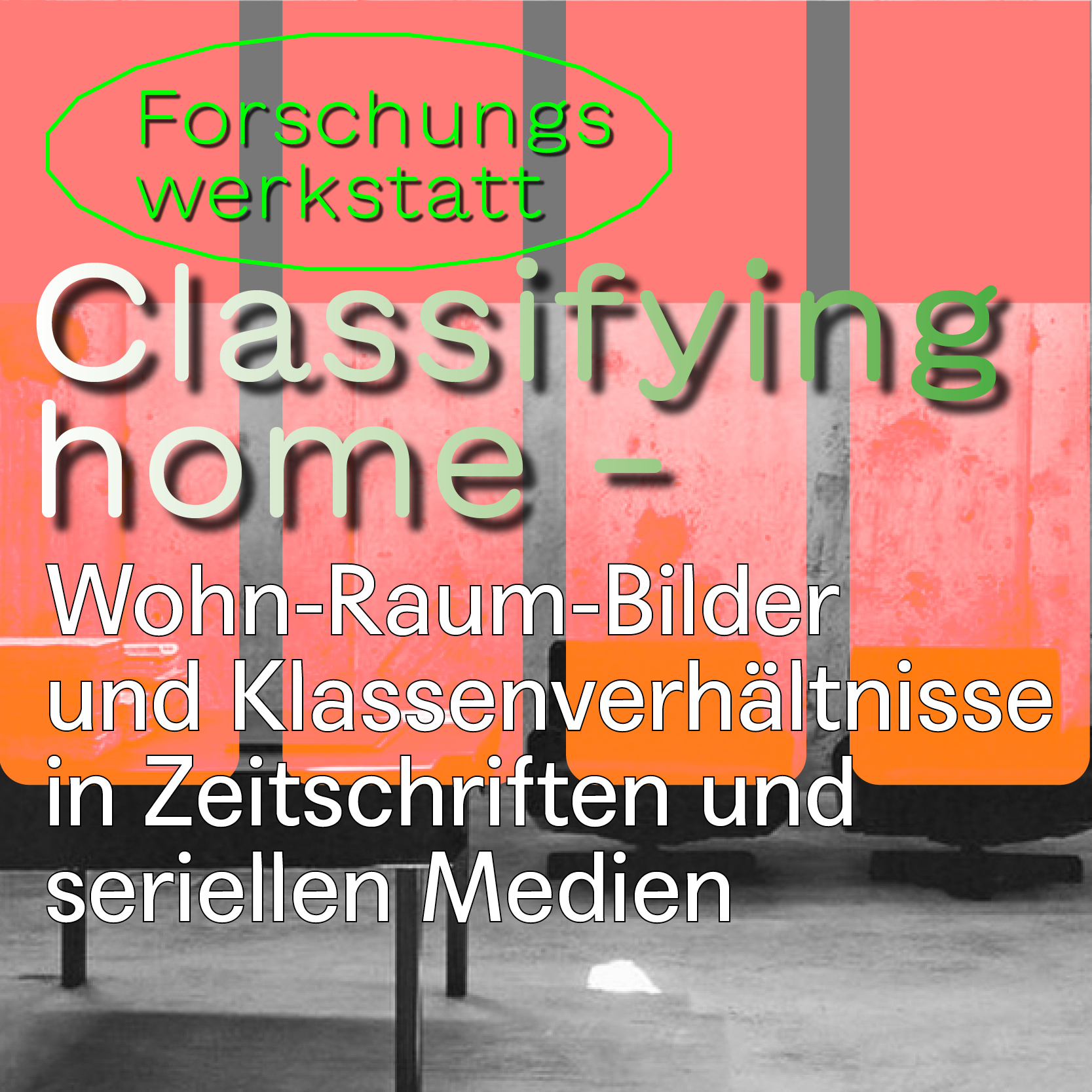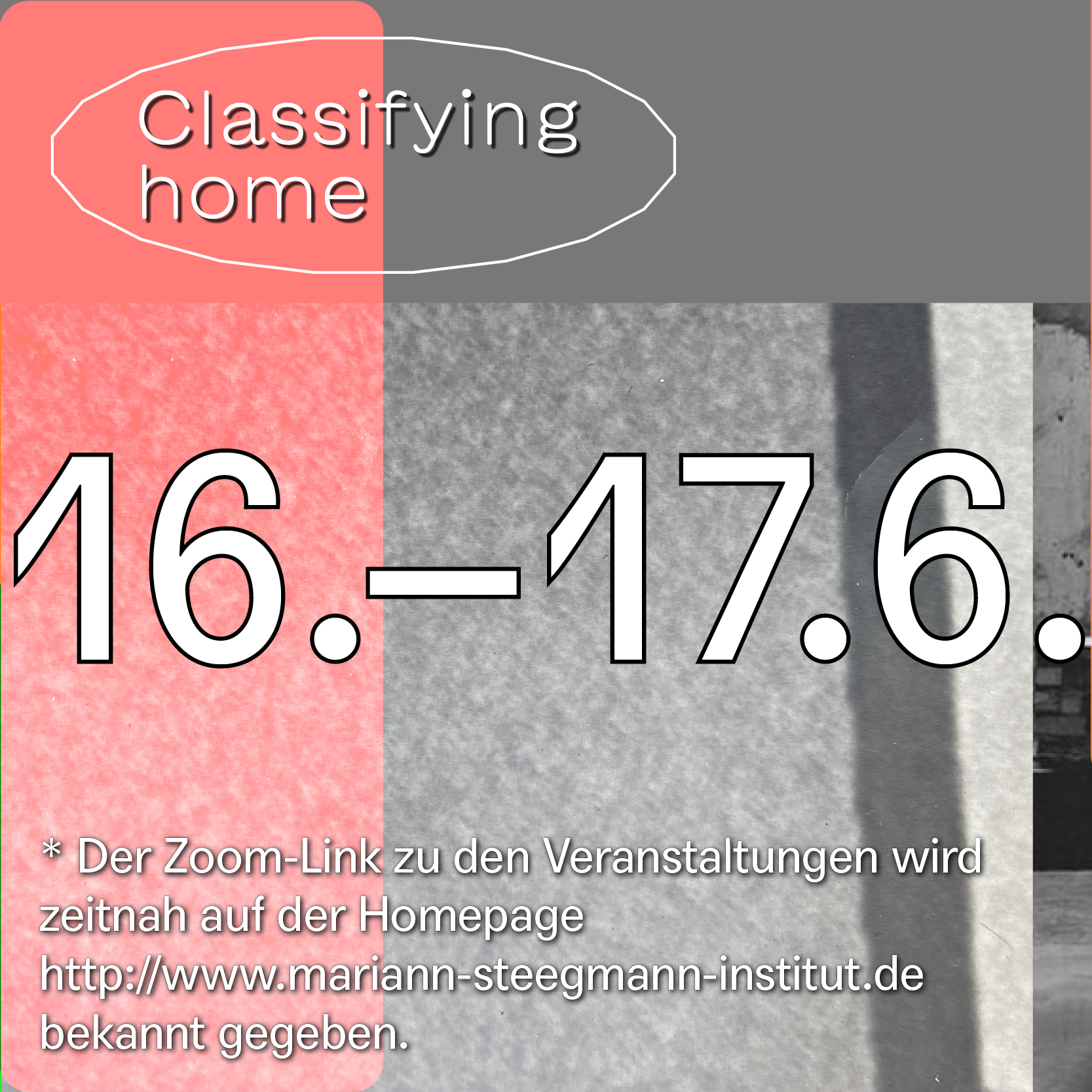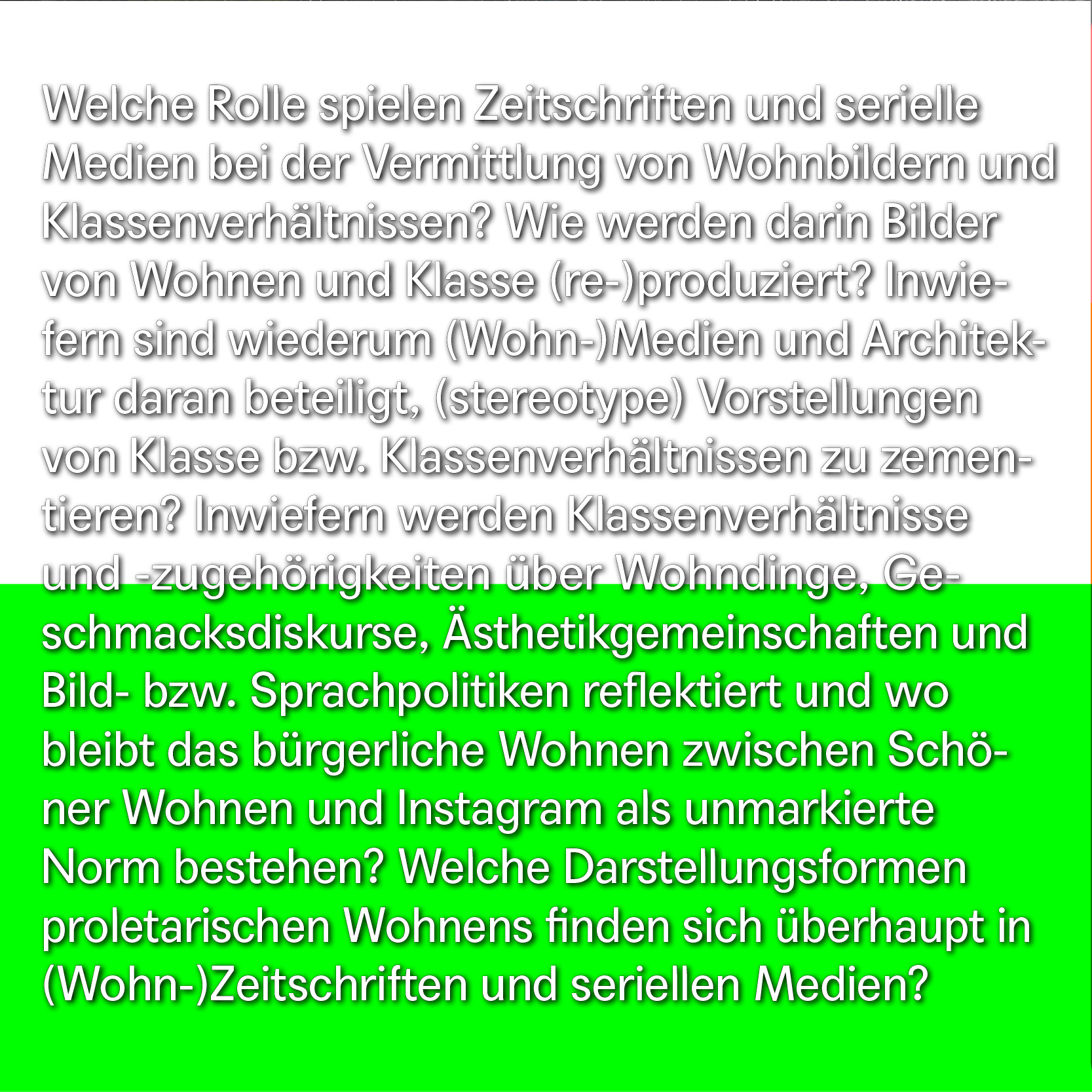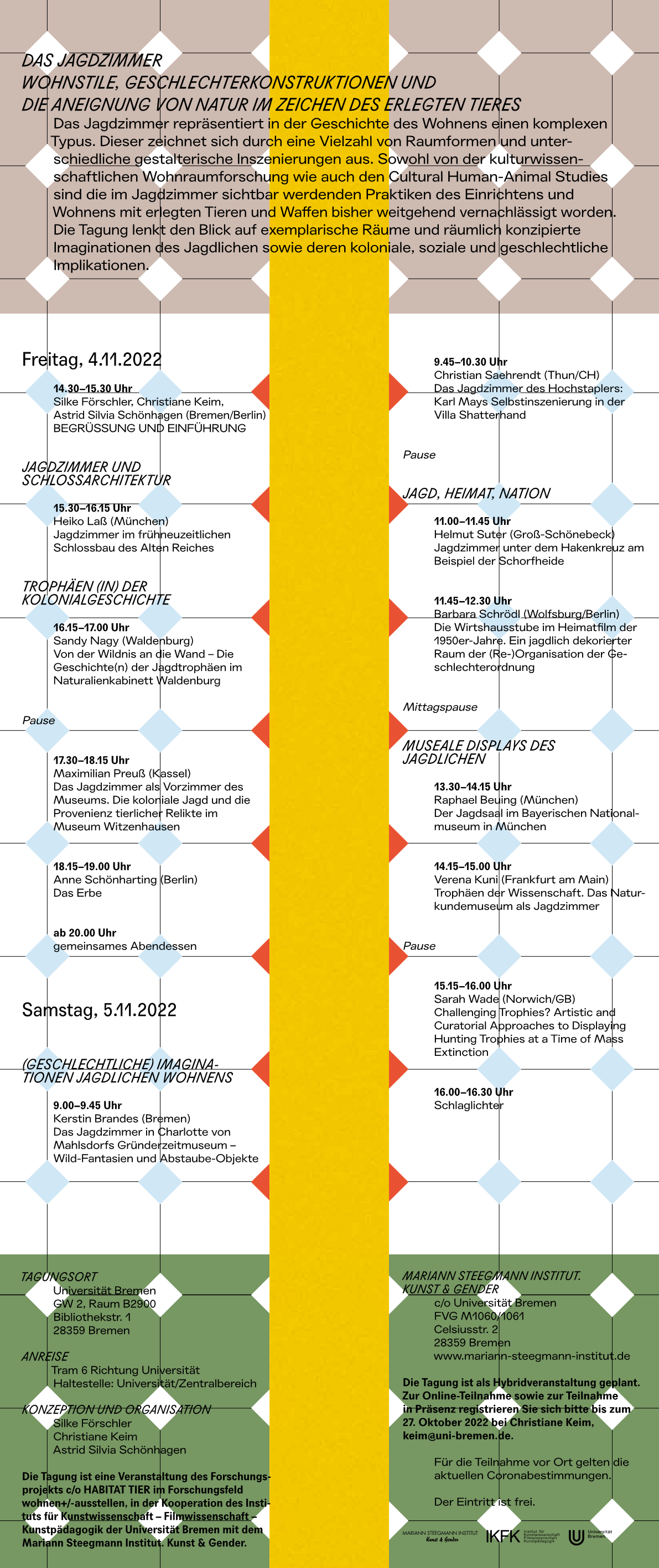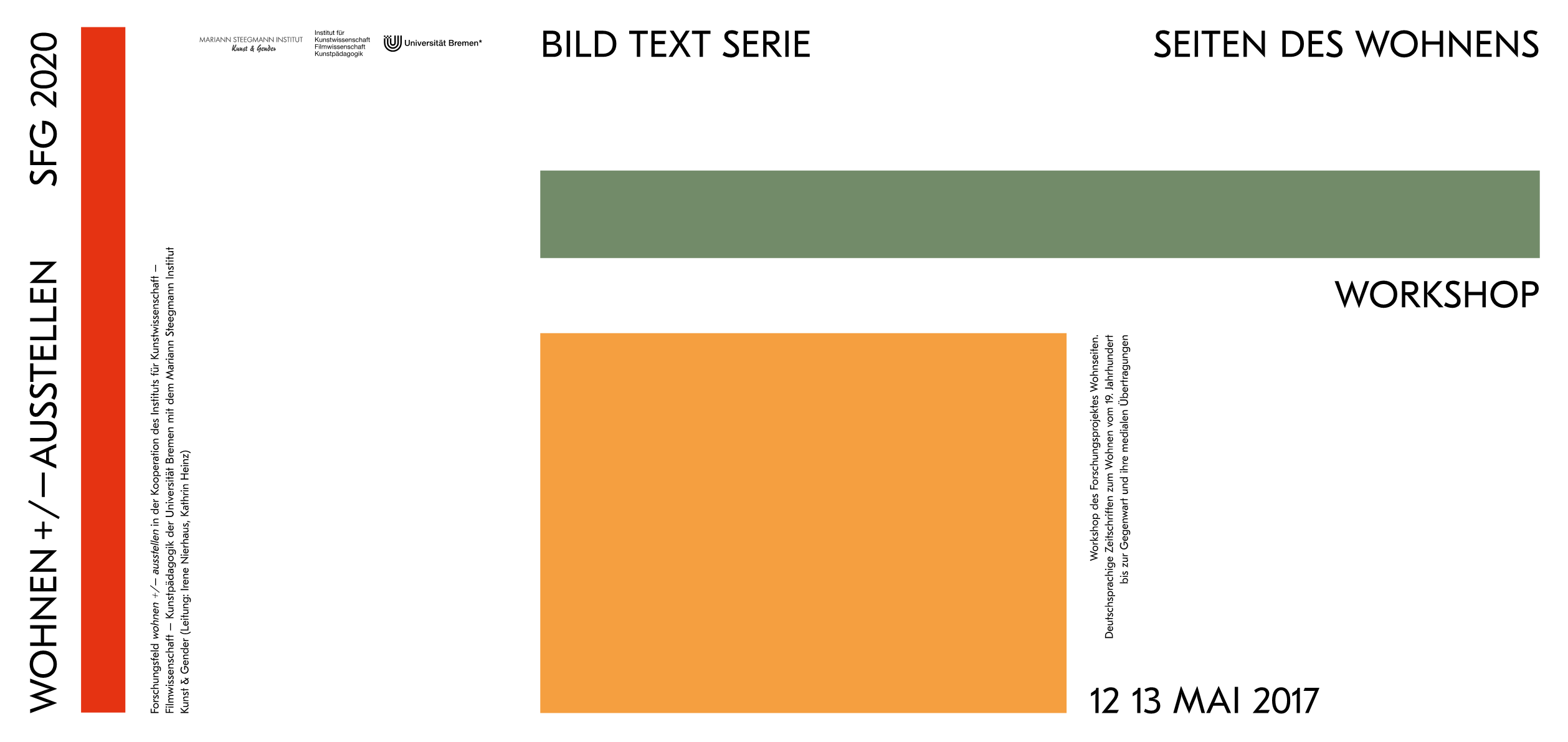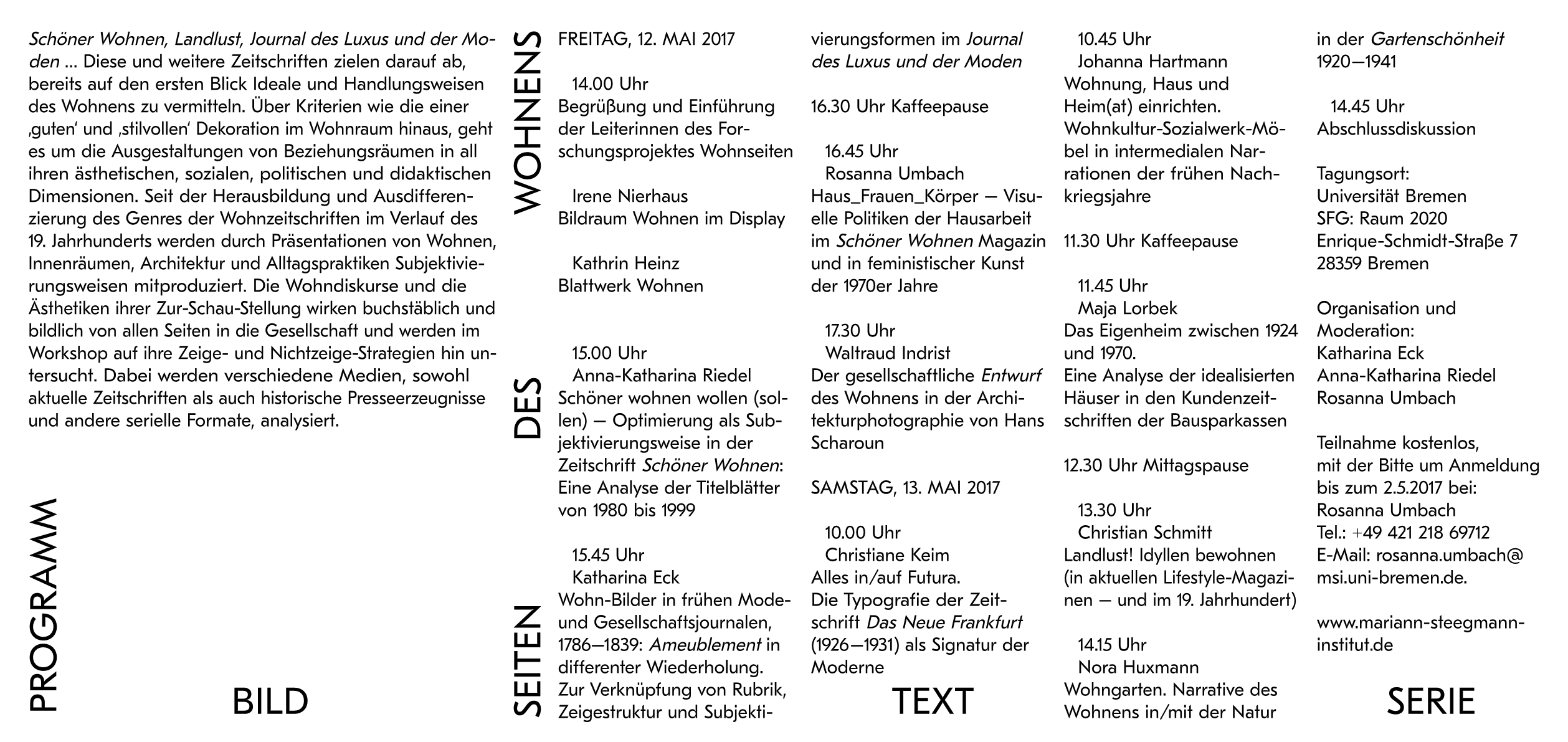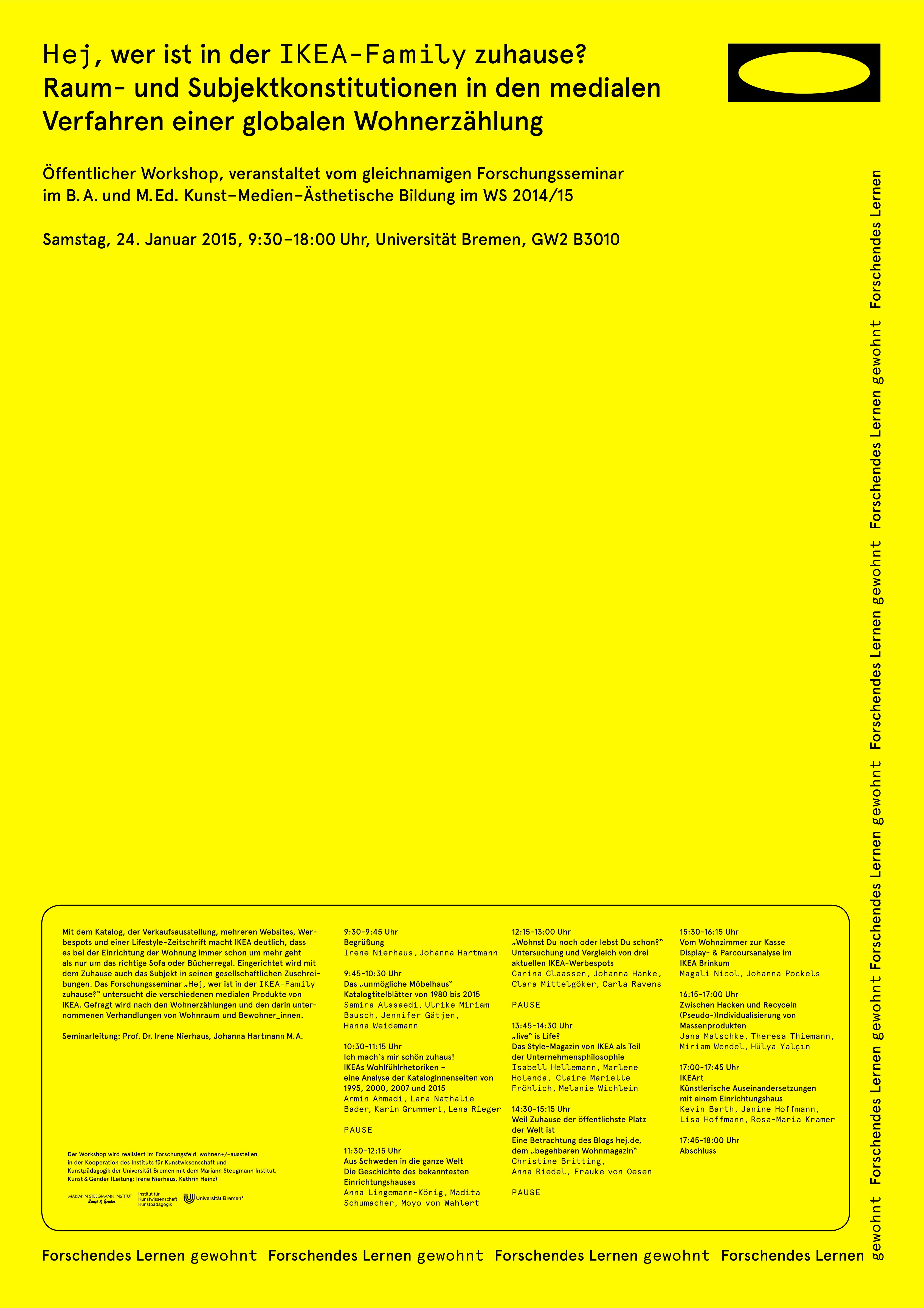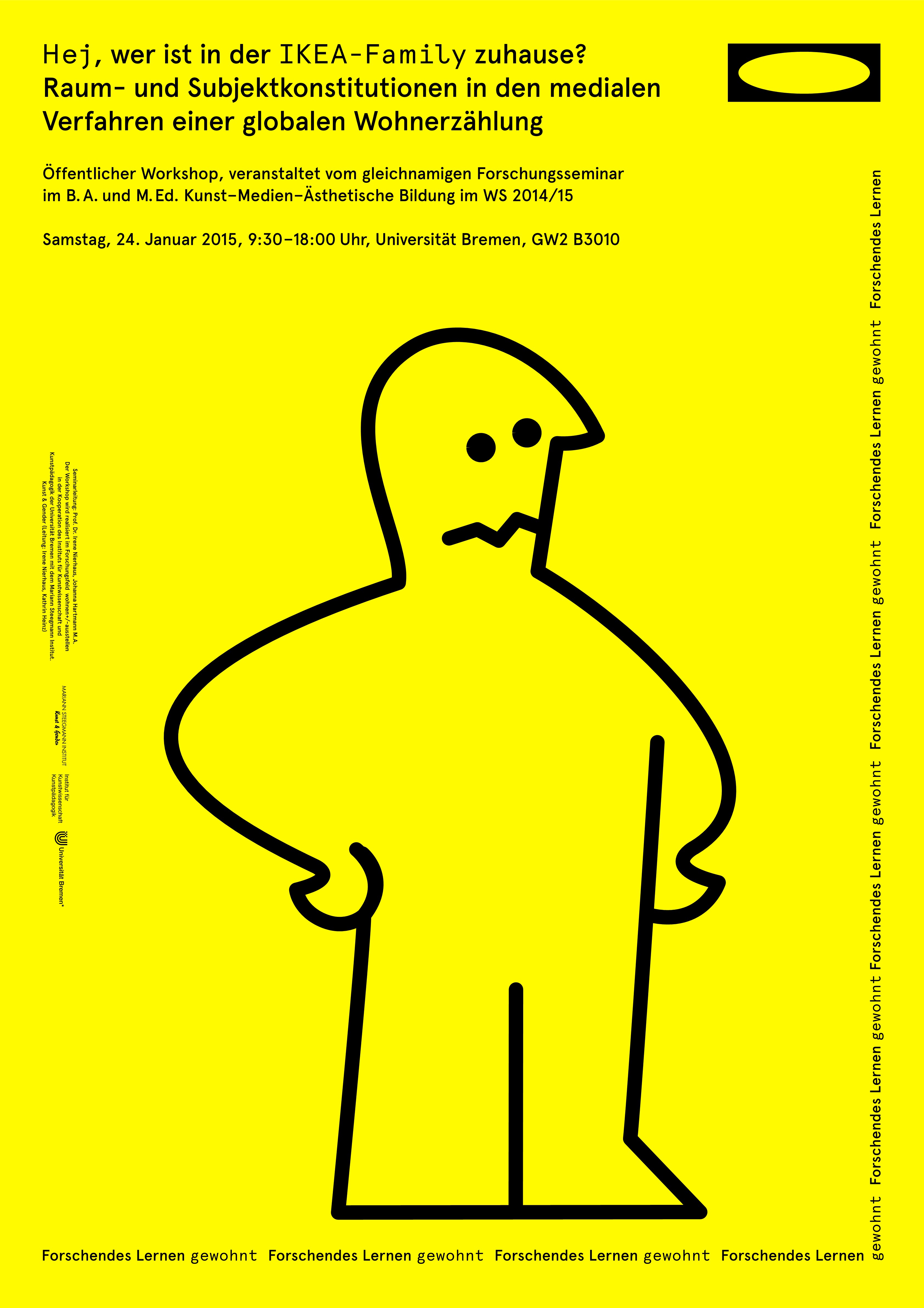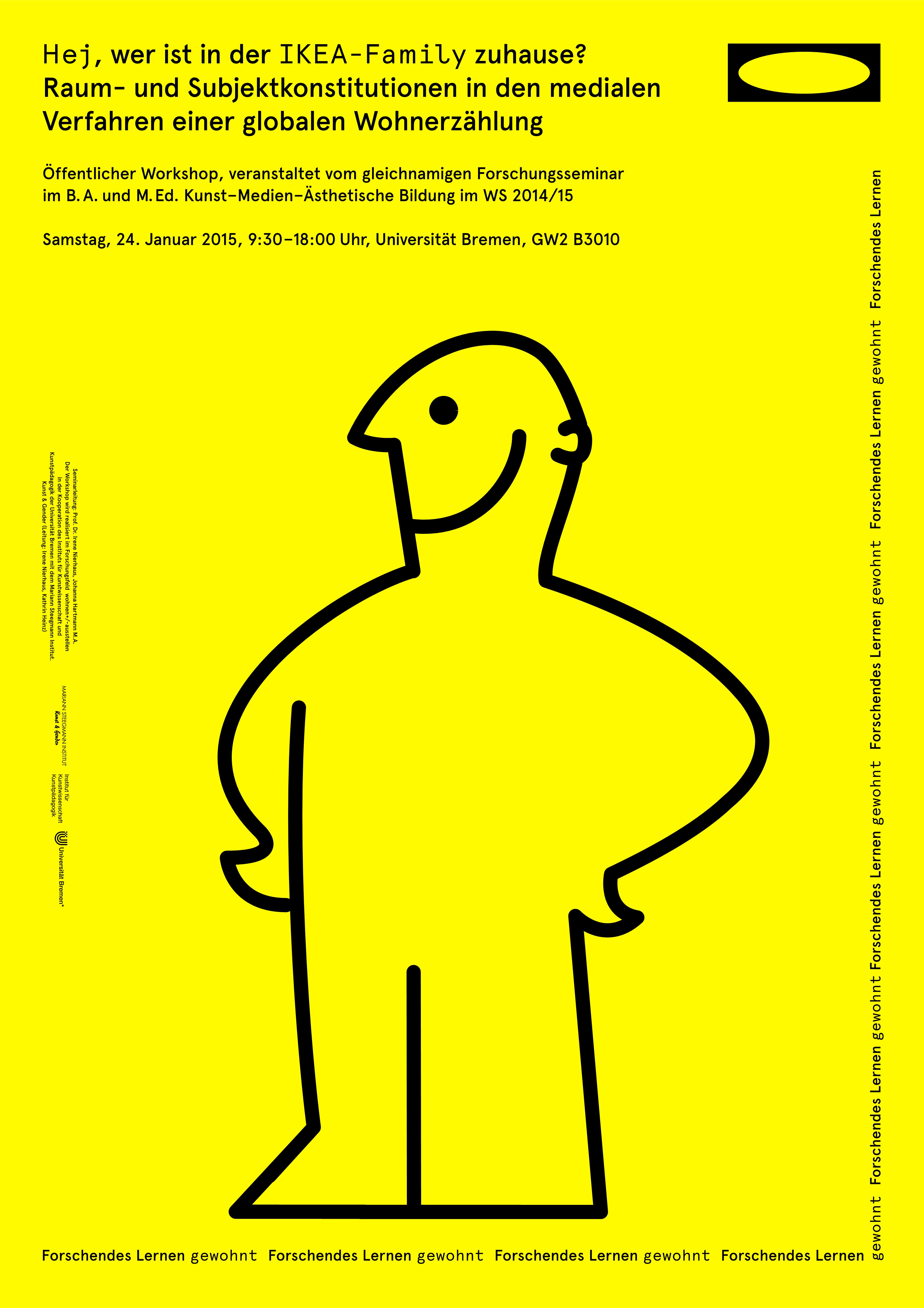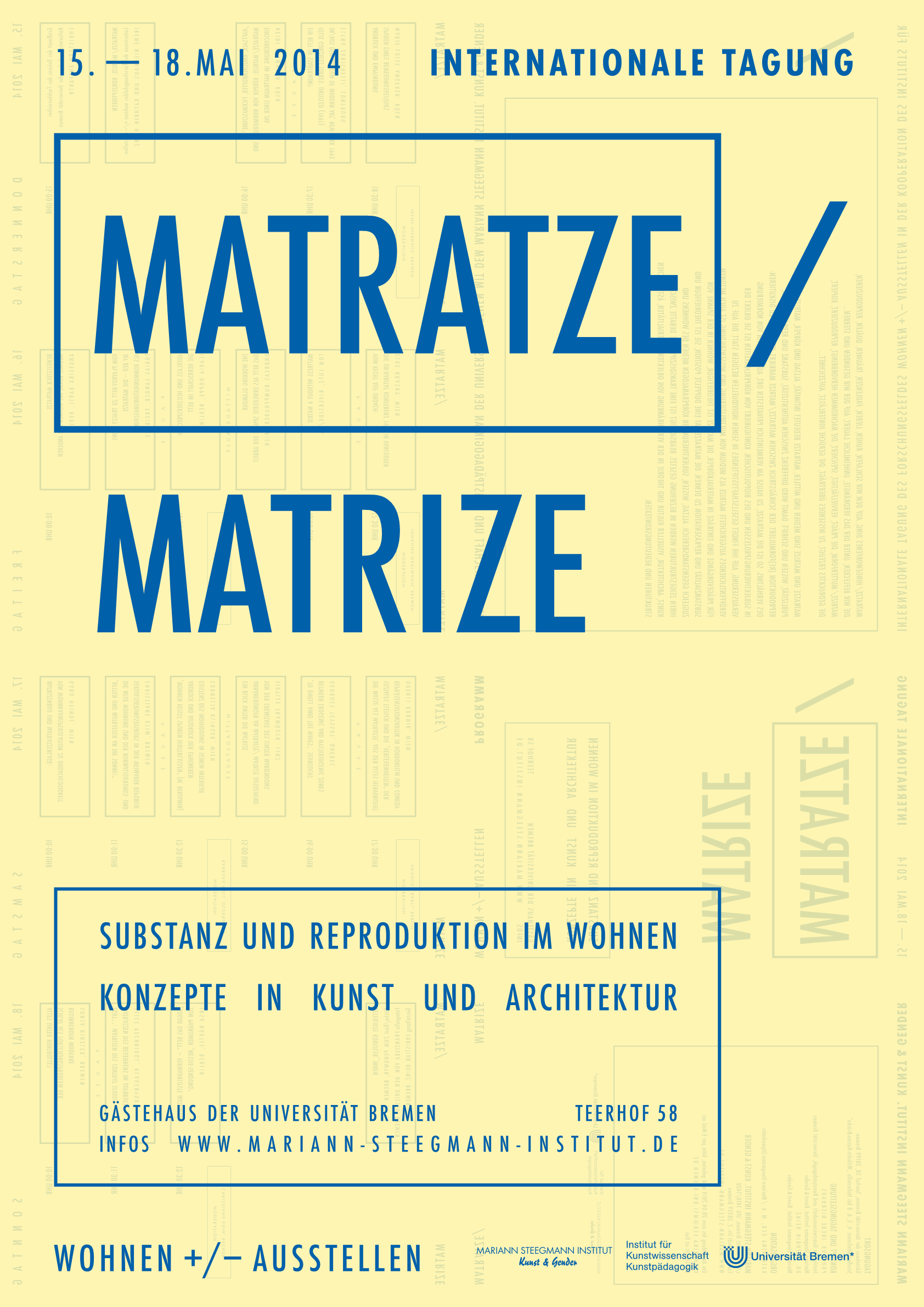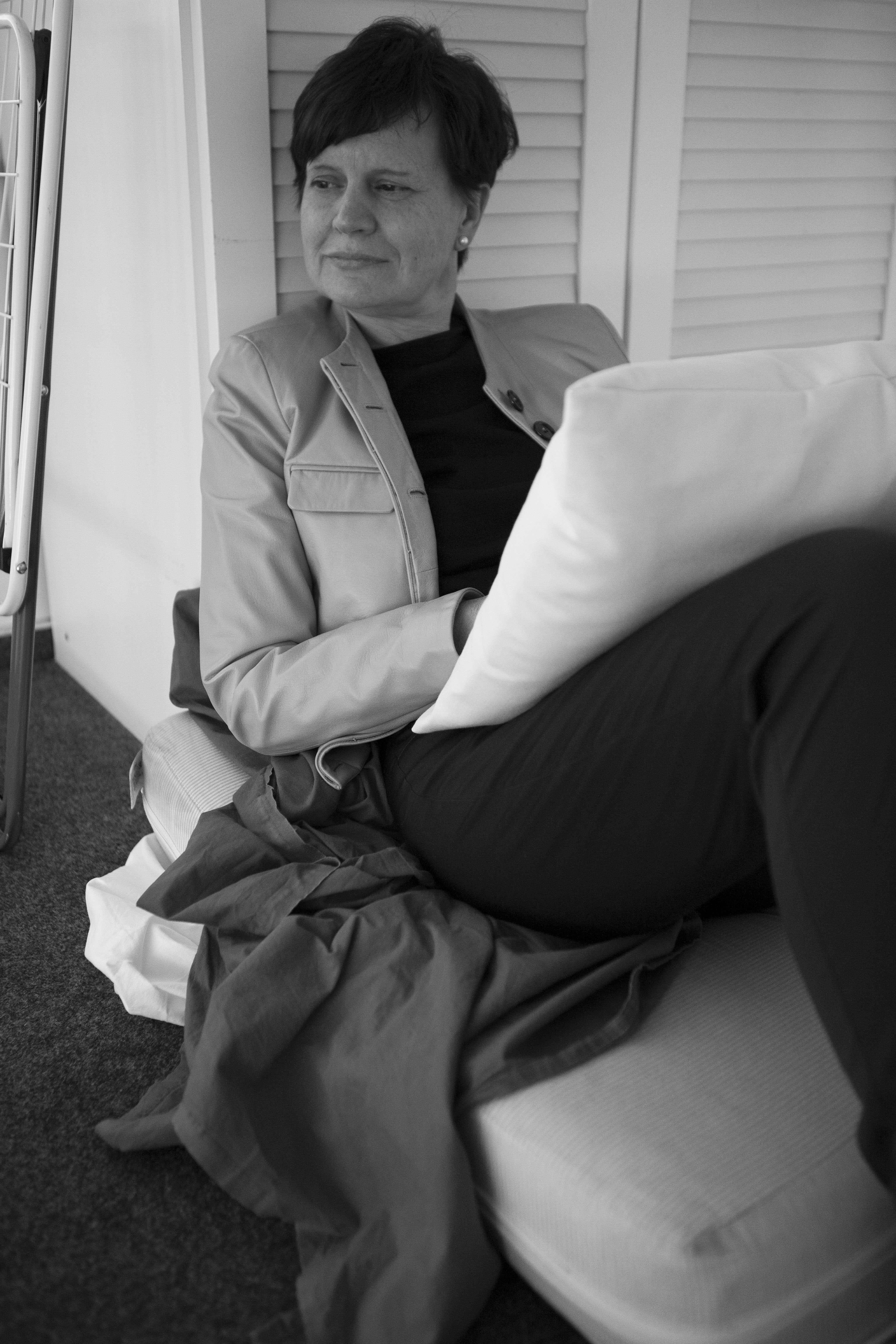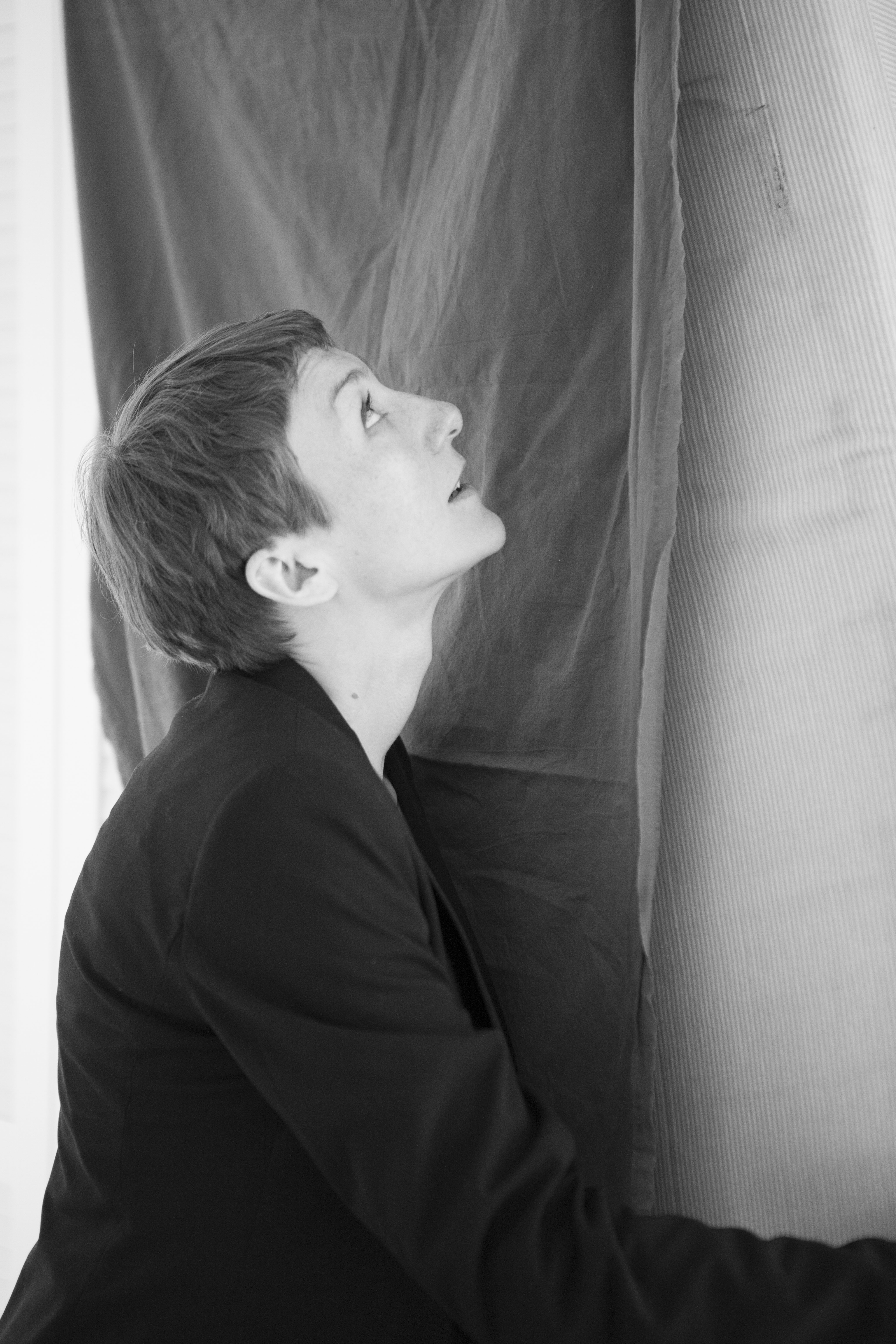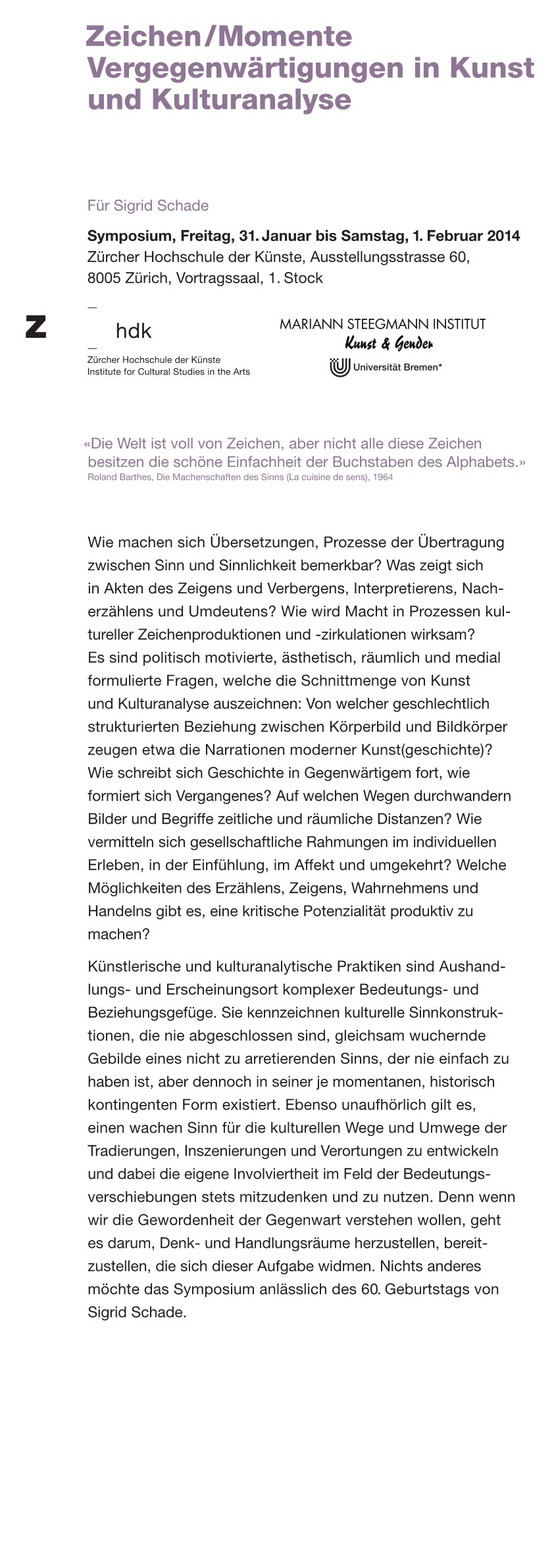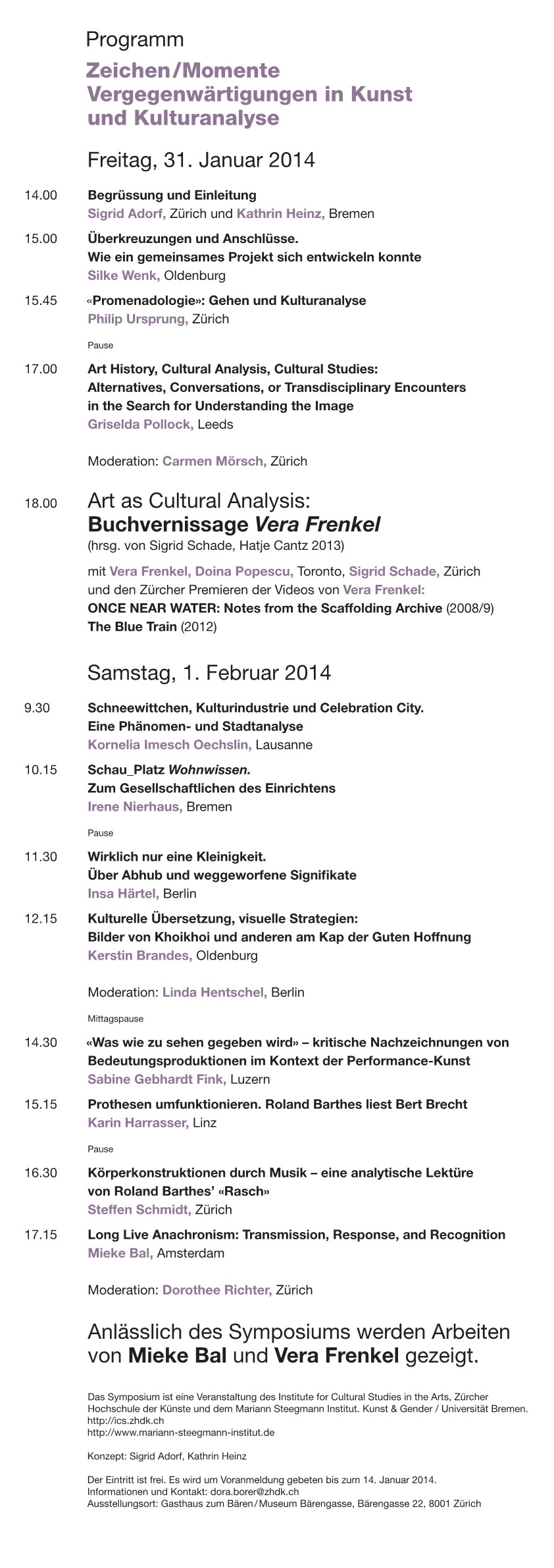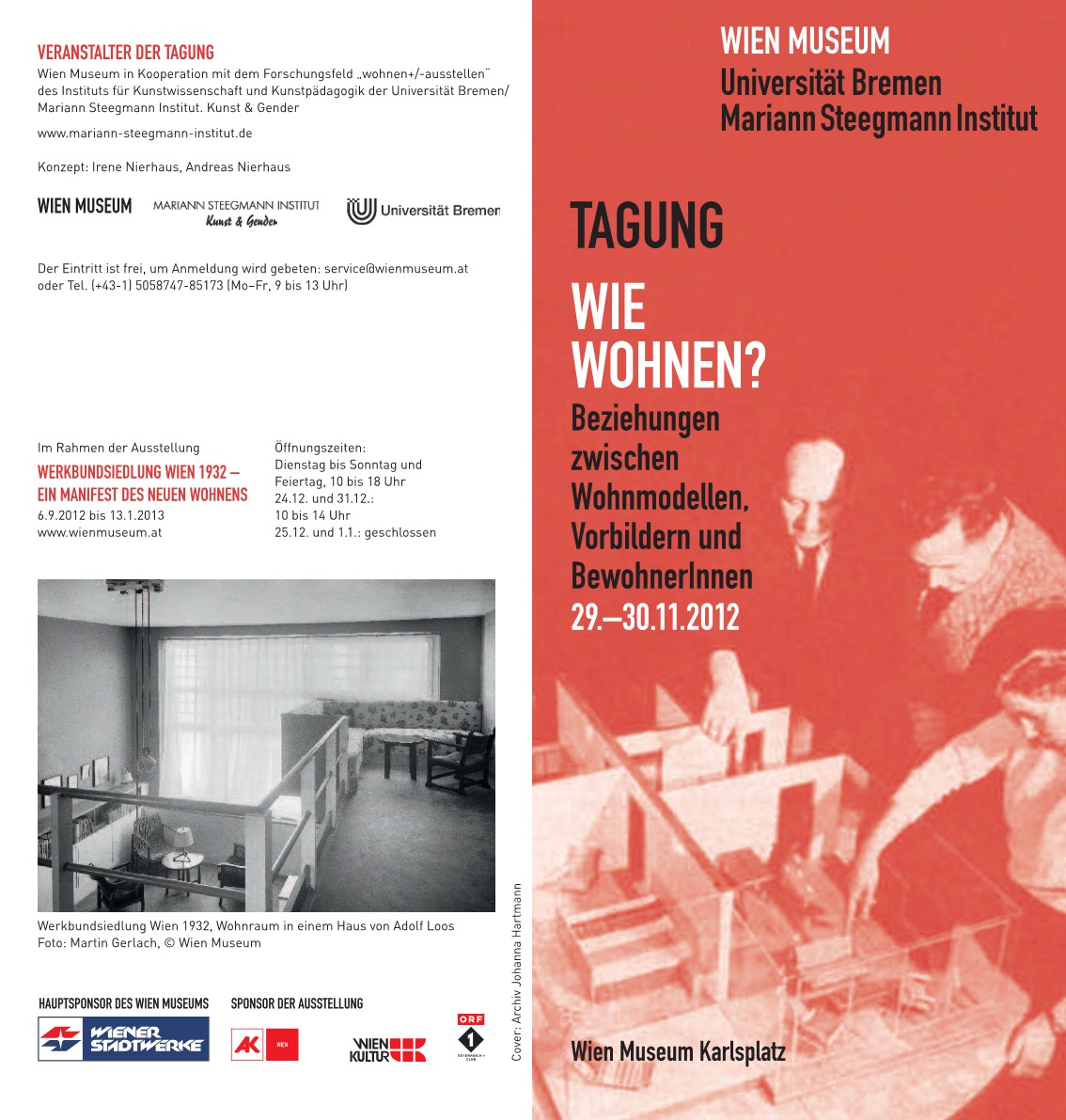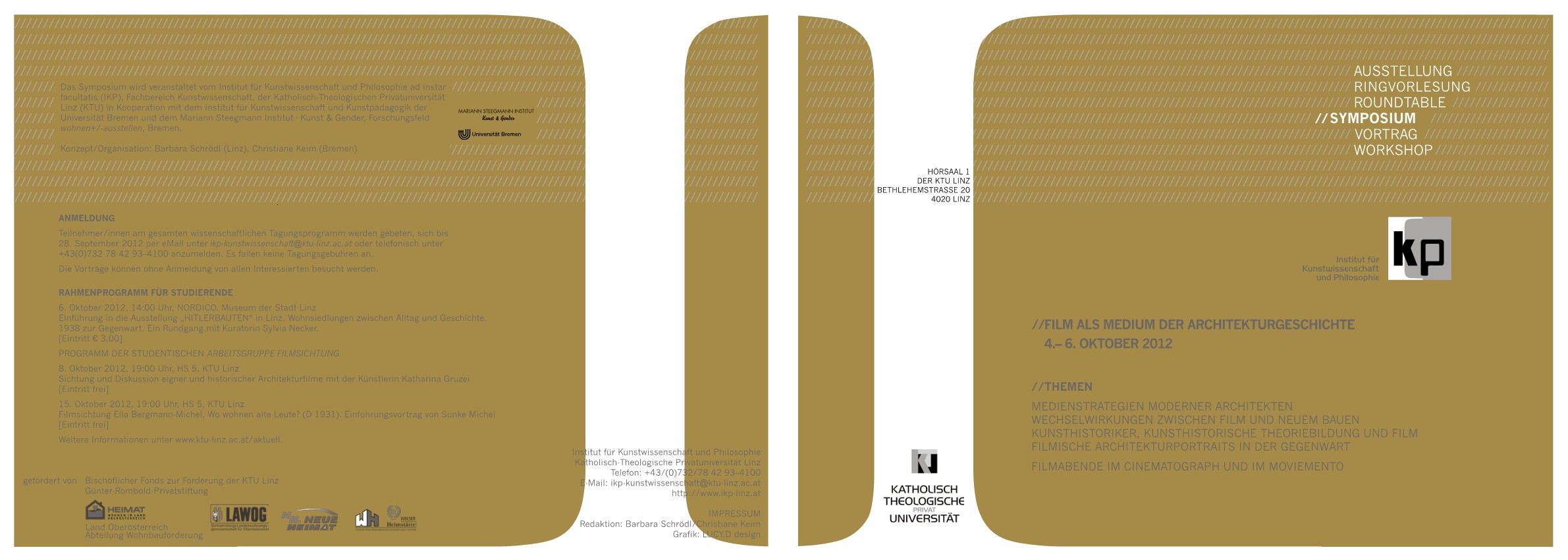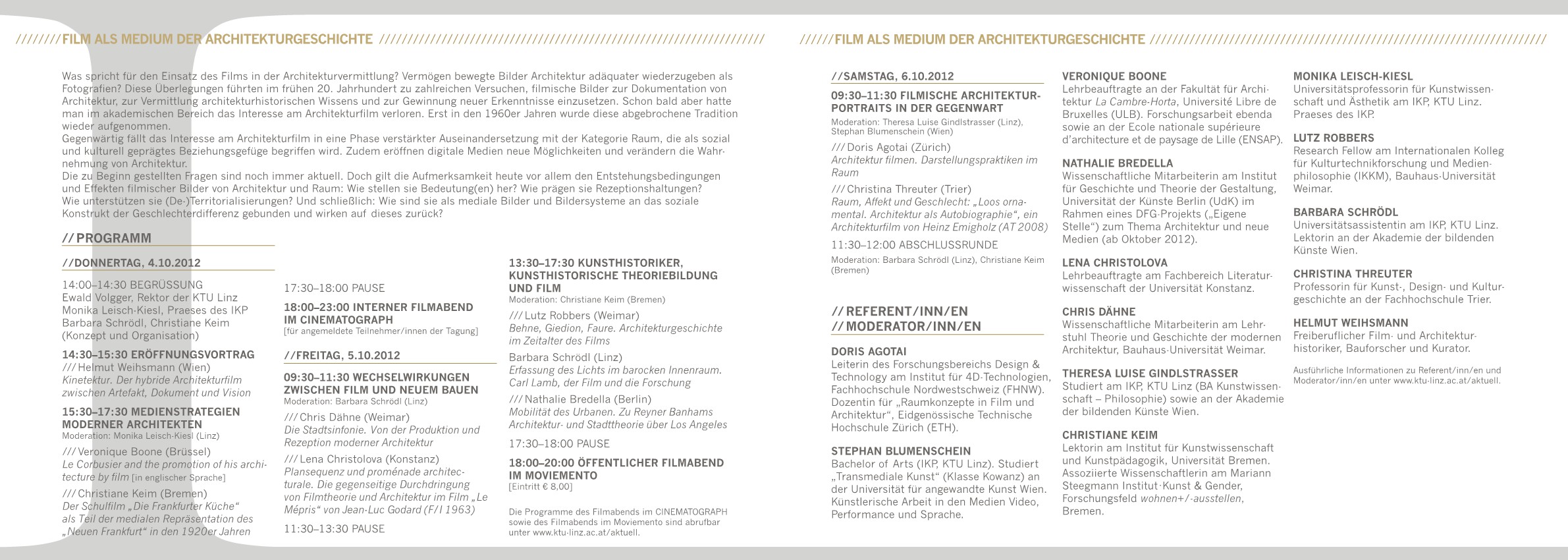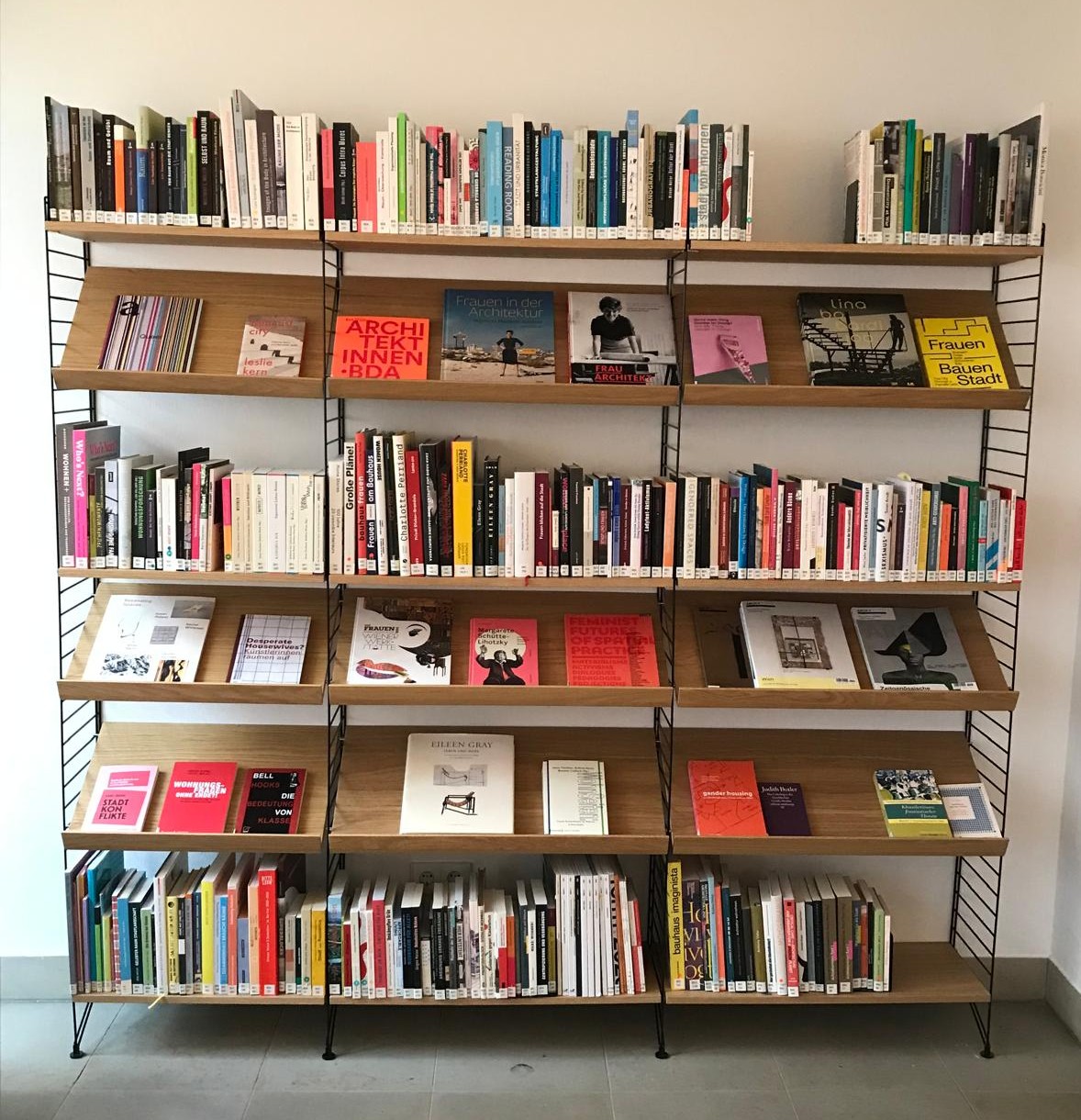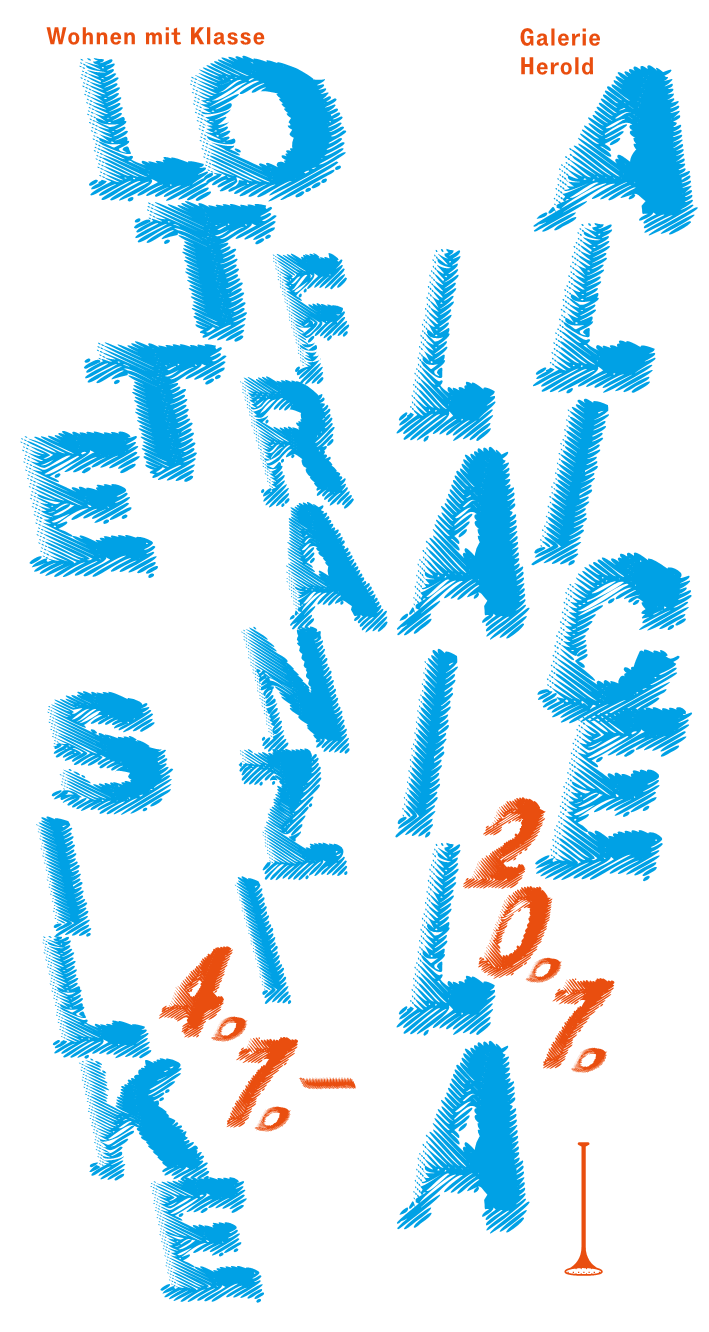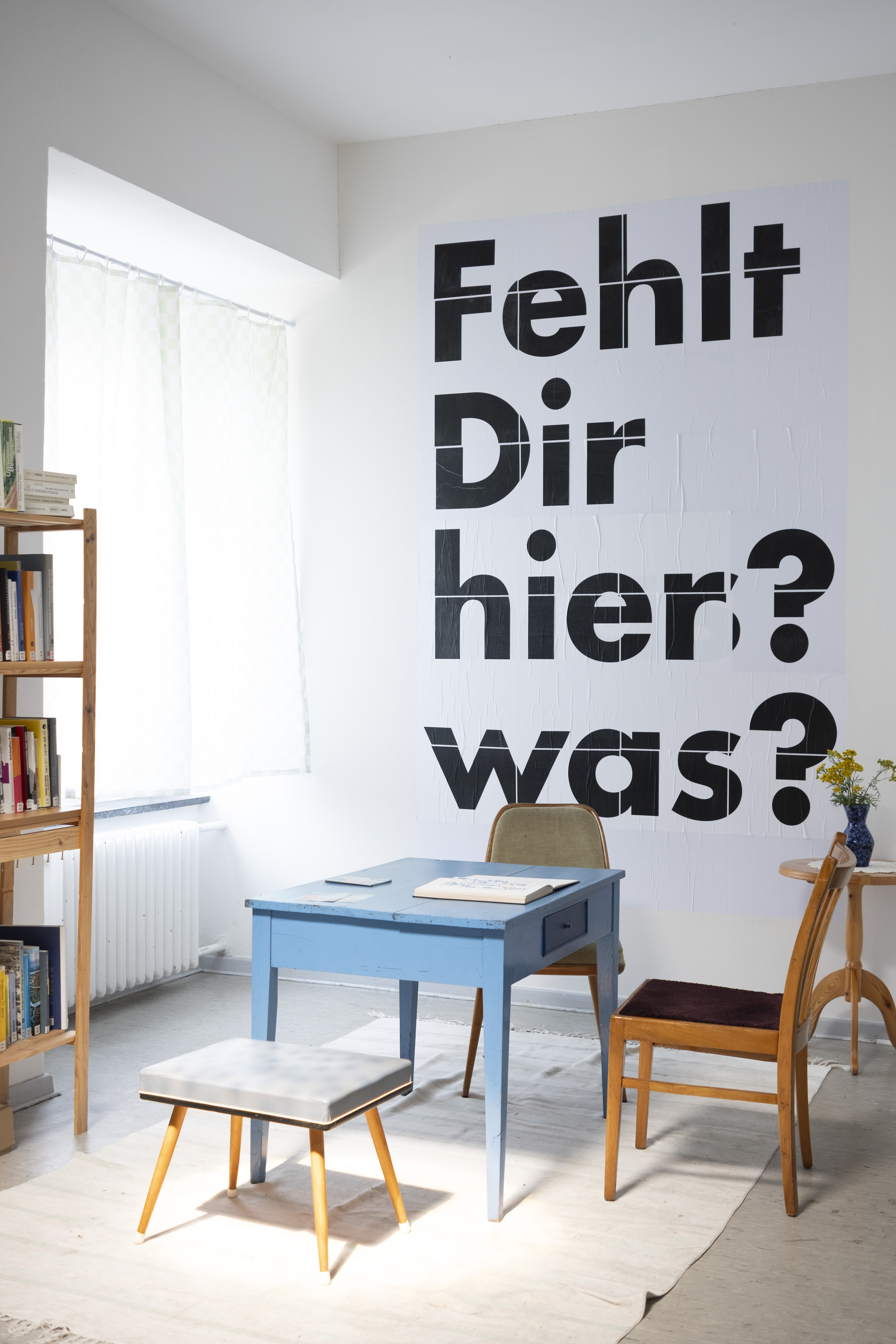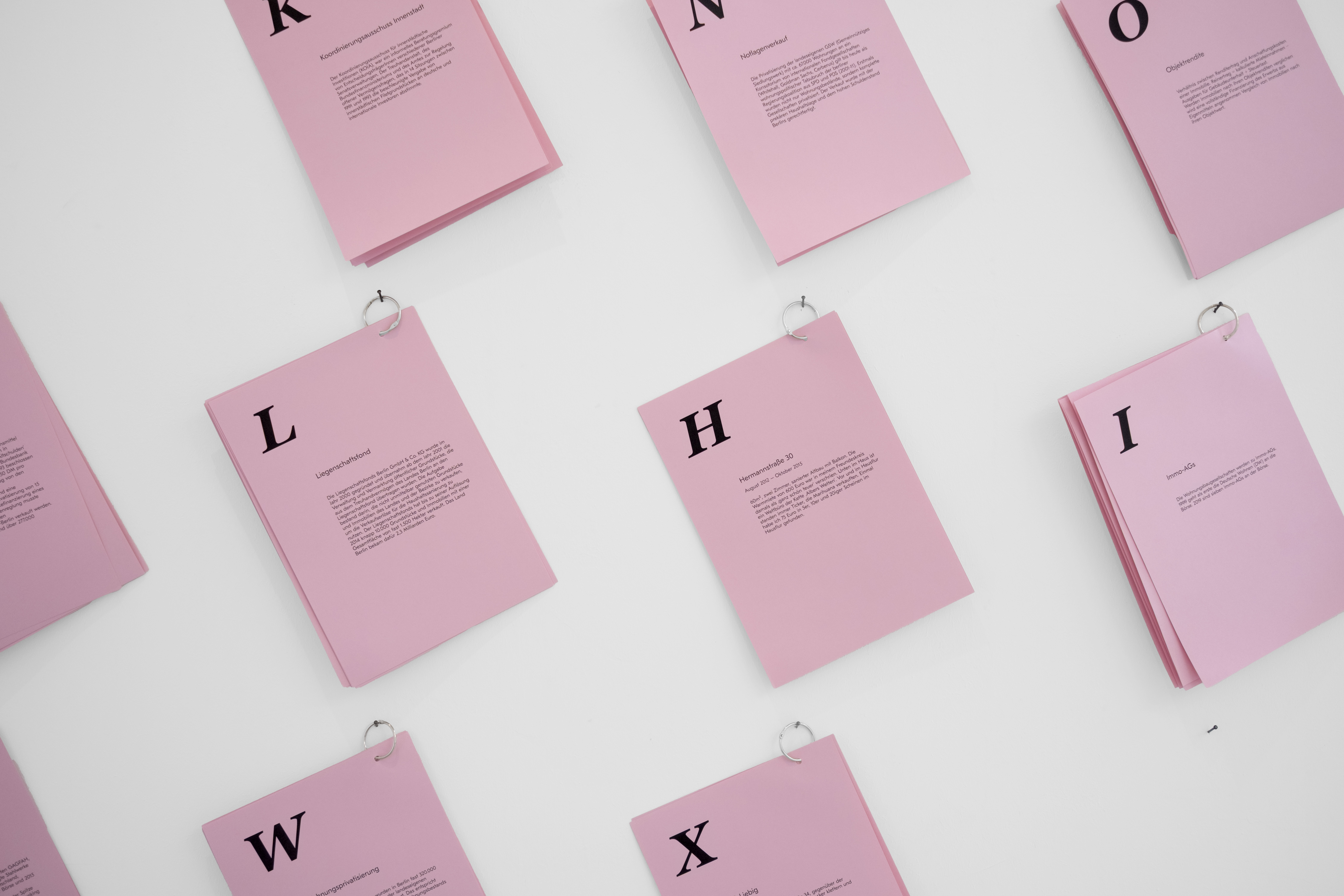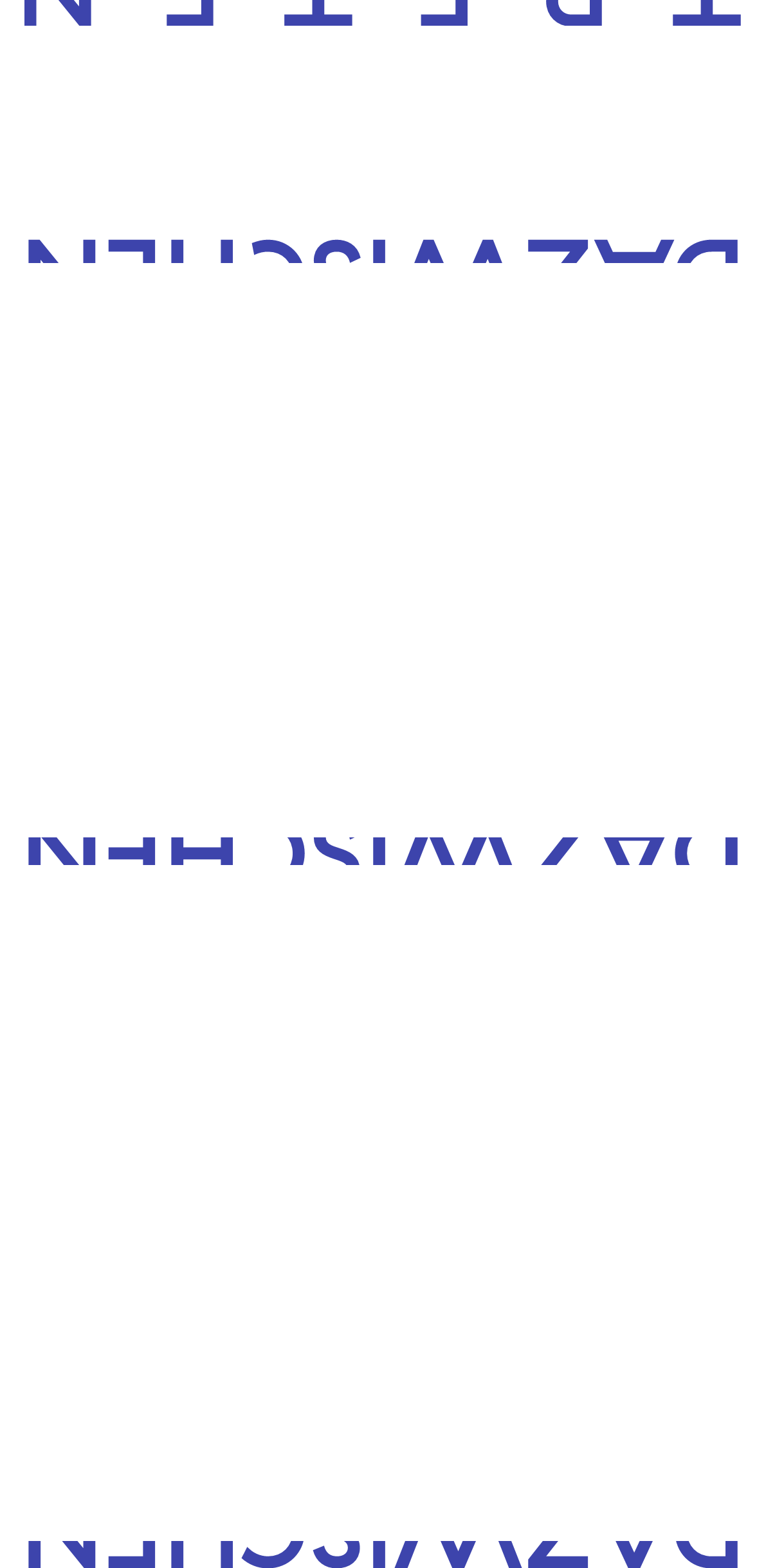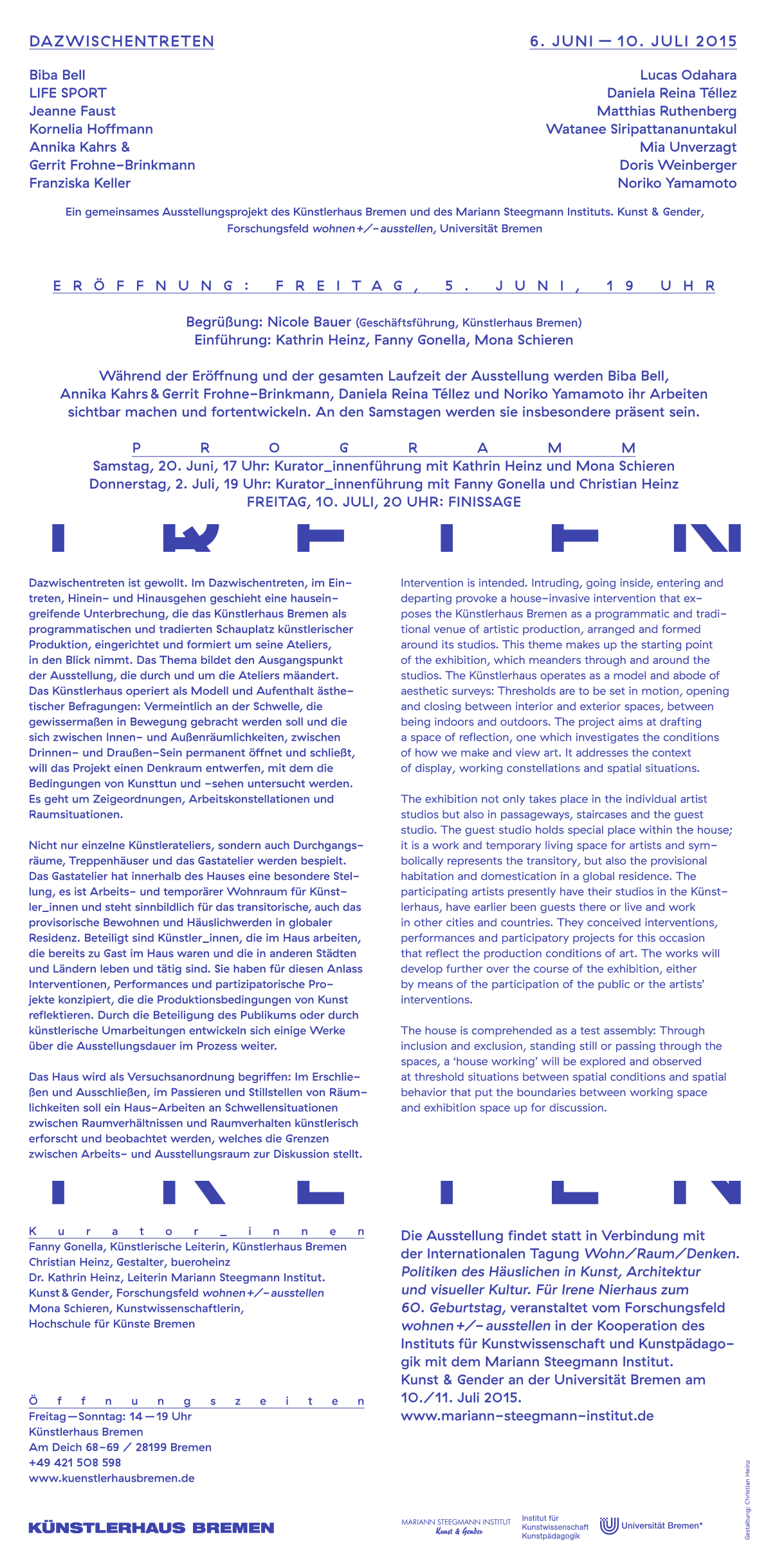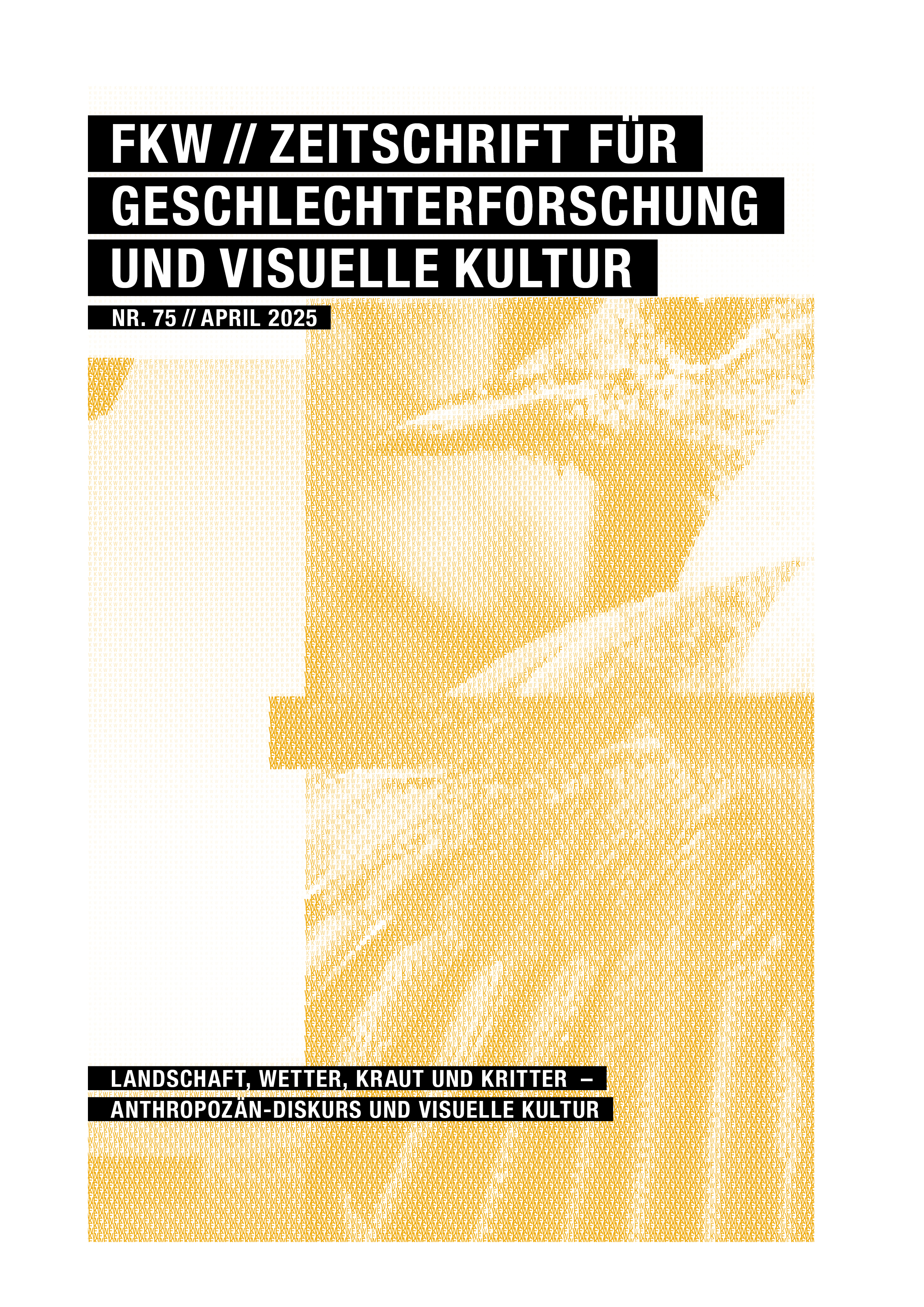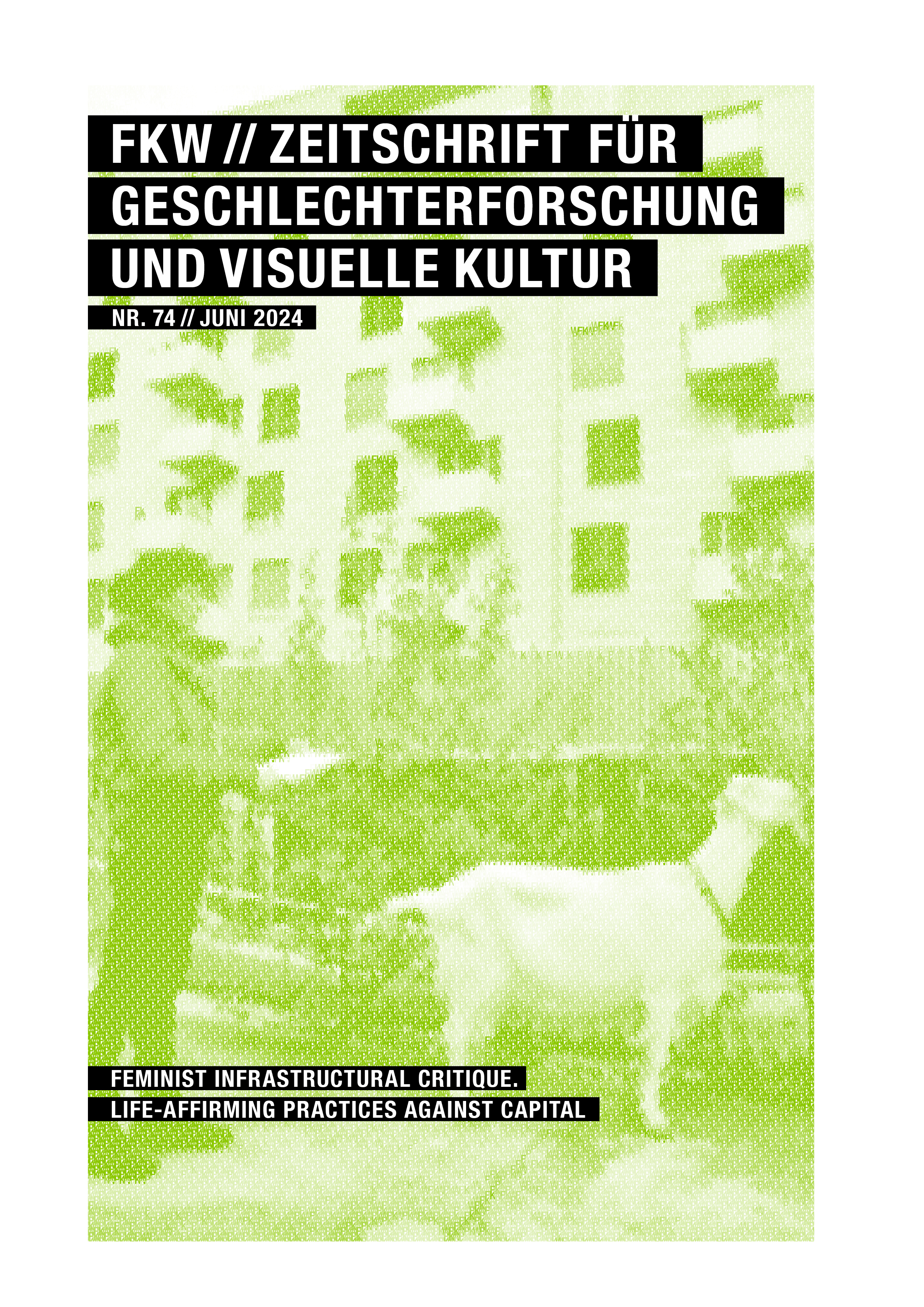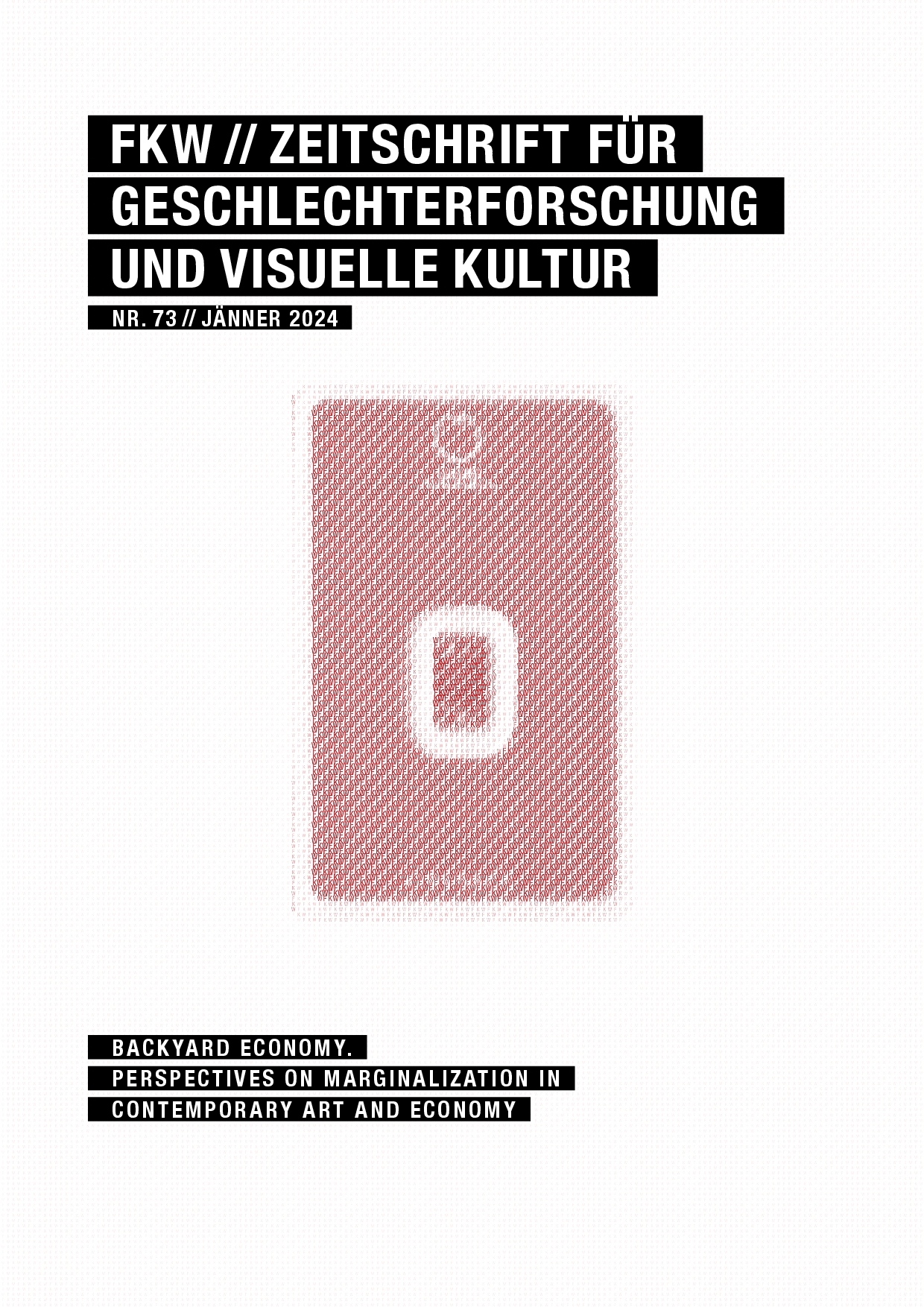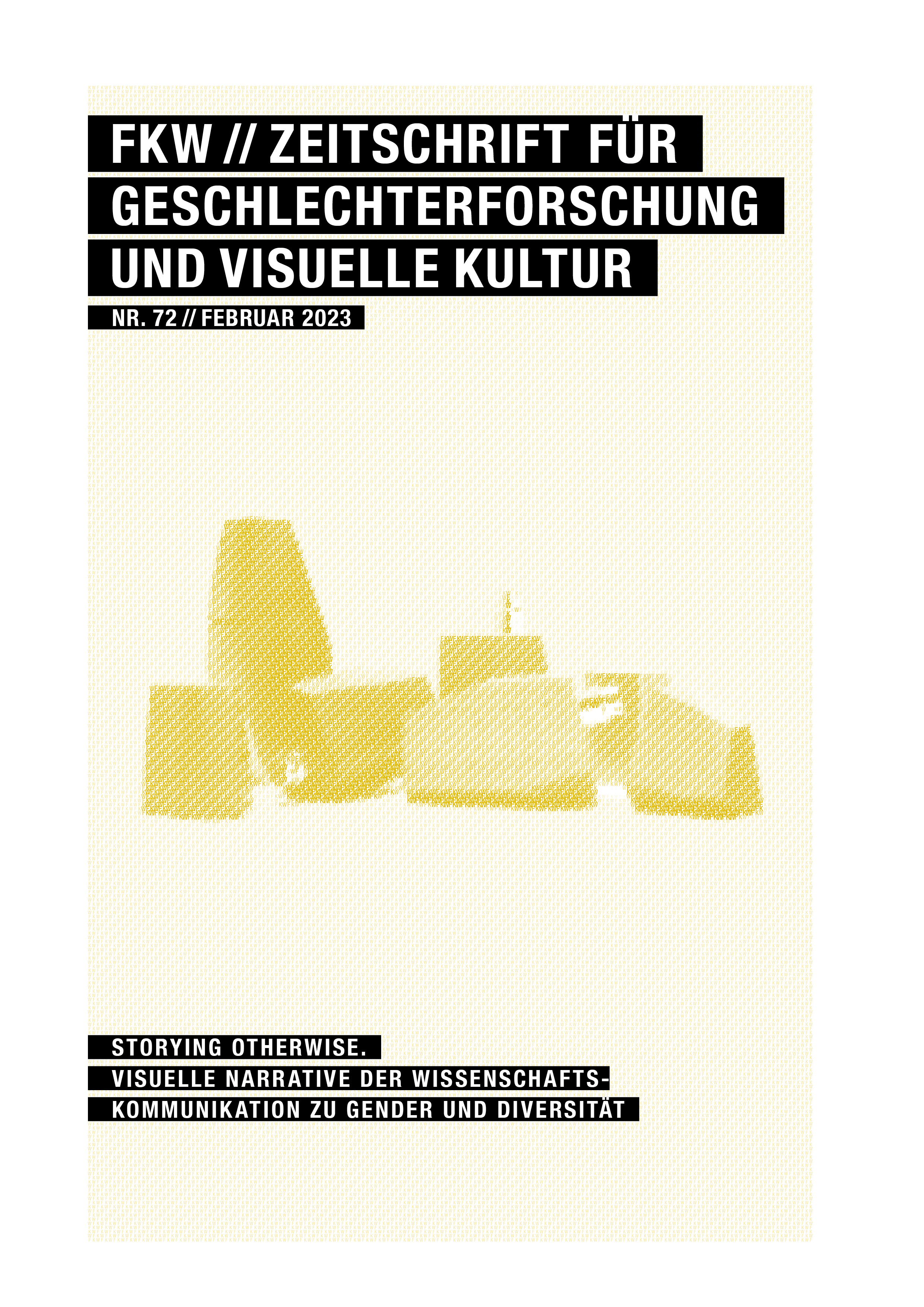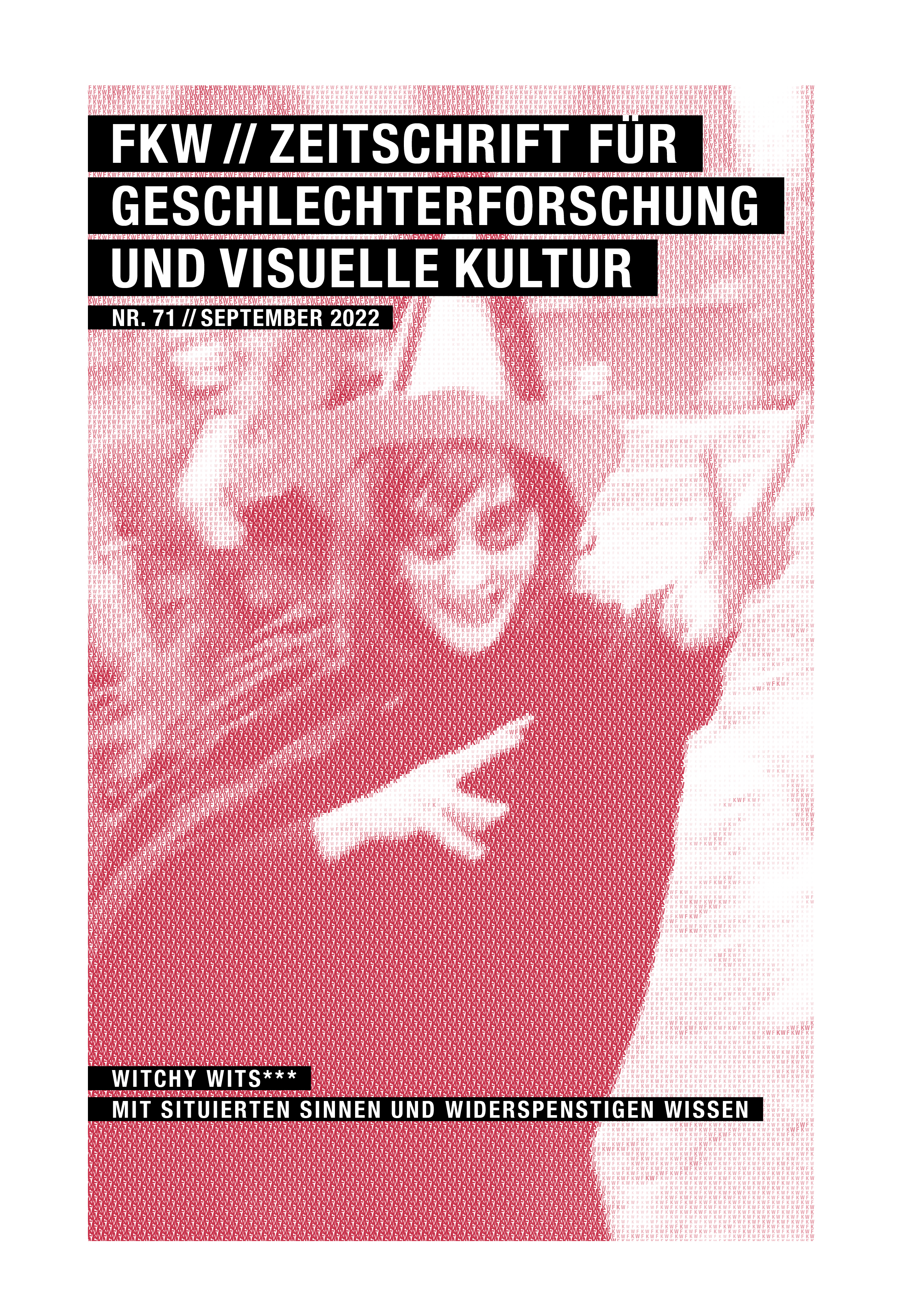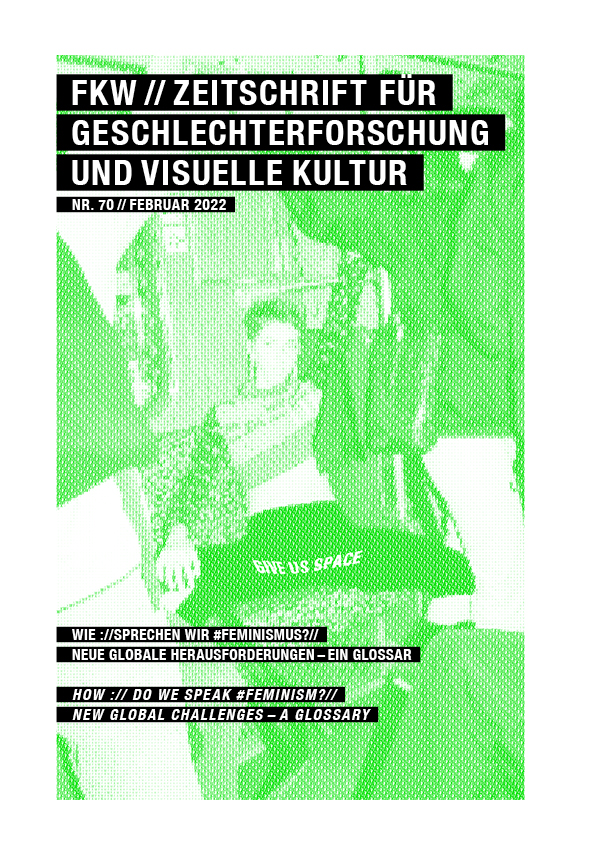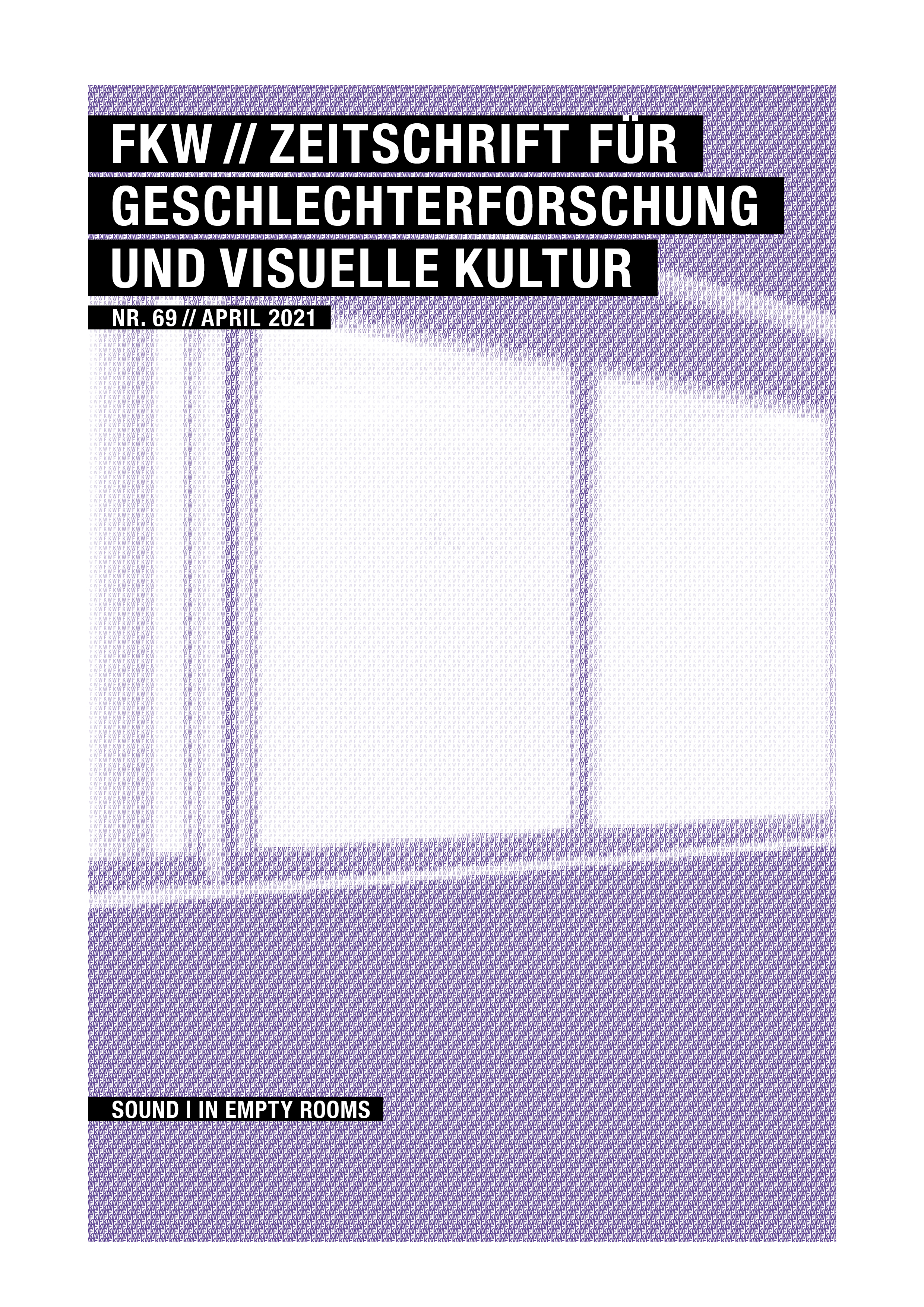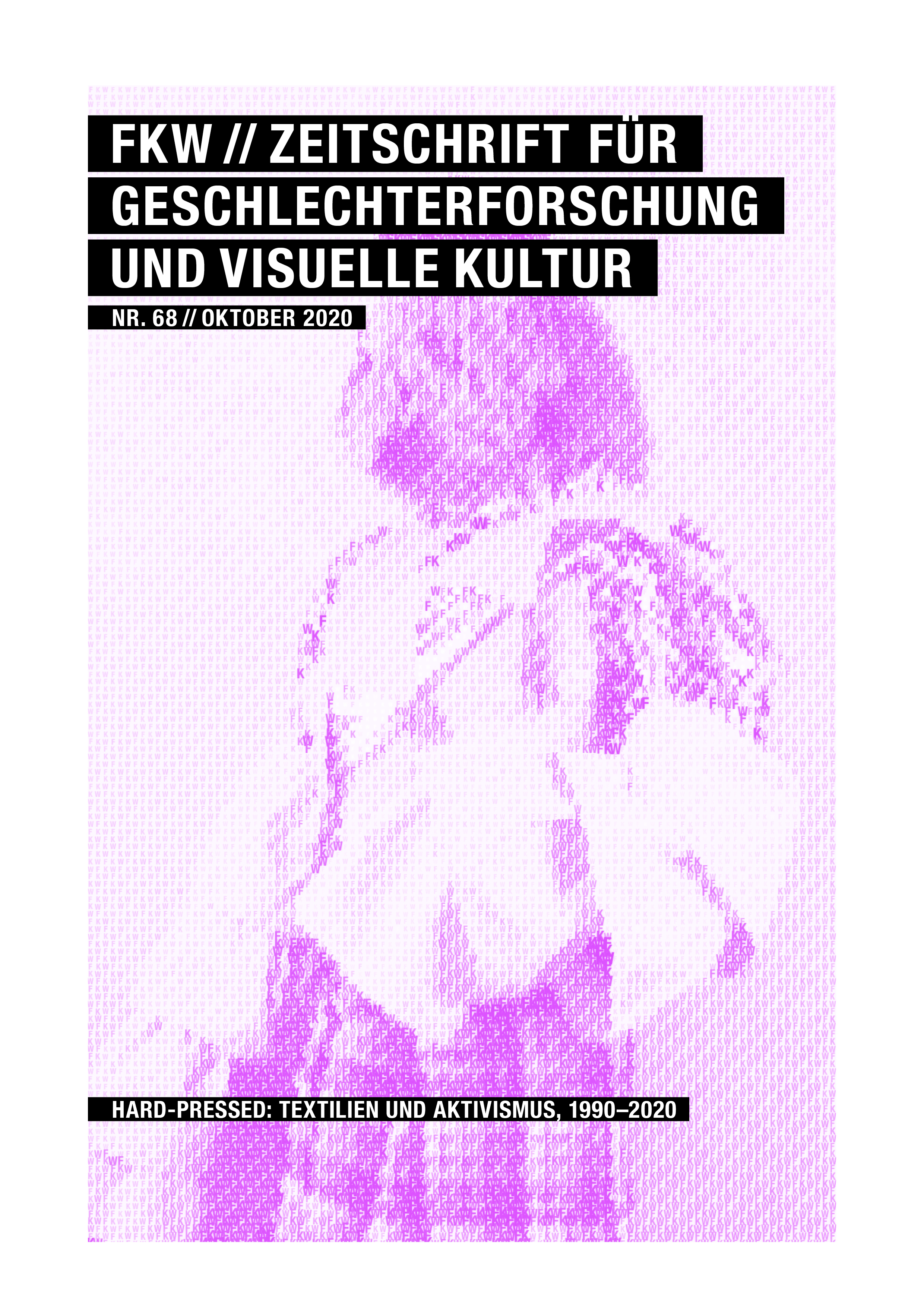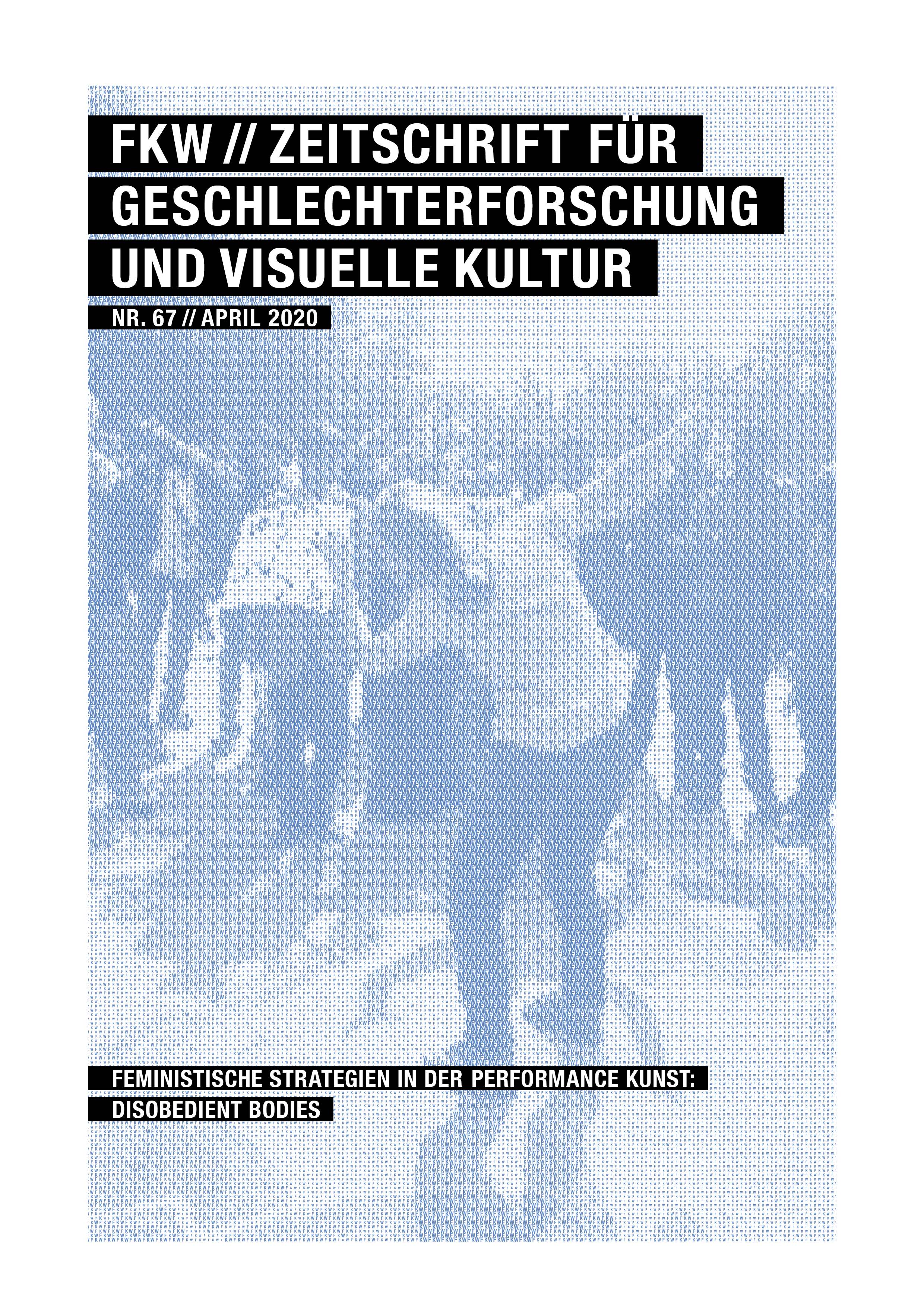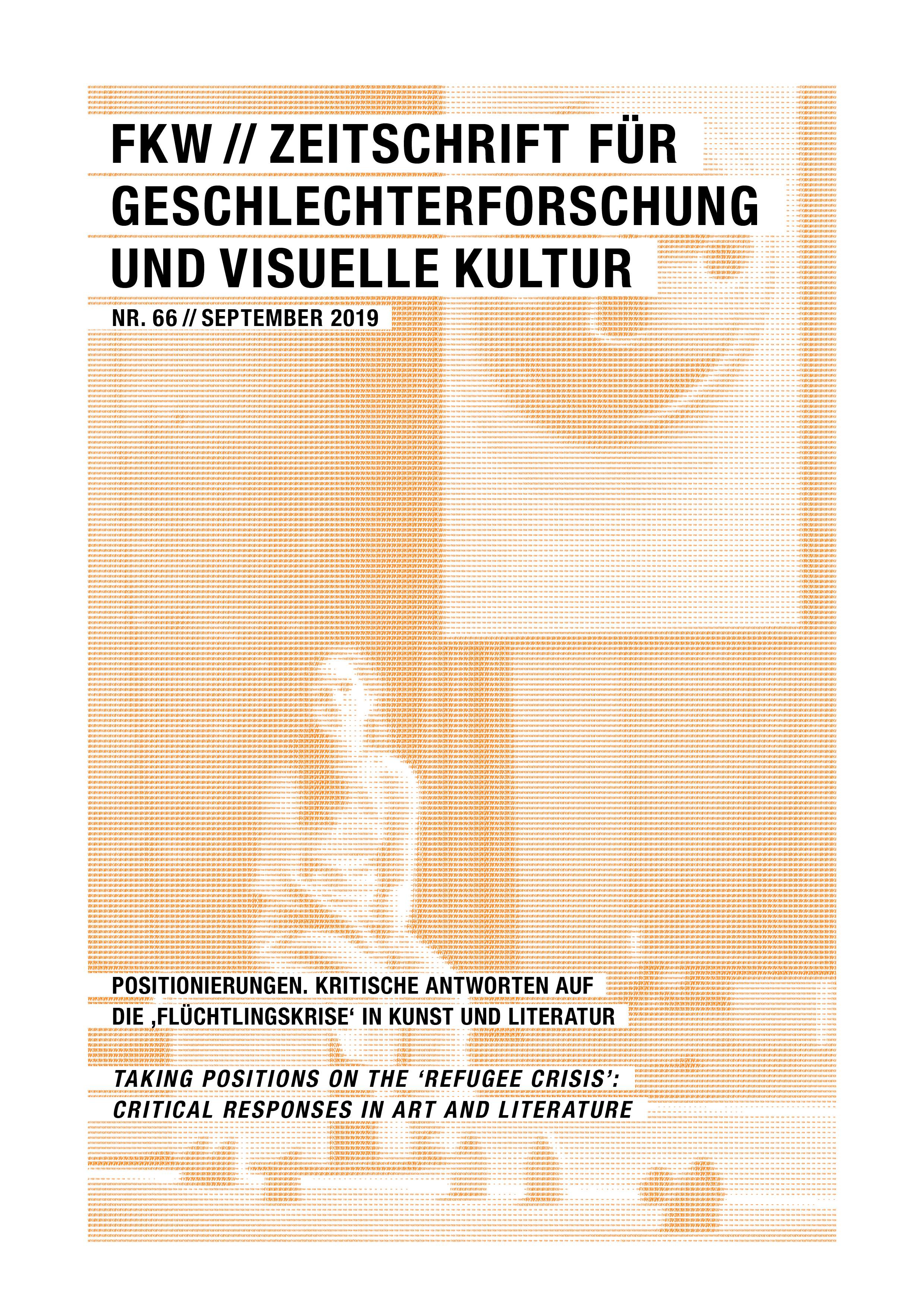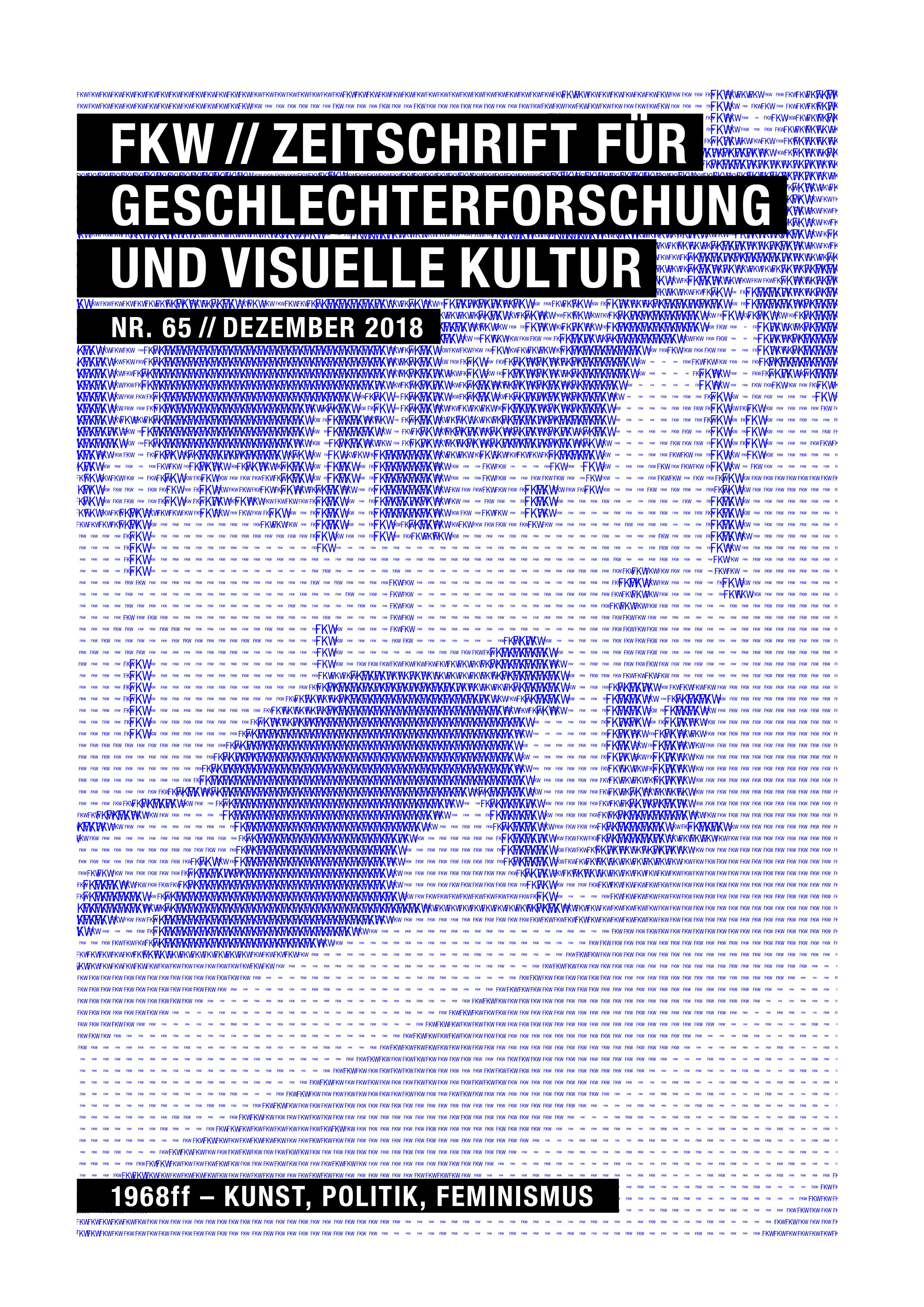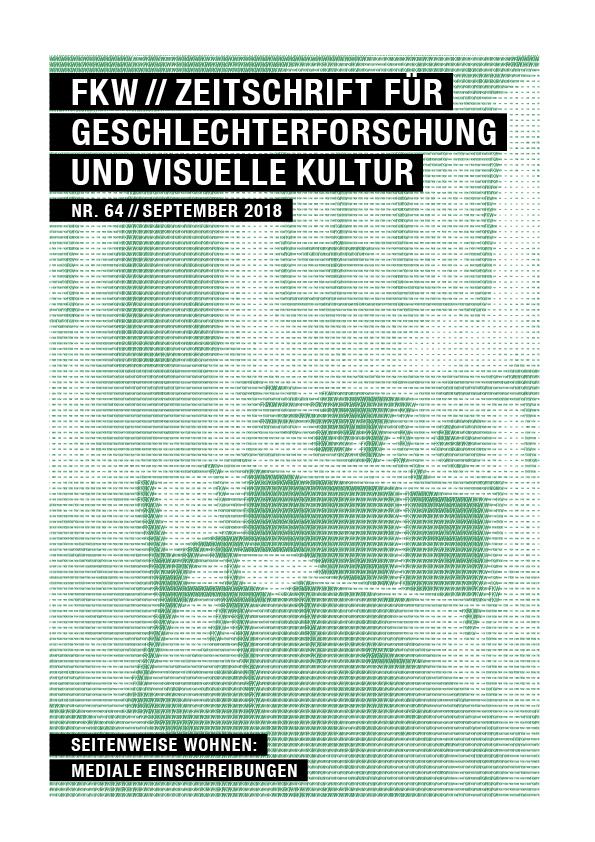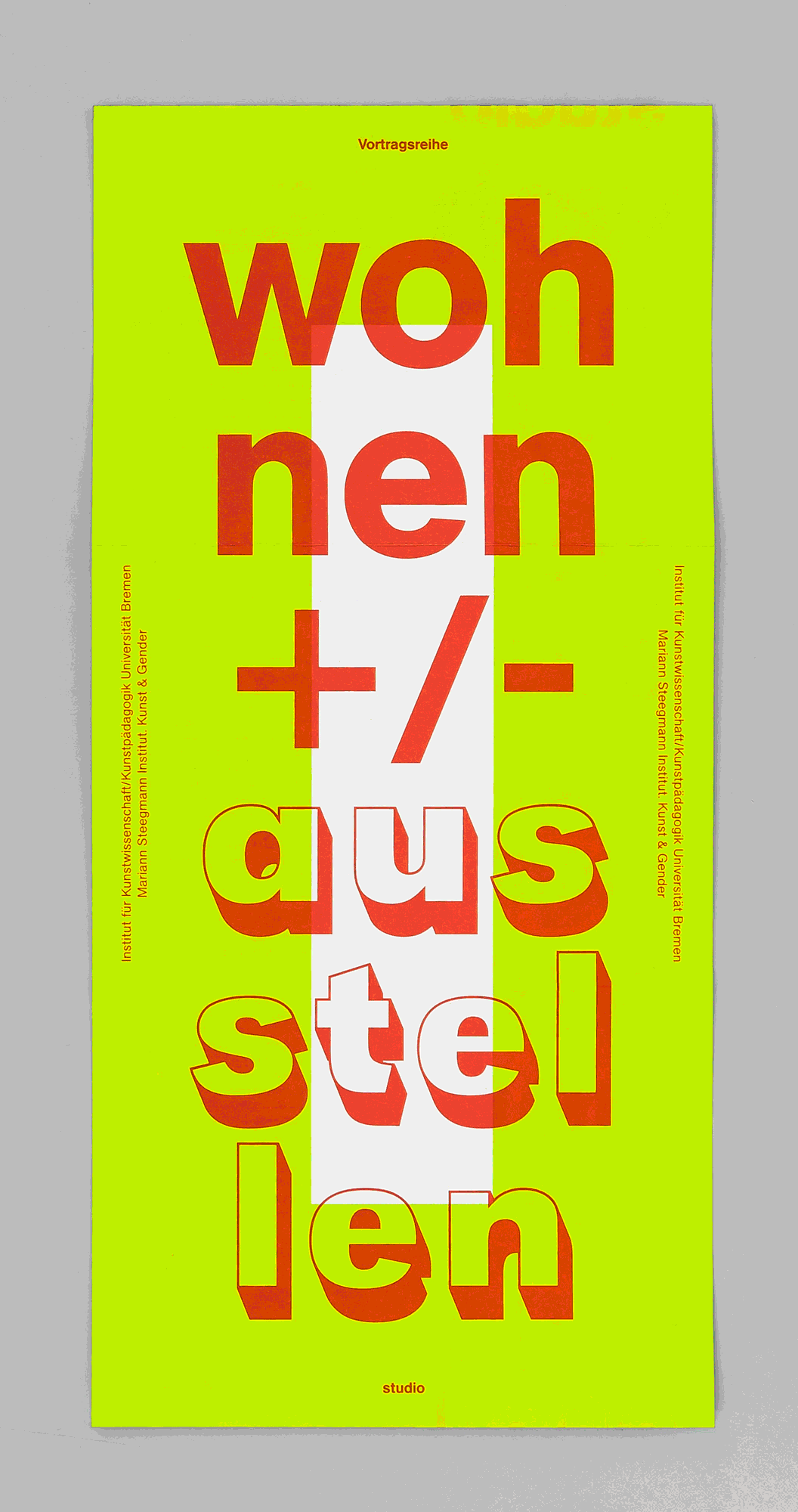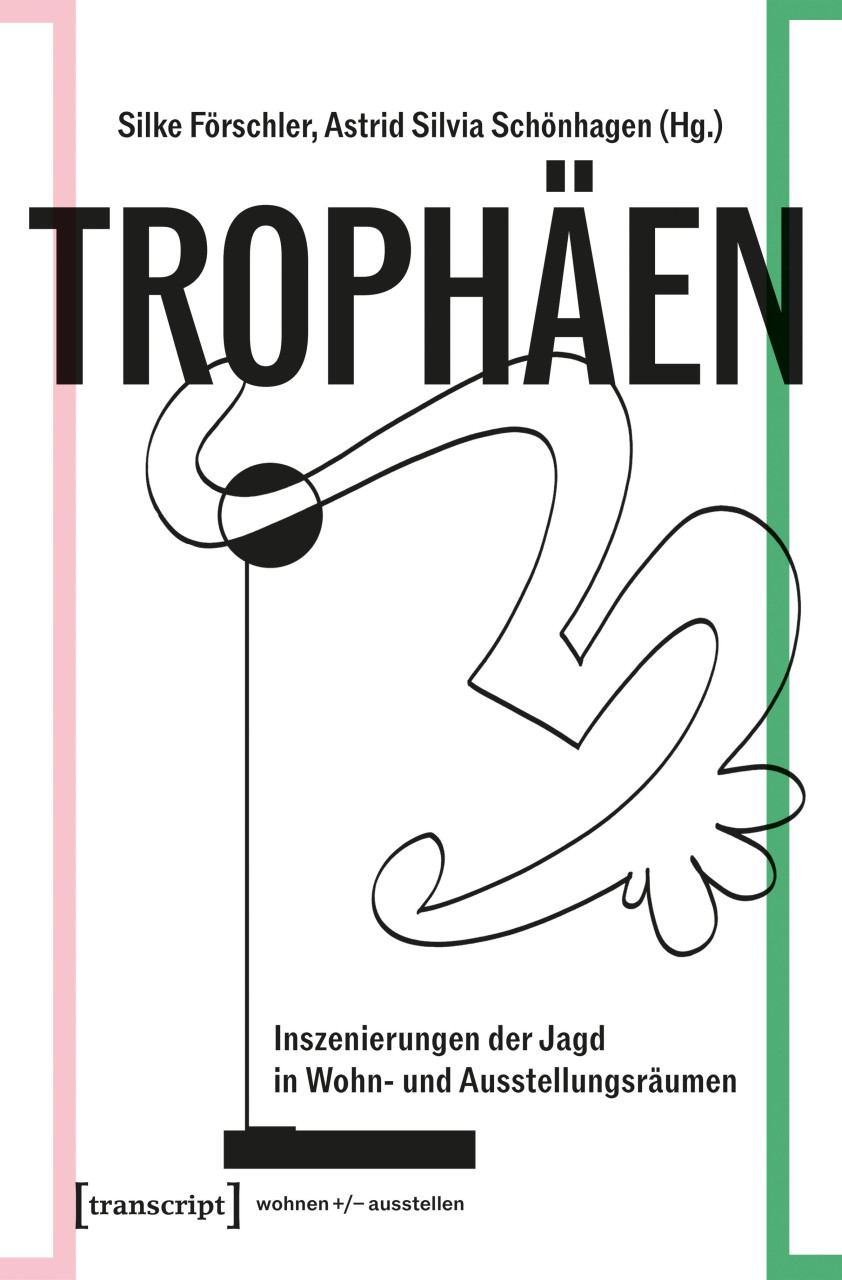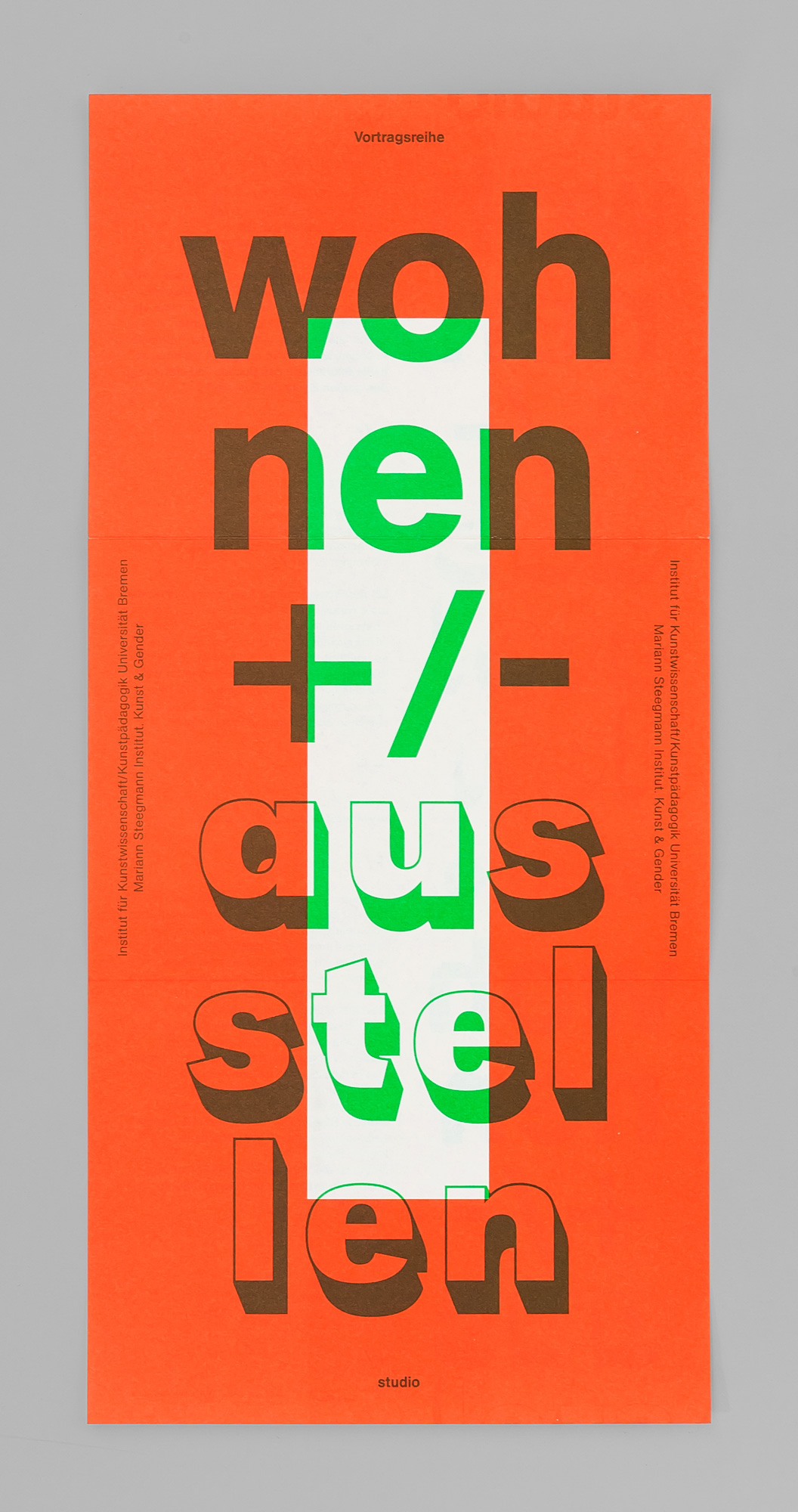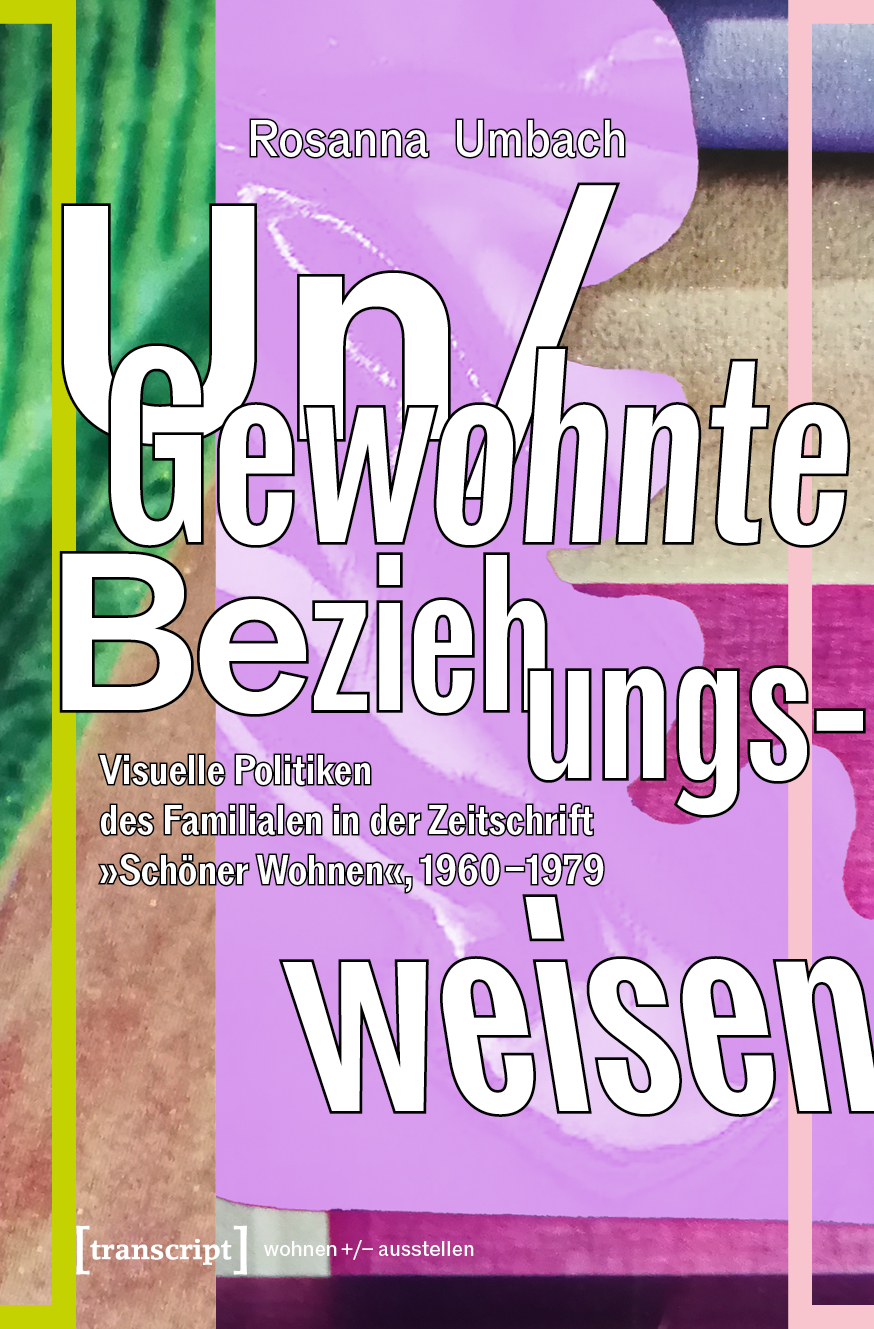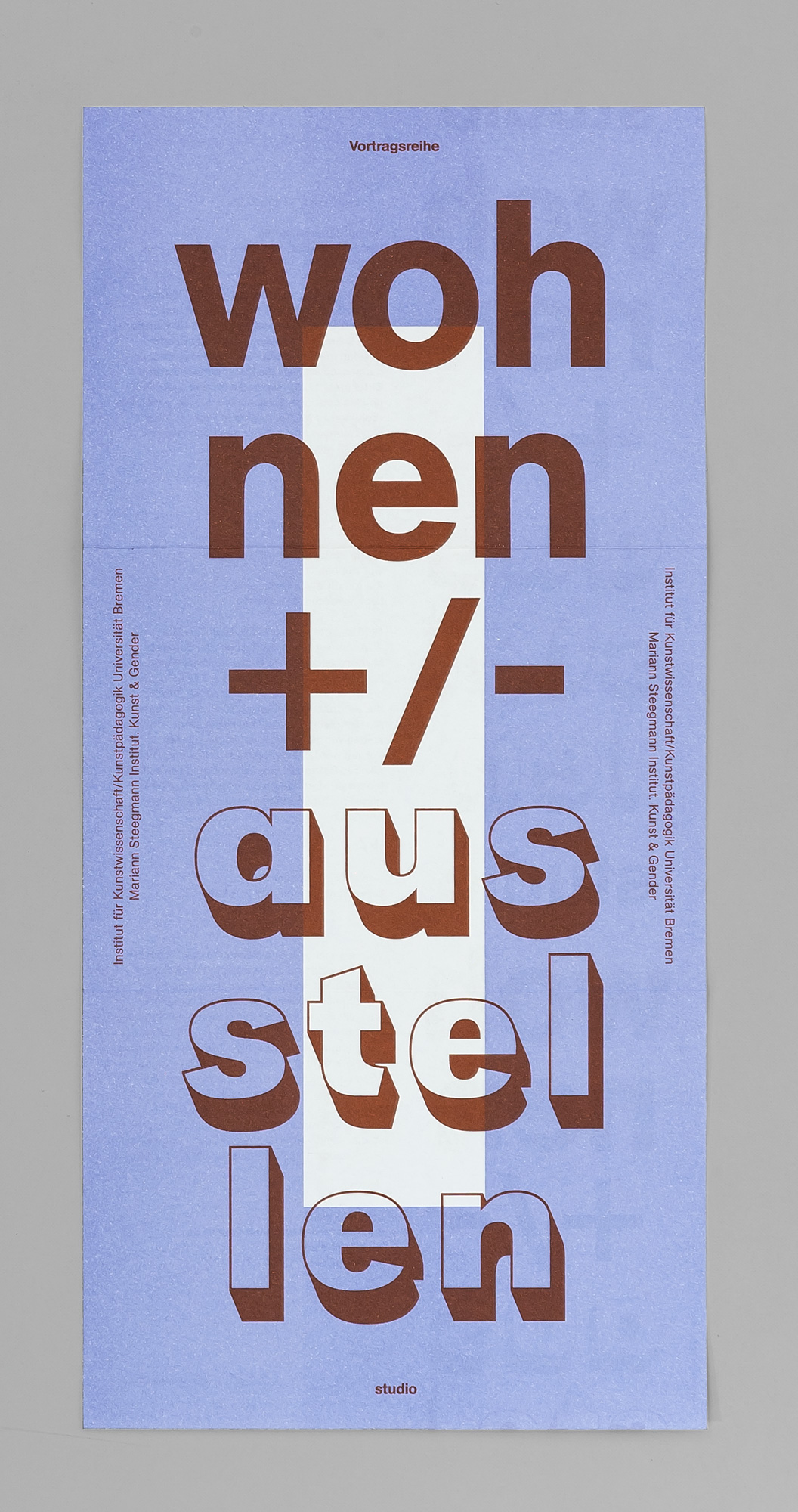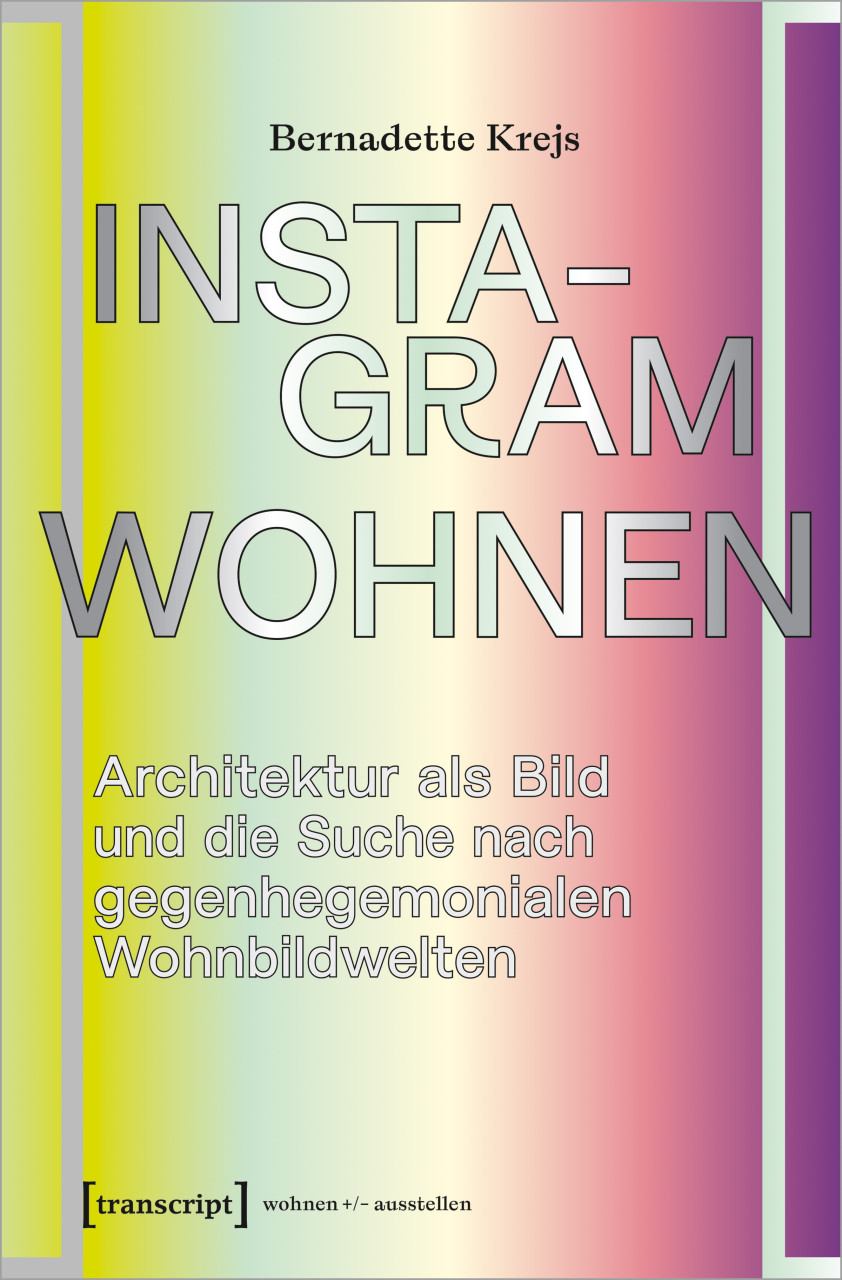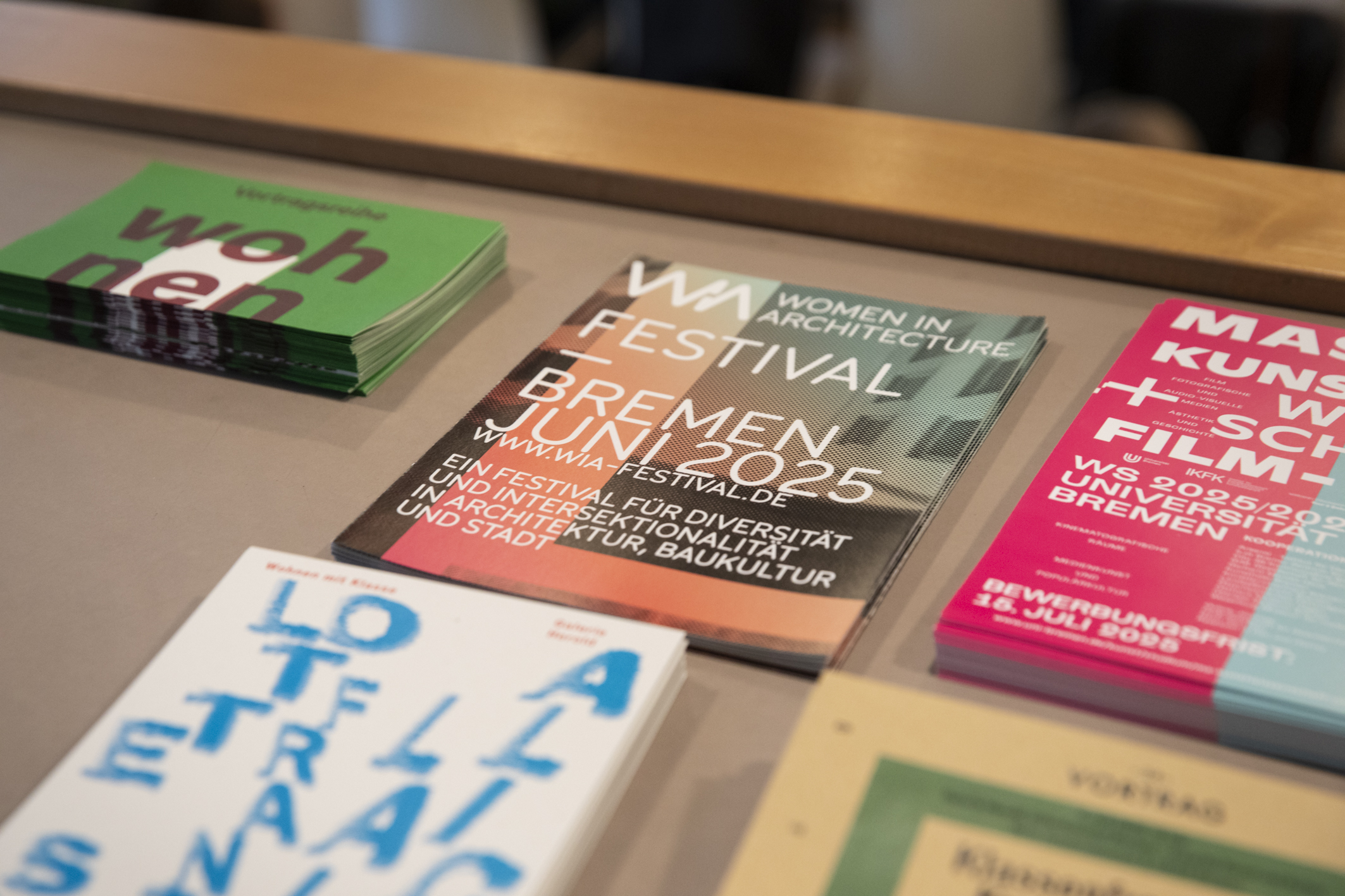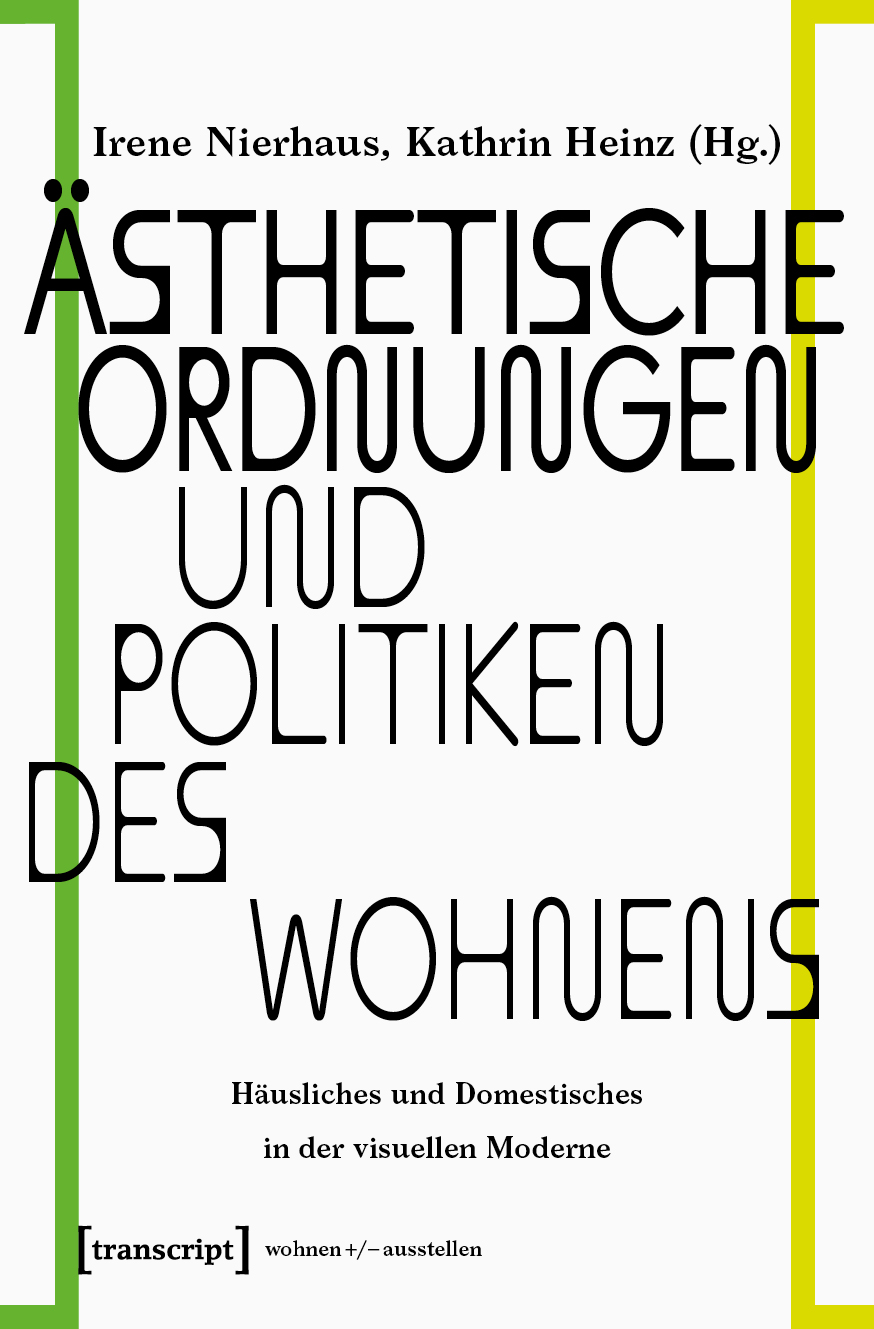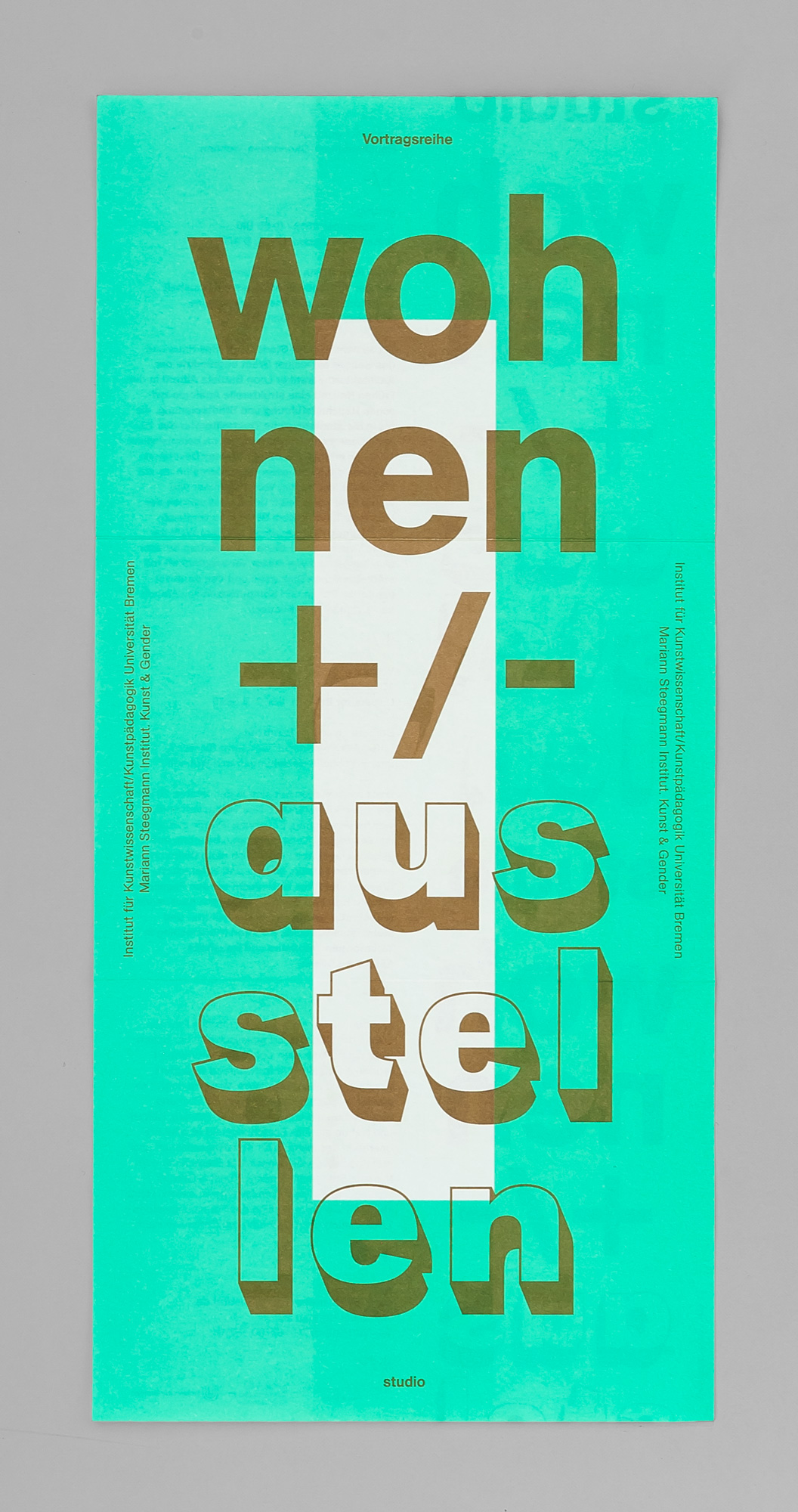Kooperation mit der Universität Bremen und dem IKFK
Das MSI als kooperierendes Gefüge
-

Dr. Kathrin Heinz
Leiterin und Geschäftsführerin, Vorstand des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & GenderDr. Kathrin Heinz

Kathrin Heinz (Dr. phil.) ist Kunstwissenschaftlerin. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (MSI) sowie Leiterin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK) an der Universität Bremen. Gemeinsam mit Irene Nierhaus gibt sie die Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen (transcript) heraus. Seit 2005 ist sie Mitherausgeberin der Fachzeitschrift FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.
ForschungsschwerpunkteSchwerpunkte in Forschung und Lehre beziehen sich auf die Kunst- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Konzeptionen von Künstler*innenschaft in der Moderne, Wohn- und Geschlechterforschung.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Heldische Konstruktionen. Von Wassily Kandinskys Reitern, Rittern und heiligem Georg, Bielefeld: transcript 2015.
Herausgaben
Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus. Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 7).
Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Johanna Hartmann und Christiane Keim. Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).
Zeichen/Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, hg. gemeinsam mit Sigrid Adorf. Bielefeld: transcript 2019.
Aufsätze
Saint Georges, madones et autres objets. Au plus près des natures mortes de Gabriele Münter,
in: Ausst.-Kat. Gabriele Münter : Peindre sans détours, hg. Isabelle Jansen, Hélène Leroy, Anne-Lise Weidmann, Paris-Musées 2025, S. 114-121.„They smell the same!“ Verhängnisvolle Wohnverhältnisse in Bong Joon-hos PARASITE (2019), in: Drehli Robnik, Joachim Schätz (Hg.): Gewohnte Gewalt. Häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino, Wien: Sonderzahl 2022, S. 251–255.
GeWOHNte Seiten: Blättern, Einrichten, Kombinieren. Gestaltung als Wissenspraxis. In: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021, S. 44–81. (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Rein ins Haus. Raumverhältnisse und Wohnbeziehungen an stillen Orten, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021, S. 339–365 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).
An dünnen Fäden: Raumarbeiten und Wohndinge, in: Suse Itzel (Hg.): Suse Itzel Auflösungen, Künstlerinnenbuch, 2020, S. 97–105.
Von ausgeschnittenen Möbeln und eingeklebten Gefäßen. Zur Edition von Mia Unverzagt, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Heft Nr. 64, 2018, S. 108–113.
Bezugssystem Matratze [Denkausschnitte], in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, Bielefeld: transcript 2016, S. 41–55 (Schriftenreihe wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).
ProjekteForschungsfeld wohnen+/-ausstellen (Leitung)
Forschungsprojekt Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen (Leitung, gemeinsam mit Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus)
Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Symposium, 11./12. Juli 2024, Mahlsdorf (Leitung, gemeinsam mit Prof. Dr. Kerstin Brandes und Astrid Silvia Schönhagen M.A.)
Forschungsprojekt Künstler*innen haushalten. Wohnen als ästhetische und epistemische Praxis (AT)
MitgliedschaftenUlmer Verein - Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.
Frauen Kunst Wissenschaft e.V. (Vorstand), Trägerverein von FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur
Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK
Museumsfreunde Weserburg (Vorstand)
GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Kunstverein Bremen
Blaumeier-Atelier (Fördermitgliedschaft)
Vorträge(Auswahl)
Wohnen in Bildern: Gabriele Münters Räume
Vortrag anlässlich der Buchpräsentation Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023), Akademie der bildenden Künste Wien, 09.04.2024.(Sich) Raum nehmen. Wohnpolitiken und Geschlechterverhältnisse
Vortrag am Institut für Architekturbezogene Kunst, TU Braunschweig, 19.05.2022.Studio-Gespräch bei buten un binnen
am 26.3.2022 zum Thema Wohnen anlässlich der Wochenserie Zeig mir, wie du wohnst. URL:
https://www.butenunbinnen.de/videos/talk-mariann-steegmann-institut-kathrin-heinz-100.htmlGerahmtes Wohnen
Einführung zur Internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur, Universität Bremen, Onlineveranstaltung, 18.–20.6.2021.Wie Kunstgeschichte erzählen? Gabriele Münter retrospektiv
Vortrag im Sophiensalon am Forschungszentrum Musik und Gender, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 24.4.2019.Gemalte Geschichten und andere Rahmungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter
Vortrag in der Reihe KunstBewusst, Museum Ludwig Köln, 11.12.2018Über Bildfindungen und Objektanordnungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter
Vortrag bei Ein Symposium für Gabriele Münter, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 23.–24.2.2018.Verdeckte Einschreibungen – Körper/Dinge und andere Wohnbedürfnisse
Vortrag bei Wie Wohnen? Interdisziplinäres Arbeitstreffen an der Schnittstelle von Mode, Kunst, Textildesign und Medien, Universität Paderborn, 2.2.2018. -

Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (bis März 2021), Vorstand (beratend)Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Irene Nierhaus, bis 2021 Professorin für Kunstwissenschaft und ästhetische Theorie an der Universität Bremen und Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender in Kooperation mit der Universität Bremen. Gründungsprofessorin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen und der gleichnamigen Schriftenreihe bei transcript mit Kathrin Heinz. Seit 2012 im Beirat der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur. Seit seit 2021 Vorsitzende der Mariann-Steegmann-Stiftung Deutschland und seit 2023 Mitglied des Universitätsrates der AAU-Universität Klagenfurt. Mitglied des Wohnprojektes Gleis 21 Wien.
ForschungsschwerpunkteForschungen zur visuellen und räumlichen Kultur, insbesondere zu Beziehungen zwischen Kunst, Architektur und bildnerischen Medien des 19. und 20. Jahrhunderts wie der Gegenwart. Wohnen wird als zentrale Kategorie gesellschaftlicher Raumbildung und entsprechendes Prozessgefüge von Bild, Raum und Subjekten untersucht. Der Fokus liegt auf Geschichte, Gesellschaftspolitik und dem Konzeptiven des Wohnens in verschiedenen Formen und Formaten des Visuellen.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Arch6: Raum, Geschlecht, Architektur, Wien: Sonderzahl 1999.
Herausgaben
Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und Visueller Kultur der Moderne, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2020 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 7).
Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2016 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).
Aufsätze
Das eingerichtete Leben: Zu Zeige- und Bildpolitiken des Wohnens im Roten Wien, in: ARCH+ Zeitschrift für Architektur und Urbanismus, Heft 244 Wien – Das Ende des Wohnbaus (als Typologie), 2021, S. 78-83.
Wohnen. Domestisches, Wohnwissen und Schau_Platz: Kulturanalysen zum Gesellschaftlichen des Ein_Richtens: Theoretische Prolegomena für eine kunstwissenschaftliche Wohnforschung, in: Sigrid Adorf, Kathrin Heinz (Hg.): Zeichen/ Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, Bielefeld: transcript 2019, S. 131–146.
Vollständige Liste unter: https://www.uni-bremen.de/kunst/personen/prof-dr-irene-nierhaus/
ProjekteWohnen als politische und ästhetische Gestaltung von Leben. Zu sozialen, kulturellen und medialen Positionen des Bewohnens als dem umfangreichsten gesellschaftlichen Raumhandlungsgefüge (AT)
Buchprojekt, das Wohnen als konzeptives Feld von Beziehungen und Diskursen zwischen Räumlichkeiten, Visuellem, Subjektivierungen und Vergemeinschaftungen untersucht. Gegenstand ist das medial produzierte Wohnwissen und seine Un/Sichtbarkeitsstrategien und Darstellungsmodi – sowohl als affirmative wie widerständige Prozesse – in Theorie, Medien, Kunst und Literatur.
-

Prof. Dr. Elena Zanichelli
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)Prof. Dr. Elena Zanichelli
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)
Juniorprofessorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie (bis Sept. 23)
Professorin für Kunstgeschichte des Moderne und Gegenwart am Kunstgeschichtlichen Institut der Philipps-Universität Marburg Forschungsschwerpunkte
ForschungsschwerpunkteSie untersucht die Wechselwirkungen zwischen (zeitgenössischer) Kunst, Feminismus, Massenmedien, dem ‚Privaten’ und der Konsumgesellschaft.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Privat. Bitte eintreten! Rhetoriken des Privaten in der Kunst der 1990er Jahre, Bielefeld: transcript 2015.
Herausgaben
wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, special issue, Februar 2022, hg. zusammen mit Valeria Schulte-Fischedick, https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1620/1622
Women in Fluxus and Other Experimental Tales. Eventi, Partiture, Performance, Publikation zur gleichnamigen Ausstellung, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Mailand: Skira 2012, 2 Bände, Bd. 1: Saggi, Bd. 2: Antologia (Herausgeberin und Autorin).
Aufsätze
Die Wand als Störgröße: Monica Bonvicini, in: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting, Ausst.-Kat., Kunsthaus Graz, Austria: Monica Bonvicini: I Don’t Like You Very Much’, 22 Apr – 21 Aug 2022, sowie Kunst Museum Winterthur, Switzerland: ‘Monica Bonvicini: Hurricanes and Other Catastrophes’, 10 Sep–13 Nov 2022, Köln: Walther Koenig 2023.
Zwischen Baby- und Beischlaf. Der dissonante Charme des Häuslichen in Deana Lawsons afroamerikanischen Familienporträts, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
Einleitung// Ein feministisches Glossar, oder Getting the #FEMINISM you Deserve; Introduction// A feminist glossary, or: Getting the #FEMINISM you deserve, in: wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, hg. von Elena Zanichelli, Valeria Schulte-Fischedick, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, Februar 2022, S. 8–19, S. 20–30 (d/engl).
(d) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1578/1579
(e) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1579/1580Zur Rhetorik in der Kunst der Postmoderne, gemeinsam mit Manuela Schöpp, in: Wolfgang Brassat (Hg.): Rhetorik in den bildenden Künsten, Handbuch in der Reihe Handbücher zur Rhetorik, Berlin: De Gruyter 2017, S. 757–777.
Repräsentationen des Privaten, in: Hubertus Butin (Hg.): Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln: snoeck Verlag 2014, S. 311–314.
ProjekteFamily Values – zur visuellen Re-Artikulation eines konfliktbeladenen Modells
Forschungsprojekt über den künstlerischen und (massen-)medialen Wandel von Familienbildern seit der Moderne, nimmt die gegenwärtige Wandlung von „Kern-“ bzw. „Normal-“ zu „Weltfamilien“ (Beck-Gernsheim 2011) zum Anlass, visuelle (Re-)artikulationen westlicher Familienrepräsentationen in Kunst und Medien vergleichend zu analysieren Ausgangspunkt ihrer Analysen ist die Transformation der Institution Familie, die als traditioneller „Hort von Ruhe, Liebe und Geborgenheit“ (Beate Rössler) seit dem 19. Jahrhundert sozialwissenschaftlich und anthropologisch für den Raum des Privaten steht. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie sich westliche Familienmodelle im Zeitalter der postfamiliären Familie künstlerisch artikulieren lassen, sondern auch, wie die Kunst ihr eigenes Familienmodell – als Gegenerzählung – imaginiert oder aber kritisch verklärt, etwa im Kontext dekolonialer Ästhetik. Die Behauptung einer aktuellen Re-Artikulation von Familienbildern entspringt der an Cultural und Visual Studies orientierten Frage, wie dominante Codes visuell erkennbar werden, also ganz im Sinne Stuart Halls: Wer repräsentiert wie wen, und weshalb?Formlosigkeit... mit Folgen. Exzentrische Abstraktion, Anti-Form, Post-Minimalismus, Informe und ihre Relektüren
Leitung der gleichnamigen Tagungssektion auf dem XXXVI.
Kunsthistorikertag in Stuttgart, Universität Stuttgart (Konzept: Valeria Schulte-Fischedick), 25. März 2022MitgliedschaftenKuratorium, Kulturstiftung der Länder, seit 2020
Neues Sammeln, Kulturstiftung der Länder, Jurymitglied 04/2022
Heinrich-Böll-Stiftung, Alumna, seit 2006
Zeitschrift für Kunstgeschichte, Beiratsmitglied seit 11/2020
Vorträge(Auswahl)
All together now? Family images in postfamilial times
Online-Vortrag im Rahmen der Konferenz Hitting Home: Representations of the Domestic Milieu in Feminist Art, Panel Challenging Normative Constructs of the Nuclear Family, South African Art and Visual Culture, University of Johannesburg, 15. November 2022.Ich und Du und Wir (und Alle anderen auch): Zu Barbara Krugers appellativen Sprachfunktionen
Vortrag im Rahmen der Abendveranstaltung Privat – bitte eintreten – zu Barbara Krugers Ausstellung „Bitte lachen / Please cry“, Neue Nationalgalerie Berlin, 03. August 2022.Family Values: On The Visual Re-Articulation of a Conflicting Model
Vortrag im Rahmen der German Studies Lecture Series, Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages, School of Humanities and Sciences, 17. Mai 2022.Einleitung
Online-Vortrag im Rahmen der 6. Forschungswerkstatt der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen, RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, zusammen mit Dr. Kathrin Heinz, 4. Februar 2022.Mamma mia! On the visual (re-)articulation of motherhood in contemporary art and culture
Vortrag im Rahmen der Tagung Diverse Families: Parenthood and Family/s beyond Heteronormativity and Binary Gender, Panel 3: „Family Images: Visual (re-)negotiations of gender and parenthood, Humboldt-Universität zu Berlin, Senatssaal, 07. Oktober 2021.Chair, Online-Konferenz Seeing the ‘Other’? Theories & Histories of (Post-)Colonial Visual Culture, Panel „Theories and Methodologies”
Virtual Conference, German
Maritime Museum Bremerhaven, in Cooperation with the Institute for Postcolonial Literary and Cultural Studies, the Institute for Anthropology and Cultural Studies and the Institute for Art History / Film Studies / Art Education at the University of Bremen, 8. April 2021.LehrveranstaltungenTheorien der Gegenwartskunst
Seminar u. a. zur Sorge- und Regenerationsarbeit und zum Themenbereich Autofiktion im Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Universiät Bremenwie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen
Seminar im Bachelor Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Universität BremenBild – Raum – Subjekt
Forschungskolloquium für Kunstwissenschaft und Visuelle Kultur, Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Promotionskolloquium Kunstwissenschaft, Universität Bremen
-

Amelie Ochs
Wissenschaftliche MitarbeiterinAmelie Ochs
Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kooperation Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender

Amelie Ochs studierte Kunst- und Bildgeschichte, Geschichte und Humanities in Berlin, Paris und Dresden. Sie ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen in Kooperation mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender. Hier ist sie Mitglied der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen sowie des internationalen Forscher_innennetzwerks [wohn]zeitschriften. Außerdem ist sie Redaktionsmitglied der ArtHist-Mailinglist. In ihrer Dissertation untersucht sie den Zusammenhang von Zeigestrategien und Bildkonsum in Bezug auf Stillleben und Sachfotografien am Beginn des 20. Jahrhunderts.
ForschungsschwerpunkteKunst-, Design- und Architekturgeschichte und -theorie der Moderne in Wechselwirkung mit Politik und Gesellschaft
Wohnen und Klasse
Geschichte des Deutschen Werkbundes
Geschichte der Sachfotografie
Publikationen(Auswahl)
Herausgaben
Wohnen mit Klasse, hg. gemeinsam mit Rosanna Umbach, kritische berichte, 2, 2025.
Aufsätze
Le catalogue de l’exposition Film und Foto (Stuttgart, 1929) dans l’histoire de la modernité photographique, in: Mica Gherghescu, Marie Gispert, Hélène Trespeuch (Hg.): L’exposition à l’ouvrage. Histoire, formes et enjeux du catalogue d’exposition, HiCSA editions [Website] 2025, https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/collection-histoire-lart-contemporain#Catalogues.
Von fliegenden Untertassen und anderen Alpträumen des bürgerlichen Wohnens. Über Anna und Bernhard Blumes Fotoserien der 1970er und 80er Jahre, in: Hannah Steurer, Joachim Rees (Hg.): Dinge träumen. Dingwelten und Traumkulturen in interdisziplinärer Perspektive, Paderborn 2024, S. 361–384.
Kunst und Dekoration: Über die Verortung und Imagination von Stillleben in der Wohnungseinrichtung um 1914, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), Bielefeld 2023, S. 143–163.
gemeinsam mit Ana Lena Werner: Visible Speechlessness. A critical approach to image acts of lip-sewing, in: Stephanie Hartle, Darcy White (Hg.): Visual Activism in the 21st Century Art, Protest and Resistance in an Uncertain World, London: Bloomsbury 2022, 141–158.
Vom Paradigma der Guten Form. Deutsch-deutsche Geschmackserziehung und Kontinuitätskonstruktion(en), in: Artium Quaestiones, 32, 2021, S. 67–88.
Consuming Class. Imagining Upper-Middle Classness through Photography in Vanity Fair, in: View. Theories and Practices of Visual Culture, 31, 2021: Visuality of Social Classes: Histories and Actions, hg. von Magda Szcześniak, Krzysztof Świrek, https://www.pismowidok.org/en/archive/2021/31-visuality-of-social-classes/consuming-class
Einrichtung einer guten Gegenwart. Zeigestrategie und Ordnungsbehauptung im Bilderbuch des Deutschen Werkbundes für junge Leute (1958), in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/–ausstellen, Bd. 8), S. 204–227.
gemeinsam mit Rosanna Umbach: Wohnseiten. The interior(s) of home journals, in: SEQUITUR, Vol. 7/1, 2021: Interiors, hg. von İkbal Dursunoğlu, http://www.bu.edu/sequitur/2021/01/11/wohnseiten-the-interiors-of-home-journals/
Vergesellschaftung, in: Marion Lauschke, Pablo Schneider (Hg.): 23 Manifeste zu Bildakt und Verkörperung (Image Word Action, Bd. 1), Berlin/Boston: De Gruyter 2017, S. 173–181.
Rezensionen
Rezension von: Stephanie Marchal, Kathrin Rottmann (Hg.): „Ästhetik und Arbeiterschaft“. Lu Märten. Entwurf der kritischen Konsumentin, München: edition metzel 2023, in: sehepunkte, 24/9, 2024 [15.09.2024], https://www.sehepunkte.de/2024/09/38897.html
ProjekteSkizze des Dissertationsprojekts
Sachfotografien und Schaufenster haben eine handlungsanleitende Funktion in der Konsumkultur. Sie sind öffentlich, im Stadtraum oder in Massenmedien (heute auch im Internet), präsent und damit einem breiten Publikum zugänglich. Mit ihnen hat sich der Konsum, beispielsweise von Alltagsgegenständen, am Beginn des 20. Jahrhunderts als bildgeleitete Praxis etabliert. Dass der Deutsche Werkbund dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist eine zentrale Annahme dieses Dissertationsprojektes. In den 1910er und 20er Jahren wurden in seinem erweiterten Umfeld beide Formate in Bezugnahme auf das künstlerische, d.h. das gemalte, Stillleben gestaltet. Im Fokus auf die „kunstmäßige“ Gestaltung dieser Bild-Raum-Gefüge und den „Warencharakter“ des Bildes werden ausgewählte Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum kunsthistorisch analysiert, wobei formanalytische Ansätze im Vordergrund stehen (Wölfflin, Riegl). Daran anschließend lassen sich Diskussionen um den Formbegriff im Umfeld des Werkbundes, der zwischen Kunst, Natur und Technik verhandelt wird, nachzeichnen. Anschlussfähig sind außerdem zeitgenössische kulturtheoretische Ansätze (Simmel, Kracauer, Benjamin), die ästhetisch fundierte Subjekt-Objekt-Wechselbeziehungen diskutieren (Individualisierung, Versachlichung, Habitusentwicklung). Darüber hinaus lässt sich zugleich eine Art Gattungsgeschichte des Bildkonsums (die sich bis in die heutige Gegenwart fortsetzen lässt) beschreiben: vom Stillleben zum Display. Insofern versteht sich dieses Vorhaben auch als historisch-kritischer Beitrag zu einer aktuellen kunstwissenschaftlichen Debatte über die display-geleitete Interaktion mit Bildern.
Wohnen mit Klasse (gemeinsam mit Rosanna Umbach)
MitgliedschaftenForschungsgruppe wohnen+/–ausstellen
Internationales Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften
ArtHist.net (Listenredaktion)
Ulmer Verein – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.
Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V.
Vorträge(Auswahl)
Conceptualizing Photography Through the Lens of Art History: The Catalog of the Stuttgart Film und Foto Exhibition 1929
Vortrag im Rahmen der internationalen Tagung L'exposition à l'ouvrage. Histoire, formes et enjeux du catalogue d'exposition, INHA/Centre Pompidou, Paris, 11. Mai bis 13. Oktober 2023.Wohn(vor)bilder und Technikdiskurse. Wohnzeitschriften und serielle Medien als Quellen zur Einrichtung mit technischem Gerät
Vortrag im Rahmen des Workshops Computer einrichten / Wohnen ausstellen. Quellen zum Wohnen mit dem Computer am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn, 15. Dezember 2022, gemeinsam mit Rosanna Umbach.Von fliegenden Untertassen und anderen Albträumen des bürgerlichen Wohnens. Über Anna und Bernhard Blumes Fotoserien der 1970er und 80er Jahre
Vortrag im Rahmen der internationalen Tagung des DFG-Graduiertenkollegs "Europäische Traumkulturen": Dinge träumen. Dingwelten und Traumkulturen in interdisziplinärer Perspektive, Universität des Saarlandes, 10.–12. Oktober 2022.Ein-Richten und An-Ordnen: Medialisierung eines rationalisierten Wohnens im Display der Zeitschrift
Vortrag im Rahmen des Study Day Inne(n)Wohnen. Das Interieur als Medium, Seminar für Kunst und Kunstwissenschaft der Technischen Universität Dortmund / Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), 21.–22. April 2022, gemeinsam mit Rosanna Umbach.Stillleben der Konsumkultur. Kunsthistorische Beobachtungen zur Sachfotografie am Beginn des 20. Jahrhunderts
Vortrag im Rahmen der Forschungswerkstatt RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender / Universität Bremen, 4. Februar 2022.Domestische Ding-Bilder. Über das Stillleben als Einrichtungsgegenstand im 20. Jahrhundert
Vortrag im Kontext der internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur der Moderne, Universität Bremen, 18.–20. Juni 2021.Eine Gute Gegenwart für die bundesdeutsche Jugend. Bildpolitik und Formpädagogik des Deutschen Werkbundes in den 1950er Jahren
Online-Vortrag im Rahmen der Veranstaltung Vom Verbergen und Zeigen, Studientag 2020, Draiflessen Collection, Mettingen, 4. Dezember 2020.Lehrveranstaltungen(Auswahl)
Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur
Vorlesung im Rahmen der Reihe DNA des Wohnens im Modul Wohnbau, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, gemeinsam mit Rosanna UmbachWohnen mit Klasse
Projektseminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe2022/23–SoSe 2023, gemeinsam mit Rosanna Umbach, Kooperation mit dem Projekt SPRint des Instituts für Schreibwissenschaft -

Dr. Rosanna Umbach
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Postdoc (seit 2023)Dr. Rosanna Umbach
Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik auf der Kooperationsstelle mit dem MSI
Ehemalige Mariann-Steegmann-Stipendiatin
Rosanna Umbach ist Kunstwissenschaftlerin und forscht zum Verhältnis von Wohnen, Klasse und Gender in Kunst, Architektur und Gesellschaft. Als Mariann-Steegmann-Stipendiatin hat sie zu visuellen Politiken des Familialen in der Zeitschrift Schöner Wohnen (1960–1979) promoviert. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an der Universität Bremen auf der Kooperationsstelle mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und lehrt an verschiedenen internationalen Universitäten und Hochschulen. Gemeinsam mit Amelie Ochs arbeitet sie im Projekt Wohnen mit Klasse. Seit 2022 ist sie Redakteurin bei der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.
ForschungsschwerpunkteIhre Forschungsschwerpunkte sind queer_feministische Kunst/Wissenschaft und Architektur/Theorie, Familienbilder im historischen Wandel, Klassenverhältnisse in Kunst und Popkultur, Wohn- und Stadtraumpolitiken, visuelle Diskurse von Sexualität_en, Arbeit und Körper, (Wohn-)Zeitschriften und Bild-Text-Verhältnisse sowie feministische Kunst und (Weltraum-)Design der 1960er und 1970er Jahre. Gemeinsam mit Amelie Ochs forscht sie zu den Interdependenzen von Wohnen und Klasse/Klassismus.
In ihrem Habilitationsprojekt untersucht sie Erotische InExterieurs und das Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Un/Gewohnte Beziehungsweisen. Visuelle Politiken des Familialen in der Zeitschrift »Schöner Wohnen«, 1960–1979, transcript: Bielefeld 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 11).
Herausgaben
Wohnen mit Klasse, kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, 2.2025, hg. gemeinsam mit Amelie Ochs.
WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Artikel
Wohnen im Display: Von Haushaltscomputern und Home Office. Visuelle Verhältnisse von Hausarbeit & Technik in der Schöner Wohnen (1960–1979), in: Christina Bartz et al. (Hg.): ComputerWohnen. Zur Geschichte des Computers in Wohnumgebungen zwischen Arbeit und Assistenz, Bielefeld: transcript, im Erscheinen (Frühjahr 2026).
Queering Futures – Architektur zwischen Geschlechter(un)ordnung und Utopie, Text für die Ausstellung Welten Bauen. Visionäre Architektur im 20. Jahrhundert (16.11.2024—09.03.2025), Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA), Dresden.
Junggesellen auf der Jagd – Kolonial- und Sexualpolitik im Display des Wohnens, in: Silke Förschler, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.): Trophäen. Inszenierungen der Jagd in Wohn- und Ausstellungsräumen, Bielefeld: transcript 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 12), S. 258–277.
Ästhetische An/Ordnungen – Die Zeitschrift als Archiv eines Wohnwissens, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), S. 270–298.
Zum Buch, gemeinsam mit Amelie Ochs, Kathrin Heinz und Irene Nierhaus, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8), S. 83–99.
„Mehr Demokratie ins Wohnzimmer!“ – Die Umnordnung der Wohnverhältnisse im Schöner-Wohnen-Magazin der 1960er und 1970er Jahre, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8), S. 230–259.
Göttinnen im Bildsraum. Der Safe Space als künstlerisches Aushandlungsfeld in den Arbeiten von Judith Kisner, Katalogtext zur Ausstellung Judith Kisner: Oh my Goddess Verdandi (24.7–8.8.2021), Wasserburg Sachsenhagen.
Wohnseiten. The interior(s) of home journals, gemeinsam mit Amelie Ochs, in: Sequitur, Issue 7.1 Interiors, 01/2021, http://www.bu.edu/sequitur.
Sophia Lökenhoff Op. {{ I’m looking for the face I had before this world was made }} 001, gemeinsam mit Kristina Schmidt, Begleitheft zur Ausstellung I'm Not Always Where My Body Is (25.09–18.10.2020) der Meisterschüler_innen HBK Braunschweig, Kunstverein Braunschweig.
Mutter_schafft. Von un/sichtbarer Hausarbeit im Schöner Wohnen Magazin der 1970er Jahre, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und Visuelle Kultur, H. 64, 2018, S. 44–57.
Rezensionen
Rezension zu: Bernadette Krejs: Instagram Wohnen – Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen Wohnbildwelten, transcript: Bielefeld 2023, Arch+, 31.07.2024, https://archplus.net/de/bernadette-krejs-instagram-wohnen-architektur/
ProjekteErotische InExterieurs – Zum Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht in Kunst und Architektur (Post-Doc Projekt)
Architektur, Wohnraum und Interieur erscheinen als ein zentrales Diskursnetzwerk, das unsere Vorstellungen von Begehren und Geschlechterverhältnissen maßgeblich prägt. Entlang einer Topografie der Intimität werden die Wohnung, das Schlafzimmer, das Bett historisch zu intimisierten Räumen, privatisierten Orten und Wohn-Dingen einer (Hetero-)Sexualität stilisiert, die monogam-romantisch strukturiert und in den (staatlichen) Dienst der Reproduktion gestellt wird. Künstler*innen thematisieren das Häusliche als eine von (vergeschlechtlichten) Differenzlinien und Herrschaftsformationen durchzogene Sphäre. Anknüpfend an eine Analyse dieser (historisch) virulenten Sexualpolitiken und Geschlechterverhältnisse im (Innen-)Raum wird im Forschungsprojekt anhand von (queerfeministischen) Positionen aus Kunst und Architektur eine widerständige Perspektivierung von kanonischen und vernaturalisierten Erzählungen zum Verhältnis von Sexualität, Raum und Geschlecht vorgenommen.
Wohnen ist zwar unmittelbar verschaltet mit Sexualitätsdiskursen, eine strukturelle Analyse dieses Wechselverhältnisses bleibt bisher jedoch aus. Ausgehend von diesem Desiderat sollen Raumstrukturen der Intimität herausgearbeitet und über ihre künstlerische Verhandlung befragt werden. In welchem Verhältnis stehen dabei Wohn- und Stadtraum in ihrem scheinbar antagonistischen Verhältnis von Privatheit/Öffentlichkeit, das ebenfalls unser Denken über Intimität und Begehren strukturiert? Eine kritische Ortsbestimmung, die beide Sphären als diskursiv verwoben zusammendenkt, findet sich entsprechend im Titel mit dem Begriff der erotischen In- und Exterieurs. Wie werden hier Raumgrenzen der Intimität porös und fransen in den Stadtraum aus? Wie verhandeln künstlerische Arbeiten diese und andere Zwischenräume? Welche Raumstrukturen begegnen uns überhaupt in zeitgenössischen künstlerischen Arbeiten in Hinblick auf Sexualität und Architektur? Welche Rolle spielen dabei Verweissysteme auf Bildprogramme des bürgerlichen Interieurs mit seiner binären Geschlechtermatrix sowie die Architekturmoderne und den darin kanonisierten Koordinaten von Männlichkeit und Macht? Welche historischen Raumkonfigurationen haben Sexualität reguliert und ermöglicht? Wie beeinflussen Digitalisierungsprozesse das Verhältnis von Raum, Körper und Sexualität und welche (virtuellen) Räume eröffnen künstlerische Positionen im Diskursfeld, insbesondere im Erfahrungsrahmen der pandemischen Isolation. Wie wird hier das Zuhause zum Schauplatz für erotische Inszenierung und Beziehungsfragen?
Wohnen mit Klasse (gemeinsam mit Amelie Ochs)
MitgliedschaftenForschungsgruppe wohnen+/–ausstellen
Internationales Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften
AG Erste Generation Kunstgeschichte des Ulmer Vereins
Ulmer Verein – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Redaktion
Vorträge (Auswahl)Interieurs der Ungleichheit – Wohnungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur
Vortrag im Rahmen des Workshops Klasse anerkennen. Sozialer Status, Habitus und Klassismus in Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft (18.–20.09.2025), Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln, 19.09.2025.Playboy paradise and bachelor pad - Gendered interiors in West German singles' housing
Vortrag im Rahmen des Online Research Seminars Housing for Single People: Narratives, New Perspectives, and Methodological Challenges in Kooperation der KU Leuven, UGent und Politenico di Milano, 21.03.2025.Queering Architecture - gebaute Visionen und gelebte Praxen
Vortrag im Rahmen der Ausstellung Welten Bauen. Visionäre Architektur im 20. Jahrhundert (16.11.2024—09.03.2025), Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA), Dresden, 19.01.2025.Dwelling With Class – Building Structures of Classism in Architecture
Vortrag im Rahmen der Reihe Housing and… des Center for Critical Studies in Architecture, Frankfurt/Main, 06.11.2024.Zwischen Emanzipation und Einweckgläsern. Küchenpolitiken in Kunst, Medien und Architektur
Vortrag im Rahmen des Werkbund Foyer #2 Parasite Kitchen in Kooperation mit der Hochschule Mannheim und dem KIT Karlsruhe, Kunsthalle Mannheim, 03.07.2024.Zwischen Kollektiv und Küche: Rezeptionsgeschichte(n) und queer_feministische Raumpraxen
Vortrag auf der Tagung Why have there been no great women architects? (14.–15.6.2024), Technische Universität Wien/Architekturzentrum Wien, 15.06.2024.(Ar)Mut in Bremen
Teilnahme an der Talkrunde, belladonna e.V in Kooperation mit dem Bremer Rat für Integration und verschiedenen Stadtteilorganisationen, 10.03.2024.Fierce: A Porn Revolution (CH 2022)
Einführung zur Dokumentation mit anschließendem Filmgespräch, City 46 Bremen, 12.12.2023.Un/sichtbare Klassenverhältnisse in (Vor-)Bildern des Wohnens
Vortrag im Rahmen der Summer School Kunstgeschichte x Klassismus (25.–28.9. 2023), Universität zu Köln, 26.09.2023, gemeinsam mit Amelie Ochs.Mobile Subjekte: Verrückte Möbel: Bewegliche Beziehungen. Zum Verhältnis von Mobilität und Moderne in der Schöner Wohnen (1960-1979)
Vortrag auf dem Workshop Maisons mobiles / Zu Hause Unterwegs / Mobile Houses (29.–30.06.2023), Sorbonne Nouvelle und Accademia di Architettura Mendrisio (Università della Svizzera italiana), Paris, 30.06.2023.Wohnen im Display: Von Haushaltscomputern und Home Office in der Schöner Wohnen (1960-1979)
Vortrag auf der Tagung ComputerWohnen. Umgebungen zwischen Arbeit, Assistenz und
Komfort (20.–21.04.2023), Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn, 20.04.2023.Wohn(vor)bilder und Technikdiskurse. Wohnzeitschriften und serielle Medien als Quellen zur Einrichtung mit technischem Gerät
Vortrag im Rahmen des Workshops Computer einrichten / Wohnen ausstellen. Quellen zum Wohnen mit dem Computer, Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn, 15.12.2022, gemeinsamer mit Amelie Ochs.Ein-Richten und An-Ordnen: Medialisierung eines rationalisierten Wohnens im
Display der Zeitschrift
Vortrag im Rahmen des Study Day Inne(n)Wohnen. Das Interieur als Medium (21.–22.04.2022), Kulturwissenschaftliches Institut Essen, 21.04.2022, gemeinsam mit Amelie Ochs.Queer_feminist Museums Talk
Podiumsdiskussion gemeinsam mit Anka Bolduan, Judith Kluthe, Eugenia Kriwoscheja und Lisa Spanka im Rahmen der Tagung Gender im Museum – aktuelle feministische
Interventionen des Bremer Frauenmuseums, Kukoon am Wall, Bremen, 25.09.2021.Utopie und Leiden_Schaft
Vortrag im Kontext der digitalen Vortragsreihe Critical Futures an der Hochschule für Künste Bremen, 10.02.2020, gemeinsam mit Franziska Bauer.Gewohnte Geschlechterdifferenz
Vortrag im Wintersemesterprogramm des autonomen feministischen Referats der
Universität Oldenburg, 15.01.2020, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel.Un/Gewohnte Beziehungsweisen – Visuelle Politiken des Familialen im Schöner Wohnen Magazin der 1960er und 1970er Jahre
Vortrag auf der Tagung Elternschaft und Gender Trouble. Mütter, Väter, Eltern
(21.–23.06.2019), Philipps-Universität Marburg, 21.06.2019.Repräsentationen und Inszenierungen von Weiblichkeit in der Kunst
Gespräch mit Helena Dornieden im Format Perspektivwechsel zur Ausstellung Pauline
Curnier: Jardin– Fat to Ashes (13.04–19.09.2021) im Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart, Berlin, 05.08.2021.Neujahrsgespräche – Frauen in der Wissenschaft
Teilnahme am Panel zum Thema Lehre und Forschung im Kontext des Mentoring-
Programms Fem4Scholar, Universität Oldenburg, 26.02.2019.Körper im Quadrat – Un/Sichtbare Haus_Arbeit und die Architektur der Bewegung im Schöner Wohnen-Magazin
Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hidden Lines of Space, Hamburg, 14.09.2018, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel.Feminismus und Aktivismus
Workshop im Rahmen des internationalen Projekts Tackling discrimination! Europa
gemeinsam gestalten, Bildungsstätte Bredbeck, 11.10.2017, gemeinsam mit Franziska Bauer.Vorlesungen
LehrveranstaltungenVorlesungen
Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur
Vorlesung im Rahmen der Reihe DNA des Wohnens im Modul Wohnbau, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, seit WiSe 2023/24 gemeinsam mit Amelie Ochs.Kunstgeschichte in der Perspektive des 21. Jahrhunderts
Vorlesung an der Fakultät für Gestaltung, Hochschule Mannheim, SoSe 2023 – SoSe 2025.Seminare (Auswahl)
Klassenbilder - Ästhetische Politiken von Klasse und Geschlecht in Kunst und visueller Kultur
Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen SoSe 2025.Queering Architecture – Gebaute Utopien und gelebte Praxen
Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe 2024/25.Von Küchensprengungen und Künstler_innenforschung – queer_feministische Kunst/Wissenschaft
Seminar im BA/M.Ed. Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe2024.Homestorys – (Wohn-)Zeitschriften als Klassendisplays
Seminar im Leuphana Semester, Modul Wissenschaft problematisiert: kritisches Denken, Leuphana Universität Lüneburg, WiSe 2023/24.Salon [q] – Kunst:Raum:Gender. Queer_feministischer (Bild-)Lektürekreis
Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe 2023/24.Erotische Interieurs – Visuelle Verhältnisse von Raum, Körper und Sexualität in Kunst und Architektur
Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe 2023.Wohnen mit Klasse
Projektseminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe2022/23–SoSe 2023, gemeinsam mit Amelie Ochs, Kooperation mit dem Projekt SPRint des Instituts für Schreibwissenschaft.Wohn/Raum/Politiken – Architektonische Aufbrüche, künstlerische Interventionen, widerständige Praxen
Seminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, SoSe 2022.BILD_RAUM_KÖRPER – Positionierungen und Repräsentationen von Körper und Raum in künstlerischen und medialen Darstellungen
Proseminar für das Fach Bildende Kunst, Institut für Kunstwissenschaft und Ästhetik, Universität der Künste Berlin, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel, WiSe 2018/19.GeWOHNTE Geschlechterdifferenz – Visuelle Politiken von Wohnen und Gender
Proseminar für das Fach Bildende Kunst, Institut für Kunstwissenschaft und Ästhetik, Universität der Künste Berlin, gemeinsam mit Anna-Katharina Riedel, SoSe 2018. -

Vanessa Faatz
Studentische MitarbeiterinVanessa Faatz

M.A. Kunst- und Filmwissenschaft
-

Lisa Gronau
Studentische MitarbeiterinLisa Gronau

-

Friederike von Westernhagen
Studentische MitarbeiterinFriederike von Westernhagen

B.A. Kunst-Medien-Ästhetische Bildung, Universität Bremen
M.A. Kunst- und Filmwissenschaft, Universität Bremen
-

Ricarda Kaps
Studentische MitarbeiterinRicarda Kaps

-

Alana Wilhelm
Studentische MitarbeiterinAlana Wilhelm

M.A. Kunst- und Filmwissenschaft
-

Dr. Susanne Huber
Dr. Susanne Huber
Researcher am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik
 Forschungsschwerpunkte
ForschungsschwerpunkteAktuelle Forschungsperspektiven umfassen kunstwissenschaftliche und kulturhistorische Phänomene fetischistischer Besetzungen und Fetisch als koloniales Konzept, Körperdiskurse in visuellen Kontexten seit der Moderne sowie fotografische Stillleben um die Jahrhundertwende.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Vom Konsum des Begehrens. Appropriation Art, Sex Wars und ein postmoderner Bilderstreit, Berlin: De Gruyter 2022.
Herausgaben
membra(I)nes. Technologien, Theorien und Ästhetiken von Un/Durchlässigkeit. Special Issue im Open Gender Journal, hg. gemeinsam mit Muriel Gonzáles-Athenas, Katrin Köppert, Friederike Nastold (Herbst 2025).
Ambivalent Work*s. Queer Perspectives and Art History, hg. gemeinsam mit Daniel Berndt und Christian Liclair, Zürich: Diaphanes 2024.
Texte zur Kunst Gastredaktion: „Lust“, Heft Nr. 123.
Co-Herausgeberin der internationalen Buchreihe Oyster. Feminist and Queer Approaches to Arts, Cultures, and Genders, hg. gemeinsam mit Änne Söll und Hongwei Bao, Berlin: De Gruyter, seit 2023.
Aufsätze
Radical Transformations or Well-balanced Transgression? Beginnings and Prospects of a Queer Art History, gemeinsam mit Daniel Berndt, in: Ambivalent Work*s. Queer Perspectives and Art History, hg. gemeinsam mit Daniel Berndt und Christian Liclair, Zürich: Diaphanes 2024, S. 19–56.
Lust, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 30, Nr. 1 (Was uns ausgeht), hg. v. Maja Figge et al., S. 79–81.
Eat a Dick oder die Buchstäblichkeit von Pornografie, in: Colophon. Magazin für Kunst und Wissenschaft, Nr. 6 (Porno), S. 36–39.
Masculinity as a Joke: Gender Below the Binary in Catherine Opie’s Being and Having, in: Katharina Boje, Änne Söll, Maike Wagner (Hg.): Under Construction: Kunst, Männlichkeiten und Queerness seit 1970, Berlin: De Gruyter 2024.
Pleasure in/as Fetish. Excessive Overestimation and Erotic Charge, in: Texte zur Kunst, Heft Nr. 123, S. 170–178.
Boundary Issues: Distance and Distinction in Lutz Bacher’s “Sex with Strangers”, in: Themenheft Bleib mir vom Leib: Ethik und Ästhetik der Distanz, hg. v. Anna Degler und Jan von Brevern, 21: Inquiries into Art, History, and the Visual, Nr. 3, Bd. 4, 2023, S. 399–428.
Pushing Buttons: Que(e)rulieren als Privileg, in: Oliver Klaassen, Andrea Seier (Hg.): QUEERulieren! Praktiken des Störens in Kunst / Medien / Wissenschaft, Berlin: Neofelis 2023.
«A desire to create new contexts» – Queere Ansätze in der Kunstgeschichte, gemeinsam mit Daniel Berndt, in: Kritische Berichte 1.23, 2023, S. 66–78.
Life Ain’t Easy for a Boy Named Sue. Susanne Huber on Casey Kauffmann and John de Leon Martin at Human Resources, LA, Aug 6–20, 2022, in: Texte zur Kunst, online, 16. Sept 2022.
ProjekteMitgliedschaftenAG „Queering: Visuelle Kulturen und Intermedialität“ (FG Geschlechterstudien)
AG „Migration, Rassismus und Postkolonialität“ (Gesellschaft für Medienwissenschaft)
Vorträge(Auswahl)
Tender Tensions. Violence and Vulnerability in Lutz Bacher’s Men at War
Vortrag auf der Tagung Hard Bodies: Aesthetic, Materiality, and Mediality of Masculinity in American and European Art and Visual Culture, c. 1900 – today, Goethe-Universität Frankfurt, 9.-10.01.2025.Against Nature or Establishment? Florence Henri, Ruth Bernhard and the Sensual Pleasures of Organic Formalism
Vortrag auf dem Workshop Queer Avantgarde, Ruhr-Universität Bochum, 4.-5.12.2024.Dissonanz und Transformation
Vortrag im Kritischen Kolloquium Kunstgeschichte: Queere Perspektiven in der Kunstwissenschaft , Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 30.11.2024.Von neuen sinnlichen Aneignungsformen und Exzess. Kunst und Pornografie in der Postmoderne
Vortrag an der Kunstakademie München, 20.11.2024.Bürgerlichkeit als Kink: Queere Häuslichkeit in Rosa von Praunheims „Ich bin meine eigene Frau“ (1992)
Vortrag auf dem Symposium Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Mahlsdorf/Berlin, 11.-12.07.2024.membra(I)nes. 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Geschlechterstudien
Co-Organisation, gemeinsam mit Yeşim Duman, Antke Antek Engel, Katrin Köppert, Isabel Lewis, Friederike Nastold, Lars Paschke, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und Hochschule für Gestaltung und Buchkunst Leipzig, 15.–17.06.2023.Explizit implizit. Vom Konsum des Begehrens in postmodernen Bildkulturen
Buchpräsentation mit Vortrag, GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen, 25.10.2022.Not not for sale: Pictures Generation, Sex Wars und ein postmoderner Bilderstreit
im Rahmen der Ausstellung “True Pictures“, Sprengel Museum Hannover, 02.11.2021.Queering Temporalities and Lowbrow Culture
Moderation Roundtable & Discussion im Rahmen des Workshops „Queering the Boundaries of the Art in the Sinosphere”, Universität Zürich, 29.05.2021.Workshop zur Tagung „Auftischen und Vertuschen. Praktiken des (Un)Sichtbarmachens“
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 29.10.2021.Ambivalent Work*s: Queer Perspectives and Art History
Co-Organisation des Workshops gemeinsam mit Daniel Berndt, Christian Liclair und Fiona McGovern, Universität Zürich, 04.–05.12.2020.Wie lassen sich Fragen in Bezug auf Begehren formulieren? Überblick und Einblick
Vortrag gemeinsam mit Christian Liclair im Rahmen von „Lernort Begehren. 50 Jahre neue Gesellschaft“, ngbk Berlin, 03.08.2019.LehrveranstaltungenQueer Interior. Gegenhegemoniale Heimstätten in künstlerischen Entwürfen seit den 1970er Jahren
Seminar im MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen. -

Prof. Dr. Insa Härtel
Prof. Dr. Insa Härtel

Insa Härtel, Prof. Dr. phil. habil., ist als Kulturwissenschaftlerin Permanent Senior Research Fellow an der Kunstuniversität Linz, Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften | Abteilung Kulturwissenschaft sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Hamburg und Schleswig-Holstein.
Weitere Informationen: https://insahaertel.de/
ForschungsschwerpunkteForschungsschwerpunkte sind Sexualitäts- und Geschlechterforschung sowie psychoanalytische Kunst- und Kulturtheorie.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
B – Blickfänger (zu Gerhard Richter, Betty, 1977), gemeinsam mit Karl-Josef Pazzini (in der Reihe: Kleiner Stimmungs-Atlas in Einzelbänden), Hamburg: Textem Verlag 2017.
Kinder der Erregung. »Übergriffe« und »Objekte« in kulturellen Konstellationen kindlich-jugendlicher Sexualität, unter Mitarbeit von Sonja Witte, Bielefeld: transcript 2014.
Symbolische Ordnungen umschreiben. Autorität, Autorschaft und Handlungsmacht, Bielefeld: transcript 2009 (Habilitationsschrift).
Zur Produktion des Mütterlichen (in) der Architektur (Publikation der Dissertation), Wien: Turia + Kant 1999.
Herausgaben (Auswahl)
Redaktionsmitglied: RISS. Zeitschrift für Psychoanalyse, Hamburg: textem Verlag.
Reibung und Reizung. Psychoanalyse, Kultur und deren Wissenschaft, Hamburg: textem Verlag 2021.
Podcast (Auswahl)
Konzeption und Realisierung der Season 3 Nichts Besonderes im Rahmen des Podcast Kultur denken des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien (ifk) (2024). Episoden 1–6. https://kultur-denken.podigee.io/episodes
ProjekteAktuelles Forschungs-/Buchprojekt: Ästhetik des Sexuellen (erscheint vorauss. 2026 bei transcript, i.V.)
Workshop 21.11.2025: Miniaturforschung zum Thema Asexualität, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (ifk), Wien, Konzeption und Umsetzung gemeinsam mit Ulrike Kadi.
Vorträge(Auswahl)
Am Foto hängen: Mediale ›Pervertierung‹ in Catherine Opies Self-Portrait/Nursing (2004)
Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Visuelle Bildung VIII / »Übergänge«, Universität Hamburg, Art Education, 10.7. 2025.Affekt im Vokabular des Triebs
Online-Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Gender|U - Intersektionale Perspektiven auf Gender und Gefühl, Studienprogramm Q+ der JGU Mainz / Kunsthochschule Mainz / Universität Bremen / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 28.10.2024.Ästhetik des Sexuellen, oder: Zur Kondomhaftigkeit von Sexualität
Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Relatifs, Kunstuniversität Linz/Kepler Salon, 22.11.2022.Stinkende Bilder, mobilisierte Perspektiven: Medialität des Ekels im Messie-TV
Vortrag im Rahmen von The Missing Link: Dissoziationen Assoziationen – und umgekehrt, Zürich, 7.5.2022.»Penile Stile«: Filmische Figuren der Impotenz
Vortrag im Rahmen der Lecture Series Psychoanalytische Kulturwissenschaft, Institute for Cultural Inquiry (ICI) Berlin, 22.3.2022.Nicht an Sexualität denken. Venus after School von Sally Mann (1992)
Vortrag im Rahmen der interdisziplinären Online-Vortragsreihe Ästhetisierungen von Kindheit und Jugend nach 1968, Universität Bielefeld, 09.11.2020.Sexuality as failure. Psychoanalytic concepts, cultural perspectives
Vortrag an der Princeton University, organized by the Program in Contemporary European Politics and Society and co-sponsored by the Program in European Cultural Studies and the Department of German, 13.3.2018Veranstaltungen in Kooperation mit dem MSIErogene Gefahrenzonen: Aktuelle Produktionen des (infantilen) Sexuellen (9.–10.11.2012)
Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58
Die Tagung findet im Rahmen des von Prof. Dr. Insa Härtel durchgeführten DFG-Forschungsprojekts ""Übergriffe" und "Objekte". Bilder und Diskurse kindlich-jugendlicher Sexualität" statt.
Konzeption: Insa Härtel
Kooperation / Förderung:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender
Universität Bremen
Fachbereich Kulturwissenschaften
Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften
Zentrum Gender Studies (ZGS)
BPV (Bremer Psychoanalytische Vereinigung)
Psychoanalytisches Seminar Zürich (PSZ) -

Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)
Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)

Christiane Keim war bis 2021 Lektorin am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen. Derzeit Assoziierte Wissenschaftlerin am Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und Mitglied des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen. Studium der Kunstgeschichte und Germanistik an der Philipps-Universität Marburg. 1987 Promotion an der Universität Marburg mit einer Arbeit zur Stadtbauplanung im Klassizismus. 2004 Habilitation an der TU München mit einer Arbeit zu Geschlechterverhältnissen im Wohnungsbau der 1920er Jahre. 1994–2005 Redaktionsmitglied von FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.
ForschungsschwerpunkteLehrt, schreibt und forscht zur Kunst- und Architekturgeschichte der Neuzeit (Schwerpunkt 18.–20. Jahrhundert), Wohnen, Geschlecht und Raum, und Mensch-Tier-Beziehungen in der visuellen Kultur.
Publikationen(Auswahl)
Herausgaben
Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, hg. gemeinsam mit Silke Förschler und Astrid Silvia Schönhagen, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 6).
Aufsätze
Fadenspiele. Schnittstellen und Überkreuzungslinien einer kultur- und genderwissenschaftlichen Forschung zu Akteur*innen und Aktionsfeldern des Wohnens, in: Christian von Wissel, Jörn Tore Schaper (Hg.): Architektur für Alle?! Emanzipatorische Bewegungen in Planung und Raum, Bremen Carl Ed. Schünemann 2022, S. 46–53.
Neue Wohnung – Neuer Mensch, in: Birgit Jooss, Philipp Oswalt, Daniel Tyradellis (Hg.): Bauhaus/Documenta. Vision und Marke, Leipzig: Spector Books 2019, S. 161–164.
ProjekteForschungsprojekt c/o Habitat Tier, gemeinsam mit Silke Förschler und Astrid Silvia Schönhagen.
Vorträge(Auswahl)
Charlotte Perriand auf der Corbusier-Liege. Die Neue Frau als Bildzeichen und die Designerin als Protagonistin moderner Wohngestaltung
Vortrag in der Kunststiftung Bönsch, Wolfsburg, 22.11.2022.CATviews. Eine Lektüre von David Hockneys Mr. and Mrs. Clark and Percy (1971) als interspecies Begegnung im Wohnen
Vortrag im Rahmen der Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens, Universität Bremen/Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Bremen, 19.6.2022.Zwischen Hundehütte, Galerie und Wohnraum. Vom Ausstellen tier-menschlicher Cohabitation
Vortrag gemeinsam mit Astrid Silvia Schönhagen im Kepler Salon der Universität Linz, 12.10.2021. -

Astrid Silvia Schönhagen
Astrid Silvia Schönhagen

Astrid Silvia Schönhagen, M.A., ist Kunst- und Medienwissenschaftlerin und arbeitet als freie Lektorin und Projektmanagerin im Bereich kunst- und kulturwissenschaftliches Sach- und Fachbuch. Sie ist Mitinitiatorin und -leiterin des Forschungsprojekts c/o Habitat Tier im Forschungsfeld wohnen+/–ausstellen an der Universität Bremen sowie Redaktionsmitglied von kunsttexte.de (Sektion „Ökologie(n) in der Kunst“).
ForschungsschwerpunkteIhre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die politische Ikonografie des Interieurs, die materielle Alltagskultur der Moderne (insbes. exotistische Bildtapeten um 1800), Verschränkungen von Architektur-, Mode- und Bekleidungsdiskursen in der zeitgenössischen Kunst sowie Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen.
Publikationen(Auswahl)
Herausgaben
Trophäen – Inszenierungen der Jagd in Wohn- und Ausstellungsräumen, hg. gemeinsam mit Silke Förschler, Bielefeld: transcript 2025 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 12).
Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, hg. gemeinsam mit Christiane Keim, Silke Förschler, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 6).
Interieur und Bildtapete. Narrative des Wohnens um 1800, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Bielefeld: transcript 2014 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 2).
Aufsätze
Trophäen für den Catwalk. Faux-Taxidermie-Kreationen in der Haute Couture des Maison Schiaparelli, in: Tierstudien, 28, 2025, im Erscheinen.
Queering Bulldogs. Damenimitatoren und hundlich-menschliche (Selbst-)Inszenierung im Berlin der Weimarer Republik, in: Tierstudien, 24, 2023, S. 85–97, gemeinsam mit Christiane Keim.
Napoleon in der ,guten Stube‘. Das Interieur als Medium postnapoleonischer Geschichtsrhetorik, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9), S. 212–238.
Down the Rabbit Hole… Passagen durch fantastische Tapetenwelten / Down the Rabbit Hole… Passages through the Phantasmagoric World of Scenic Wallpaper, in: Patricia Lambertus, Ausst.-Kat., Gerhard-Marcks-Haus, 25.7.–24.10.2021, Berlin: Distanz 2021, S. 57–65 (dt.) / S. 66–72 (engl.).
W e a r a b l e H o m e s. Die Verknüpfung von Bekleidungstheorie, Körperkonzepten und Wohndiskursen in Tragbaren Architekturen von den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 5), S. 239–271.
Habitate der Mobilität – Mary Mattinglys W e a r a b l e (P o r t a b l e) H o m e s für eine postapokalyptische Ära, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume in Kunst – Architektur – Visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 7), S. 271–291.
Das Interieur als Bühne. Dufours tapeziertes Südsee-Arkadien und die Verinnerlichung naturalisierter ,Geschlechtscharaktere‘ im Wohnen, in: Gerald Schröder, Christina Threuter (Hg.): Wilde Dinge in Kunst und Design. Aspekte der Alterität seit 1800, Bielefeld: transcript 2017, S. 30–59.
Azra Akšamijas W e a r a b l e M o s q u e s. Kleidung als transkulturelle Camouflage, in: kunst und kirche, 2, 2016, S. 4–11.
ProjekteForschungsprojekt c/o Habitat Tier
MitgliedschaftenForschungsfeld wohnen+/–ausstellen
Forum Jagdgeschichten
kunsttexte.de
BücherFrauen e.V.
Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren e.V. (VFLL)
VorträgeLehraufträge -

Prof. Dr. Elena Zanichelli
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)Prof. Dr. Elena Zanichelli
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (2021-2023)
Juniorprofessorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie (bis Sept. 23)
Professorin für Kunstgeschichte des Moderne und Gegenwart am Kunstgeschichtlichen Institut der Philipps-Universität Marburg Forschungsschwerpunkte
ForschungsschwerpunkteSie untersucht die Wechselwirkungen zwischen (zeitgenössischer) Kunst, Feminismus, Massenmedien, dem ‚Privaten’ und der Konsumgesellschaft.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Privat. Bitte eintreten! Rhetoriken des Privaten in der Kunst der 1990er Jahre, Bielefeld: transcript 2015.
Herausgaben
wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, special issue, Februar 2022, hg. zusammen mit Valeria Schulte-Fischedick, https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1620/1622
Women in Fluxus and Other Experimental Tales. Eventi, Partiture, Performance, Publikation zur gleichnamigen Ausstellung, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Mailand: Skira 2012, 2 Bände, Bd. 1: Saggi, Bd. 2: Antologia (Herausgeberin und Autorin).
Aufsätze
Die Wand als Störgröße: Monica Bonvicini, in: Monica Bonvicini. As Walls Keep Shifting, Ausst.-Kat., Kunsthaus Graz, Austria: Monica Bonvicini: I Don’t Like You Very Much’, 22 Apr – 21 Aug 2022, sowie Kunst Museum Winterthur, Switzerland: ‘Monica Bonvicini: Hurricanes and Other Catastrophes’, 10 Sep–13 Nov 2022, Köln: Walther Koenig 2023.
Zwischen Baby- und Beischlaf. Der dissonante Charme des Häuslichen in Deana Lawsons afroamerikanischen Familienporträts, in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
Einleitung// Ein feministisches Glossar, oder Getting the #FEMINISM you Deserve; Introduction// A feminist glossary, or: Getting the #FEMINISM you deserve, in: wie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen – how :// do we speak #feminism?// new global challenges, hg. von Elena Zanichelli, Valeria Schulte-Fischedick, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, Februar 2022, S. 8–19, S. 20–30 (d/engl).
(d) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1578/1579
(e) https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw/article/view/1579/1580Zur Rhetorik in der Kunst der Postmoderne, gemeinsam mit Manuela Schöpp, in: Wolfgang Brassat (Hg.): Rhetorik in den bildenden Künsten, Handbuch in der Reihe Handbücher zur Rhetorik, Berlin: De Gruyter 2017, S. 757–777.
Repräsentationen des Privaten, in: Hubertus Butin (Hg.): Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln: snoeck Verlag 2014, S. 311–314.
ProjekteFamily Values – zur visuellen Re-Artikulation eines konfliktbeladenen Modells
Forschungsprojekt über den künstlerischen und (massen-)medialen Wandel von Familienbildern seit der Moderne, nimmt die gegenwärtige Wandlung von „Kern-“ bzw. „Normal-“ zu „Weltfamilien“ (Beck-Gernsheim 2011) zum Anlass, visuelle (Re-)artikulationen westlicher Familienrepräsentationen in Kunst und Medien vergleichend zu analysieren Ausgangspunkt ihrer Analysen ist die Transformation der Institution Familie, die als traditioneller „Hort von Ruhe, Liebe und Geborgenheit“ (Beate Rössler) seit dem 19. Jahrhundert sozialwissenschaftlich und anthropologisch für den Raum des Privaten steht. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie sich westliche Familienmodelle im Zeitalter der postfamiliären Familie künstlerisch artikulieren lassen, sondern auch, wie die Kunst ihr eigenes Familienmodell – als Gegenerzählung – imaginiert oder aber kritisch verklärt, etwa im Kontext dekolonialer Ästhetik. Die Behauptung einer aktuellen Re-Artikulation von Familienbildern entspringt der an Cultural und Visual Studies orientierten Frage, wie dominante Codes visuell erkennbar werden, also ganz im Sinne Stuart Halls: Wer repräsentiert wie wen, und weshalb?Formlosigkeit... mit Folgen. Exzentrische Abstraktion, Anti-Form, Post-Minimalismus, Informe und ihre Relektüren
Leitung der gleichnamigen Tagungssektion auf dem XXXVI.
Kunsthistorikertag in Stuttgart, Universität Stuttgart (Konzept: Valeria Schulte-Fischedick), 25. März 2022MitgliedschaftenKuratorium, Kulturstiftung der Länder, seit 2020
Neues Sammeln, Kulturstiftung der Länder, Jurymitglied 04/2022
Heinrich-Böll-Stiftung, Alumna, seit 2006
Zeitschrift für Kunstgeschichte, Beiratsmitglied seit 11/2020
Vorträge(Auswahl)
All together now? Family images in postfamilial times
Online-Vortrag im Rahmen der Konferenz Hitting Home: Representations of the Domestic Milieu in Feminist Art, Panel Challenging Normative Constructs of the Nuclear Family, South African Art and Visual Culture, University of Johannesburg, 15. November 2022.Ich und Du und Wir (und Alle anderen auch): Zu Barbara Krugers appellativen Sprachfunktionen
Vortrag im Rahmen der Abendveranstaltung Privat – bitte eintreten – zu Barbara Krugers Ausstellung „Bitte lachen / Please cry“, Neue Nationalgalerie Berlin, 03. August 2022.Family Values: On The Visual Re-Articulation of a Conflicting Model
Vortrag im Rahmen der German Studies Lecture Series, Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages, School of Humanities and Sciences, 17. Mai 2022.Einleitung
Online-Vortrag im Rahmen der 6. Forschungswerkstatt der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen, RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen, zusammen mit Dr. Kathrin Heinz, 4. Februar 2022.Mamma mia! On the visual (re-)articulation of motherhood in contemporary art and culture
Vortrag im Rahmen der Tagung Diverse Families: Parenthood and Family/s beyond Heteronormativity and Binary Gender, Panel 3: „Family Images: Visual (re-)negotiations of gender and parenthood, Humboldt-Universität zu Berlin, Senatssaal, 07. Oktober 2021.Chair, Online-Konferenz Seeing the ‘Other’? Theories & Histories of (Post-)Colonial Visual Culture, Panel „Theories and Methodologies”
Virtual Conference, German
Maritime Museum Bremerhaven, in Cooperation with the Institute for Postcolonial Literary and Cultural Studies, the Institute for Anthropology and Cultural Studies and the Institute for Art History / Film Studies / Art Education at the University of Bremen, 8. April 2021.LehrveranstaltungenTheorien der Gegenwartskunst
Seminar u. a. zur Sorge- und Regenerationsarbeit und zum Themenbereich Autofiktion im Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Universiät Bremenwie ://sprechen wir #feminismus?// neue globale Herausforderungen
Seminar im Bachelor Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Universität BremenBild – Raum – Subjekt
Forschungskolloquium für Kunstwissenschaft und Visuelle Kultur, Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Promotionskolloquium Kunstwissenschaft, Universität Bremen
-

Dr. Kathrin Heinz
Leiterin und Geschäftsführerin, Vorstand des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & GenderDr. Kathrin Heinz

Kathrin Heinz (Dr. phil.) ist Kunstwissenschaftlerin. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (MSI) sowie Leiterin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK) an der Universität Bremen. Gemeinsam mit Irene Nierhaus gibt sie die Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen (transcript) heraus. Seit 2005 ist sie Mitherausgeberin der Fachzeitschrift FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur.
ForschungsschwerpunkteSchwerpunkte in Forschung und Lehre beziehen sich auf die Kunst- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Konzeptionen von Künstler*innenschaft in der Moderne, Wohn- und Geschlechterforschung.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Heldische Konstruktionen. Von Wassily Kandinskys Reitern, Rittern und heiligem Georg, Bielefeld: transcript 2015.
Herausgaben
Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus. Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 7).
Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, hg. gemeinsam mit Katharina Eck, Johanna Hartmann und Christiane Keim. Bielefeld: transcript 2021 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).
Zeichen/Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, hg. gemeinsam mit Sigrid Adorf. Bielefeld: transcript 2019.
Aufsätze
Saint Georges, madones et autres objets. Au plus près des natures mortes de Gabriele Münter,
in: Ausst.-Kat. Gabriele Münter : Peindre sans détours, hg. Isabelle Jansen, Hélène Leroy, Anne-Lise Weidmann, Paris-Musées 2025, S. 114-121.„They smell the same!“ Verhängnisvolle Wohnverhältnisse in Bong Joon-hos PARASITE (2019), in: Drehli Robnik, Joachim Schätz (Hg.): Gewohnte Gewalt. Häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino, Wien: Sonderzahl 2022, S. 251–255.
GeWOHNte Seiten: Blättern, Einrichten, Kombinieren. Gestaltung als Wissenspraxis. In: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021, S. 44–81. (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Rein ins Haus. Raumverhältnisse und Wohnbeziehungen an stillen Orten, in: Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.): Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2021, S. 339–365 (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen Bd. 5).
An dünnen Fäden: Raumarbeiten und Wohndinge, in: Suse Itzel (Hg.): Suse Itzel Auflösungen, Künstlerinnenbuch, 2020, S. 97–105.
Von ausgeschnittenen Möbeln und eingeklebten Gefäßen. Zur Edition von Mia Unverzagt, in: Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Heft Nr. 64, 2018, S. 108–113.
Bezugssystem Matratze [Denkausschnitte], in: Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.): Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, Bielefeld: transcript 2016, S. 41–55 (Schriftenreihe wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).
ProjekteForschungsfeld wohnen+/-ausstellen (Leitung)
Forschungsprojekt Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen (Leitung, gemeinsam mit Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus)
Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das Gründerzeitmuseum, Symposium, 11./12. Juli 2024, Mahlsdorf (Leitung, gemeinsam mit Prof. Dr. Kerstin Brandes und Astrid Silvia Schönhagen M.A.)
Forschungsprojekt Künstler*innen haushalten. Wohnen als ästhetische und epistemische Praxis (AT)
MitgliedschaftenUlmer Verein - Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.
Frauen Kunst Wissenschaft e.V. (Vorstand), Trägerverein von FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur
Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK
Museumsfreunde Weserburg (Vorstand)
GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst
Kunstverein Bremen
Blaumeier-Atelier (Fördermitgliedschaft)
Vorträge(Auswahl)
Wohnen in Bildern: Gabriele Münters Räume
Vortrag anlässlich der Buchpräsentation Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne (hg. gemeinsam mit Irene Nierhaus, Bielefeld: transcript 2023), Akademie der bildenden Künste Wien, 09.04.2024.(Sich) Raum nehmen. Wohnpolitiken und Geschlechterverhältnisse
Vortrag am Institut für Architekturbezogene Kunst, TU Braunschweig, 19.05.2022.Studio-Gespräch bei buten un binnen
am 26.3.2022 zum Thema Wohnen anlässlich der Wochenserie Zeig mir, wie du wohnst. URL:
https://www.butenunbinnen.de/videos/talk-mariann-steegmann-institut-kathrin-heinz-100.htmlGerahmtes Wohnen
Einführung zur Internationalen Tagung Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur, Universität Bremen, Onlineveranstaltung, 18.–20.6.2021.Wie Kunstgeschichte erzählen? Gabriele Münter retrospektiv
Vortrag im Sophiensalon am Forschungszentrum Musik und Gender, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 24.4.2019.Gemalte Geschichten und andere Rahmungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter
Vortrag in der Reihe KunstBewusst, Museum Ludwig Köln, 11.12.2018Über Bildfindungen und Objektanordnungen. Gabriele Münter und die Erzählräume des Blauen Reiter
Vortrag bei Ein Symposium für Gabriele Münter, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 23.–24.2.2018.Verdeckte Einschreibungen – Körper/Dinge und andere Wohnbedürfnisse
Vortrag bei Wie Wohnen? Interdisziplinäres Arbeitstreffen an der Schnittstelle von Mode, Kunst, Textildesign und Medien, Universität Paderborn, 2.2.2018. -

Dr. Urs Brunner
Vorstand (Mariann Steegmann Stiftung)Dr. Urs Brunner
Vorstand der Mariann Steegmann Stiftung

-

Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender (bis März 2021), Vorstand (beratend)Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus

Irene Nierhaus, bis 2021 Professorin für Kunstwissenschaft und ästhetische Theorie an der Universität Bremen und Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender in Kooperation mit der Universität Bremen. Gründungsprofessorin des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen und der gleichnamigen Schriftenreihe bei transcript mit Kathrin Heinz. Seit 2012 im Beirat der FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur. Seit seit 2021 Vorsitzende der Mariann-Steegmann-Stiftung Deutschland und seit 2023 Mitglied des Universitätsrates der AAU-Universität Klagenfurt. Mitglied des Wohnprojektes Gleis 21 Wien.
ForschungsschwerpunkteForschungen zur visuellen und räumlichen Kultur, insbesondere zu Beziehungen zwischen Kunst, Architektur und bildnerischen Medien des 19. und 20. Jahrhunderts wie der Gegenwart. Wohnen wird als zentrale Kategorie gesellschaftlicher Raumbildung und entsprechendes Prozessgefüge von Bild, Raum und Subjekten untersucht. Der Fokus liegt auf Geschichte, Gesellschaftspolitik und dem Konzeptiven des Wohnens in verschiedenen Formen und Formaten des Visuellen.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Arch6: Raum, Geschlecht, Architektur, Wien: Sonderzahl 1999.
Herausgaben
Ästhetische Ordnungen des Wohnens. Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und Visueller Kultur der Moderne, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2023 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz und Rosanna Umbach, Bielefeld: transcript 2021 (wohnen+/-ausstellen, Bd. 8).
Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume. Kunst – Architektur – Visuelle Kultur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2020 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 7).
Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, hg. gemeinsam mit Kathrin Heinz, Bielefeld: transcript 2016 (wohnen+/−ausstellen, Bd. 3).
Aufsätze
Das eingerichtete Leben: Zu Zeige- und Bildpolitiken des Wohnens im Roten Wien, in: ARCH+ Zeitschrift für Architektur und Urbanismus, Heft 244 Wien – Das Ende des Wohnbaus (als Typologie), 2021, S. 78-83.
Wohnen. Domestisches, Wohnwissen und Schau_Platz: Kulturanalysen zum Gesellschaftlichen des Ein_Richtens: Theoretische Prolegomena für eine kunstwissenschaftliche Wohnforschung, in: Sigrid Adorf, Kathrin Heinz (Hg.): Zeichen/ Momente. Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse, Bielefeld: transcript 2019, S. 131–146.
Vollständige Liste unter: https://www.uni-bremen.de/kunst/personen/prof-dr-irene-nierhaus/
ProjekteWohnen als politische und ästhetische Gestaltung von Leben. Zu sozialen, kulturellen und medialen Positionen des Bewohnens als dem umfangreichsten gesellschaftlichen Raumhandlungsgefüge (AT)
Buchprojekt, das Wohnen als konzeptives Feld von Beziehungen und Diskursen zwischen Räumlichkeiten, Visuellem, Subjektivierungen und Vergemeinschaftungen untersucht. Gegenstand ist das medial produzierte Wohnwissen und seine Un/Sichtbarkeitsstrategien und Darstellungsmodi – sowohl als affirmative wie widerständige Prozesse – in Theorie, Medien, Kunst und Literatur.
-

Prof. Elke Krasny, Ph.D.
Beirätin und VorsitzProf. Elke Krasny, Ph.D.
Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Mariann Steegmann. Instituts. Kunst & Gender ab 2024
Akademie der bildenden Künste Wien
www.akbild.ac.at
© Yona Schuh -

Dr. Arie Hartog
Wissenschaftlicher BeiratDr. Arie Hartog
Wissenschaftlicher Beirat des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender
Direktor des Gerhard Marcks Hauses Bremen

-

Dr. Bernadette Krejs
Wissenschaftlicher BeiratDr. Bernadette Krejs
Dipl.-Ing. Dr.in techn. Bernadette Krejs
Senior Scientist (PHD) am Forschungsbreich Wohnbau und Entwerfen, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien
Bernadette Krejs (PHD) ist Architektin und Forscherin und derzeit an der Technischen Universität Wien am Forschungsbereich für Wohnbau und Entwerfen tätig. Ihre Arbeiten bewegen sich in einem transdisziplinären Forschungsfeld zwischen Architektur, Wohnbau und Visueller Kultur. Sie ist Herausgeberin und Autorin zahlreicher Bücher (Instagram-Wohnen (2024), WIEN: Das Ende des Wohnbaus (als Typologie) (2023/2021), Lorde for Architecture Students (2023)) und Mitgründerin des feministischen Kollektivs Claiming*Spaces. Mit der aktivistischen Forschungspraxis Palace of Un/Learning kooperierte sie mit internationalen Institutionen wie Fondació Mies van der Rohe Barcelona, Oslo Architecture Triennale, Design Academy Eindhoven, DAZ – Deutsches Architekturzentrum Berlin.
Publikationen(Auswahl)
Monografien
Instagram-Wohnen. Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen Wohnbildwelten, transcript: Bielefeld 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 10).
Herausgaben
Baxi, Kadambari / Glogar, Isabel / Heindl, Gabu / Krejs, Bernadette / Schneider, Tatjana (ed.): Changing Spatial Practice: Alliances, Activism and Networks, Dimensions 09. Journal of Architectural Knowledge, 2025. (forthcoming)
Soziales Wohnen in Wien - Ein transdisziplinärer Dialog, hg. gemeinsam mit Judith Lehner, Simon Güntner, Michael Obrist, TU Academic Press Wien. (forthcoming)
ARCH+244 Vienna: The End of Housing (as a Typology), hg. gemeinsam mit Christina Lenart, Anh-Linh Ngo, Michael Obrist, Leipzig: Spektor Books 2024.
Lorde for Architecture Students, hg. gemeinsam mit Brady Burroughs, Afaina de Jong, Inge Manka, Stockholm 2023.
Artikel
UnLearning Instagram(ism): Performing the Home Otherwise, in: Carmen Lael Hines, Lisa Moravec (Hg.): Posthumanist Approaches to a Critique of Political Economy: Dissident Practices, New York: Bloomsbury Publishing (forthcoming 2025).
gemeinsam mit Katharina Kirsch-Soriano da Silva, Judith Lehner: Orte der Sanften Stadterneuerung, in: Katharina Kirsch-Soriano da Silva, Judith Lehner, Simon Güntner (Hg): Sanfte Stadterneuerung Revisited, Berlin: Jovis Verlag 2024.
Projekte2024 Co-Leiterin des Doktoratsprogramm New Social Housing, TU Wien
2023 Co-Gründerin der aktivistische Forschungspraxis Palace of Un/Learning, mit Max Utech
2019 Co-Gründerin des feministischen Kollektivs Claiming*Spaces - queer feministische Perspektiven in Architektur und Raumplanung an der TU Wien
2025
Palace of Un/Learning
Co-Kuratorin der Ausstellung Palace of Un/Learning im DAZ – Deutsches Architektur Zenturm Berlin2023
Intervention Glitching Mies im Barcelona Pavilion
gemeinsam mit Max Utech, Fundació Mies van der Rohe, Barcelona2021
Ausstellungsbeitrag On Ideals of the Home - How We Fell (in Love) with Digital Image Worlds
PLATFORM AUSTRIA, 17. Internationale Architekturausstellung La Biennale di Venezia2019 – 2021
Diskursraum Wohnbau Wien: Positionen zwischen Gemeinwohl und Wohlstand. Wiens Wohnbau im Kontext Europas
EXCITE-Förderung der Fakultät für Architektur und Raumplanung, mit Christina Lenart, TU Wien2016 – 2017
Intensified Density – kleinmaßstäbliche Nachverdichtung in modularer Bauweise
FFG Stadt der Zukunft, mit P. Petersson, P. Kickenweitz, C. Linortner, TU GrazBernadette Krejs
Instagram-Wohnen
Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen WohnbildweltenWelche Auswirkungen hat die mediale Repräsentation ästhetisierter Wohnbildwelten auf Plattformen wie Instagram auf das Verständnis von Architektur, Raum und Wohnen? Der Komplexität des Wohnens werden die dominanten Bildnarrative auf Instagram nicht gerecht, trotzdem finden die visuellen Wohnideale auch gebaute Übersetzungen und Anschlussstellen. Bernadette Krejs analysiert, was gegenhegemoniale Wohnbilder als politisch aktivistische Bilder für das Wohnen leisten können. Im Spannungsverhältnis von Bild und Architektur stellt sie alternative (Bild-)Möglichkeiten für mehr Diversität, Widerstand und Gemeinschaft in den Fokus – und bietet Impulse im Umgang mit digitalen und medial vermittelten Bildern.
-

Gerlinde Walter
Wissenschaftlicher BeiratGerlinde Walter
Wissenschaftliche Beirätin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender
Referatsleiterin i.R. Hochschulen und Hochschulpolitik in der senatorischen Behörde für Bildung und Wissenschaft des Landes Bremen

-

Prof. em. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat
Ehemalige Beirätin und Vorsitz bis 2024Prof. em. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat
Vorsitz des wissenschaftlichen Beirats des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender bis 2024
Universität für angewandte Künste Wien

-

Mariann Steegmann
Stifterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & GenderMariann Steegmann

Das Mariann Steegmann Institut (MSI) ist eine Einrichtung der Mariann Steegmann Stiftung zur Förderung von Frauen in Kunst und Musik, deren Gründung als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts mit Sitz in Bremen durch das Vermächtnis von Mariann Steegmann ermöglicht wurde.
Die Stifterin wurde am 30. Januar 1939 in Berlin als Tochter der Schweizer Hotelbesitzerin Lea Steegmann, geb. Morosani und des deutschen Wirtschaftsanwaltes Josef Steegmann geboren. Sie studierte Psychologie und schloss 1968 das Studium mit dem Diplom ab. Anschließend arbeitete sie in einem Kinderheim und übernahm 1973 zusammen mit einer Freundin ein Kurhaus in Degersheim (Appenzeller Land), das sie bis kurz vor ihrem Tod im Juni 2001 leitete.
Ihr Vater Josef Steegmann hinterließ eine Kunstsammlung der Klassischen Moderne und eine Kunstbibliothek. Zu sehen sind die Werke heute größtenteils als Leihgaben in der Staatsgalerie Stuttgart. Nach seinem Tod ging die Sammlung Steegmann in eine Stiftung über. Durch zwei Bildverkäufe konnten verschiedene Projekte der Gender-Forschung in den Musik- und Kunstwissenschaften gefördert werden, wie das Forschungszentrum Musik und Gender an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und das Mariann Steegmann Institut Kunst & Gender. Dem vorausschauenden Engagement, dem künstlerischen Interesse und der Großzügigkeit von Mariann Steegmann ist es zu verdanken, dass 2010 das MSI eröffnet werden konnte.
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
Silke Bangert
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kooperationsstelle IKFK/MSI
Dr. Katharina Eck
Mariann-Steegmann-Stipendiatin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Postdoc
Johanna Hartmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kooperationsstelle IKFK/MSI
Anna-Katharina Riedel
Mariann-Steegmann-Stipendiatin
Studentische Mitarbeiter*innen
Simone Bacher (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Carina Bahmann (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Anna Blahaut (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Charlotte Blumenthal (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Juliane Breternitz (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Josina Dehn (B.A. Kunst - Medien - Ästhetische Bildung)
Hannah Haeusler (M.A. Transkulturelle Studien)
Ellen Haak (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Jana Harriefeld (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Swantje Jasca (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Jorun Jensen (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Jule Kahrig (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Eugenia Kriwoscheja (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Alessa Lubig (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Anne Pfennig (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Anne Seiler (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Katja Thiele (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Sophie Tomfort (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Rosanna Umbach (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Julia Weiss (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Lenus Willert (B.A. Soziologie)
Lea Woltermann (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Daniela Yavuzsoy (M.A. Kunst- und Kulturvermittlung)
Tanja Zafronskaia (M.A. Kunst- und Filmwissenschaft)
Anton Zscherpe (B.A. Kunstwissenschaft/Kunstpädagogik)
-

Dr. Silke Förschler
Dr. Silke Förschler

Silke Förschler ist Kunsthistorikerin und zur Zeit Vertretungsprofessorin an der Universität Jena. Habilitation an der Kunsthochschule Kassel mit einer Arbeit zu naturhistorischen Tierdarstellungen in der Frühen Neuzeit. Zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin im LOEWE-Forschungsschwerpunkt „Tier–Mensch–Gesellschaft“ an der Universität Kassel. Promotion an der Universität Trier im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs „Identität und Differenz. Geschlechterkonstruktionen und Interkulturalität vom 18. Jahrhundert bis heute“ an der Universität Trier. Gemeinsam mit Christiane Keim und Astrid Silvia Schönhagen kuratiert sie seit Sommersemester 2021 die online-Veranstaltungsreihe „Salon Tier“ und ist Mitglied im Forschungsprojekt c/o Habitat Tier. Zudem Kunstvermittlung und Betreuung der international artists in residence der Stiftung Berliner Leben.
PublikationenMonografien
Tierdarstellungen in der Frühen Neuzeit. Praktiken und Ästhetiken der Naturgeschichte (in Vorbereitung zur Publikation, angenommen in der Reihe Cultural Animal Studies, J.B. Metzler Verlag, Heidelberg).
Bilder des Harem. Medienwandel und kultureller Austausch, Berlin: Reimer 2010.
Herausgaben
Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, hg. gemeinsam mit Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/– ausstellen, Bd. 6).
Verfahrensweisen der Naturgeschichte in der Frühen Neuzeit. Akteure, Tiere, Dinge, hg. gemeinsam mit Anne Mariss, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2017.
Artikel
The Visualization of unknown Animals. Aesthetics of Natural History in Perrault’s Description anatomique, Merian’s Metamorphosis insectorum Surinamensium and Réaumur’s History of insects, in: Notes & Records. The Royal Society Journal of the History of Science, April 2022 (Royal Society, Open Access).
Visual Culture Studies and Art History, in: André Krebber, Brett Mizelle, Mieke Roscher (Hg.): Handbook of Historical Animal Studies, Berlin: De Gruyter 2021, S. 377–394.
Medium der Verlebendigung. Tierdarstellungen auf Pergament, in: Tiere und/als Medien hg. v. Jessica Ullrich und Stefan Rieger, Tierstudien Nr. 18, 2020, S. 19–31.
-

Dr. Franziska Rauh
Universität BremenDr. Franziska Rauh
Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an der Universität Bremen
https://www.uni-bremen.de/kunst/personen/dr-franziska-rauh
Franziska Rauh, Dr. phil, ist seit 2018 Lektorin im Fachgebiet Kunstwissenschaft am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an der Universität Bremen. Sie studierte Kultur-, Kunst- und Musikwissenschaft an der Universität Bremen. Zwischen 2010 und 2015 war sie als Projektkoordinatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschungs- und Ausstellungsprojekten zur Konkreten und Visuellen Poesie sowie zur Radiokunst im Zentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen tätig.
In ihrer Dissertation, mit der sie 2022 an der Universität Bremen promoviert wurde, untersuchte sie dispositivanalytisch das Verhältnis von Kunst und Politik am Beispiel der Radiokunstarbeit „Three Weeks in May“ (1977) der feministischen Künstlerin Suzanne Lacy. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der räumlichen Verortung von sexualisierter Gewalt.ForschungsschwerpunkteDie audio/visuelle Verhandlung sexualisierter Gewalt in Kunst und Medien, Kunst im Öffentlichen Raum sowie Formen und Institutionen künstlerischen Publizierens, stellen nach wie vor Forschungsschwerpunkte dar. Darüber hinaus forscht sie aktuell zu Verknüpfungen von künstlerischen Strategien, (Queer)Feministischen Ansätzen und Ökologischen Fragestellungen.
PublikationenMonografien
Dissertationsschrift: Zum politischen Potential der radiokünstlerischen Arbeit „Three Weeks in May“ (1977) von Suzanne Lacy. Eine Dispositivanalyse künstlerisch-medialer Aussageproduktion zu sexualisierter Gewalt, Bielefeld: transcript (Schriftenreihe für Künstlerpublikationen, Bd. 11), geplant für Frühjahr 2025.Herausgaben
Radio as Art: Concepts, Spaces, Practices. Radio Art between Media Reality and Art Reception, Bielefeld: transcript 2019, hg. gemeinsam mit Anne Thurmann-Jajes, Ursula Frohne, Jee-Hae Kim, Maria Peters, Sarah Rothe.Artikel
<Pushing the Envelope>: Close Radio, a Radio Show by Artists as Political and Artistic Positioning, in: Anne Thurmann-Jajes, Regine Beyer (Hg.): Listen Up! Radio Art in the USA, Bielefeld: transcript 2024, S. 65–80. (Im Erscheinen)When Car Culture Meets Rape Culture. Das Auto als Verhandlungsraum sexualisierter Gewalt in Three Weeks in May (1977) von Suzanne Lacy und in Hollywood-Filmen, in: Irene Nierhaus, Heinz, Kathrin (Hg.): Unbehaust Wohnen. Konflikthafte Räume in Kunst – Architektur – Visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2020 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 7), S. 293–306.
Radio Art in the <…Everyday Hand-to-Hand Struggle with Apparatuses>?, in: Anne Thurmann-Jajes et al. (Hg.): Radio as Art: Concepts, Spaces, Practices. Radio Art between Media Reality and Art Reception, Bielefeld: transcript 2019, S. 118–126.
“Excerpt from Three Weeks in May (1977). Radio within the Artistic-Activist Practice of Suzanne Lacy.“, in: Radio Art. Ein Blick auf die Radiokunst. Setup4. Online Magazin, 2. Ausgabe, Bremen: Forschungsverbund Künstlerpublikationen, 2014.
MitgliedschaftenForschungsverbund Künstlerpublikationen e.V.
Forschungsgruppe wohnen+/ -ausstellen
ProjekteArtists‘ Publications – A Critical Approach Historical and Contemporary Formats of Artistic Publishing, Symposium of the Research Association for Artists’ Publications,
June 28.–29, 2024: Centre for Artists’ Publications at the Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen.
A project by the Research Association for Artists’ Publications in Cooperation with the Centre for Artists’ Publications at the Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen, the IKFK. Institute for Art History – Film Studies – Art Education and the Mariann Steegmann Institute. Art & Gender at the University of Bremen.
Concept and organization Franziska Rauh und Kathrin Barutzki
-
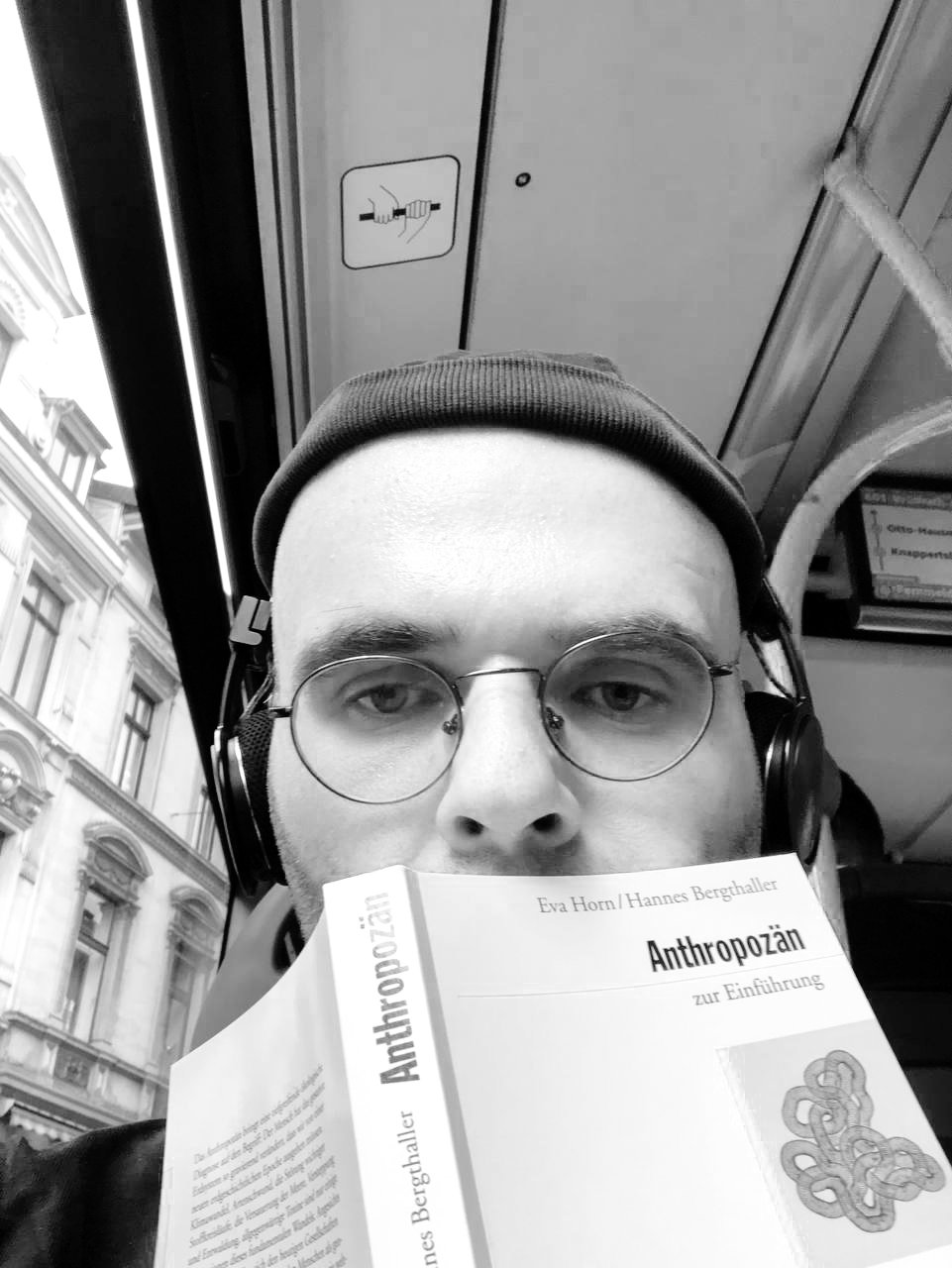
Dr. Alexander Wagner
Dr. Alexander Wagner
Dr. Alexander Wagner
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften
Neuere Deutsche Literaturhttps://germanistik.uni-wuppertal.de
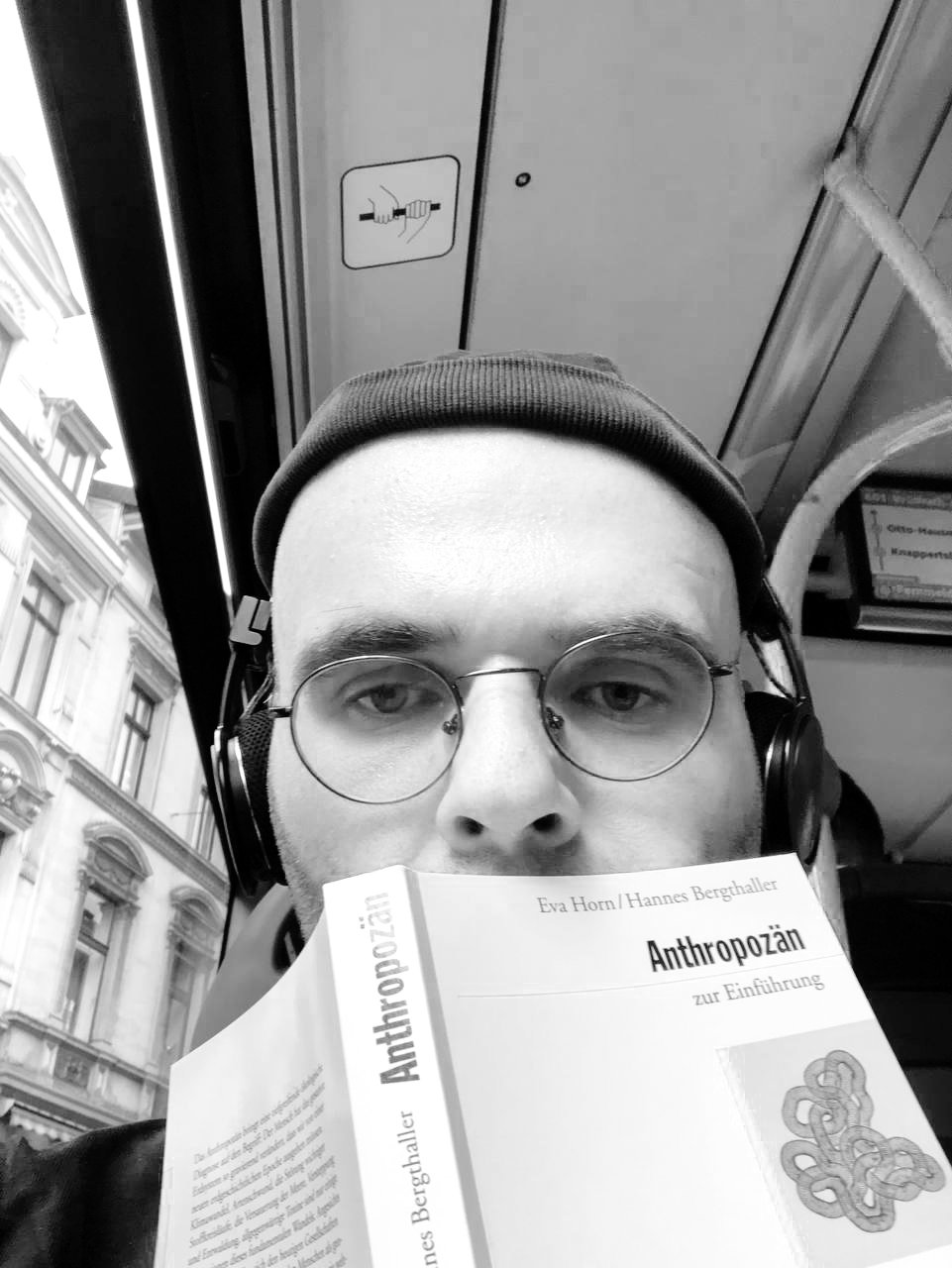
Kurzvita
Alex ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturgeschichte der Bergischen Universität Wuppertal. Er hat Germanistik und Philosophie studiert und über die Kontinuitäten des deutschen Kolonialismus im Nationalsozialismus promoviert. Er interessiert sich für Mediengeschichte, Kultursemiotik, (wissenschaftlichen) Modellbau und arbeitet gern an den Grenzen von Kunst und Wissenschaft. Weitere Forschungsschwerpunkte sind Klassismus, postkoloniale Theorie, Geschlechtergeschichte und die Geschichte Ostdeutschlands seit der „Wende“.
PublikationenMonografien
Bücher mit Stoffbezug. Der nationalsozialistische Vierjahresplan und der synthetische Kolonialismus in der deutschsprachigen Populärliteratur, Paderborn: Fink 2022.
Artikel
gemeinsam mit Madleen Podewski: Moderierte Aktualität. Wie die NBI (Neue Berliner Illustrierte) die ›Wende‹ heftweise festhält, in: Vincent Fröhlich, Nicola Kaminski & Volker Mergenthaler (Hg.): Flüchtigkeit fixieren. Praxeologische Modelle journalliterarischen Festhaltens, im Erscheinen.
Die Wohnzeitschrift als Wä'ende-Moderatorin. Wie NEUES WOHNEN. kultur im heim im Beitrittsjahr 1990 agiert, in: Periodicon, hg. von Christian A. Bachmann, Andreas Beck & Vincent Fröhlich, 4, 2023, S. 46-66 (Link zum Artikel).
Stationärer Cyberspace. Räumliche Settings des Internets als untragbares Medium, in: [kɔn]paper. Magazin für Literatur und Kultur 10, 2023, Thema "Raum" [im Erscheinen]
Schweiz/Haiti/NEW WORLD PLAZA. Individualgeschichte und Universalgeschichte in Dorothee Elmigers Aus der Zuckerfabrik, in: Martin Nies, Wolfgang Lukas (Hg.): Zeichen der Fremdheit und ihre Metaisierung in ästhetischen Diskursen der Gegenwart, (Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik 9/2023), S. 169-189 (Link zum Heft).
Der Heikodysseus. ‚Reparieren‘ als Prozessor sozialistischer Bildung, in: Reparaturwissen: DDR. Zeitschrift für Medienwissenschaft 27 (2022), Red.: Ulrike Hanstein, Manuela Klaut & Jana Mangold, S. 51-64 (Link zum Heft).
MarsMenschenMedien. Der Nachbarplanet als Sphäre kultureller Selbstvergewisserung um 1900, in: Berliner Debatte Initial 4 (2021), S. 62-75.
Kultur im Heim. Die Sphärendynamik des 'Wohnens' in Wohnzeitschriften der DDR, in: Kathrin Heinz, Irene Nierhaus & Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten. Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021. S. 406-428.ProjekteAufbau eines Forschungslabors für Interventionen gegen Klassismus (*FLINK)
Kurator des Projekts Ostschule zu ostdeutschen Erfahrungen und neuen Möglichkeiten ihrer Integration in den gesellschaftlichen Diskurs von Sebastian Jung (2023)
Herausgeber des Think Tank zum Projekt Hot Spot Society zu den sozialen Krisen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie von Sebastian Jung (2021, zusammen mit Franziska Schmidtke)
Kurator des Projekts Bananen für Wuppertal zu städtischem Strukturwandel und Post-Wende-Erfahrungen in westdeutschen Städten von Sebastian Jung (2020
MitgliedschaftenInternationales Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften
Netzwerk „Energie und Literatur“
Gesellschaft für Medienwissenschaften
-

Dr. Linda Stagni
Dr. Linda Stagni
Dr. Linda Stagni
Dozentin (Postdoc) am Departement Architektur, ETH Zürich
Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta)https://delbeke.arch.ethz.ch/de

Kurzvita
PublikationenArtikel
Die Beständigkeit des Flüchtigen. Das Werk unter Joseph Gantner vor Hundert Jahren, in: werk, bauen+wohnen, 11 (2023), S. 59–62.
gemeinsam mit Claudio Gianoncelli: Oh mamma … mi è caduto il cornicione!, in Maarten Delbeke, Erik Wegerhoff, gta papers The Cornice, 6, 2021, S. 114–119.
gemeinsam mit Alberto Alessi: Le Facoltà dell'architettura, in: Marc, Angélil et al. (Hg.): Building for architecture education: Architekturpädagogiken. Lucerne Talks, Zürich: Park Books 2021, S. 182–185.
Competing Visualizations: How Architecture Becomes Its Image, in: Friedrich Tietjen, Maria Gourieva, International Journal of Cultural Research After Post-Photography, 37, 4, 2019, S. 115–129.
Kommentar zu: Nachruf: Camille Martin (1928), Schriftenverzeichnis, in: Sylvia Claus, Lukas Zurfluh (Hg.): Städtebau als politische Kultur. Der Architekt und Theoretiker Hans Bernoulli (1876 –1959), Zürich: gta Verlag 2019, S. 114–118.
Ricordi, speranze e illusione del tempo: Il deserto dei Tartari, in trans 34 Youth, 34, 2019, S. 39–44.
L’architettura moderna svizzera nazionale e internazionale, la rivista di architettura e le sue strategie interpretative, in: Carla Subrizi: ‘900 Transnazionale, 3, 2, 2019, S. 44–60.A Space Oddity, in: werk, bauen+wohnen, 3, 104, 2017, S. 76–77.
ProjekteConceptualization and co-organization of the DocTalks, ETH Zurich, 2018–ongoing, https://doctalks.net/
Conceptualization, co-organization, and co-teaching of the summer school On the Threshold: Guidebooks and Visions of Rome, Chair Delbeke, at the Istituto Svizzero in Rome, 24.07–01.08.2021
-

Sonja Sikora
Sonja Sikora
Sonja Sikora
Deutsches Dokumentationszentrum für
Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg
Kurzvita
PublikationenArtikel
A celebration of art – 25 years Artists’ Colony Museum Darmstadt, in: coup De fouet, hg. von Art Nouveau European Route, coup De fouet, Bd. 27, 2016, S. 56-63.
Ludwig Meidner : Begegnungen, Ausst.-Kat., Institut Mathildenhöhe Darmstadt, 09.10.2016-05.02.2017, München: Hirmer 2016.
Weltentwürfe. Die Künstlerkolonie Darmstadt 1899 – 1914, Ausst.-Kat., Institut Mathildenhöhe Darmstadt, 06.05.2015-26.07.2017, Darmstadt: Museum der Künstlerkolonie Darmstadt 2015.
ProjekteDas Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit dem Begriff der Raumkunst um 1900 im Kontext der privaten wie öffentlichen Innenraumgestaltung. Nachvollzogen wird die historische Genese der Begriffsverwendung und die Umsetzung des dahinterstehenden künstlerischen Konzeptes zwischen 1890 und 1920. Wichtige Quellen für die Untersuchung sind Kunst- und Kunstgewerbezeitschriften dieser Zeit sowie Monografien und Bildbände mit künstlerischen Innenraumentwürfen. Ein Schwerpunkt des Forschungsprojektes liegt auf der farblichen Ausgestaltung der Innenräume. Ebenso findet der Eingang des Raumkunstkonzeptes in die akademische Lehre um 1900 gesonderte Berücksichtigung.
-

Dr. Ing. Jan Engelke
Dr. Ing. Jan Engelke
Dr. Ing. Jan Engelke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc) an der TU München, Professur für Urban Design
https://www.arc.ed.tum.de
Kurzvita
Jan Engelke lebt in Berlin und plant, forscht und schreibt mit der kollektiven Architekturpraxis ANA an Architektur-, Ausstellungs- und Publikationsprojekten. Nach seinem Architekturstudium an der ETH Zürich und der Bauhaus-Universität Weimar promovierte er an der TU München zum Eigenheim in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte und der Zeitschrift Schöner Wohnen. Derzeit ist er Outgoing Fellow am DFG-Graduiertenkolleg Identität und Erbe an der Bauhaus-Universität Weimar. Aktuell forscht und lehrt er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Urban Design der TU München und leitet die Forschungsgruppe Transforming the everyday architecture of the 21st century.
PublikationenHerausgaben
Offenbach Kaleidoskop. Geschichten eines Hauses, hg. von ANA, Leipzig: Spector Books 2022
Artikel
Das große Ziel: Ein kleines Haus. Eigenheim-Architekturen im Kontext der bundesdeutschen Nachkriegszeit, in: Janna Volg et al. (Hg.): Dinge, die Verbinden – Objekte und Erbekonstruktionen, Weimar: Bauhaus Universitätsverlag 2024 (im Erscheinen).
Wir haben in die Zukunft geplant. Architektonische Zukunftsperspektiven in der Schöner Wohnen der 1960er und 70er Jahre, in: Irene Nierhaus und Heinz, Kathrin (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023, S. 427–445.
Schöner wohnen? Das Eigenheim in populären Architekturdiskursen der westdeutschen Nachkriegszeit, in: Irene Nierhaus, Heinz, Kathrin und Umbach, Rosanna (Hg.): WohnSeiten – Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, Bielefeld: transcript 2021, S. 430–455.
Vom Behelf zum Heim. Über die Gestaltung einer stets unfertigen Zeit, in: Philipp Meuser und Enver Hirsch (Hg.): Behelfsheim, Hamburg: Eigenverlag 2020.
ProjekteAusgehend von der populären Wohnzeitschrift »Schöner Wohnen« untersuchte Jan in seinem Dissertationsprojekt »Die eigenen vier Wände: Schöner Wohnen im Wirtschaftswunder« (TU München, 2019–2023) die Architekturgeschichte des Eigenheims im gesellschaftlichen und politischen Kontext der bundesdeutschen Nachkriegszeit.
Als Outgoing Fellow am DFG-Graduiertenkolleg »Identität und Erbe« forscht Jan an der Bauhaus-Uni Weimar zu architektonischen Zukunftsperspektiven bestehender Einfamilienhäuser der ›Wirtschaftswunder‹-Jahre.
Jans Forschungsinteressen sind der Architekturbestand der Nachkriegszeit in dessen politischen und gesellschaftlichen Entstehungskontexten und die Rolle dieser Bauten in der Gegenwart. Mit der kollektiven Architekturpraxis ANA – Architektur, Narration, Aktion arbeitet er an Strategien und Perspektiven für den Erhalt von Bauten aus dieser Zeit.
-

Dr. des. Zofia Durda
Dr. des. Zofia Durda
Dr. des. Zofia Durda
Kuratorin der Sammlung des Weltkulturerbes Rammelsberg und stellv. Museumsleitung

Architekturstudium in Berlin und Jerusalem, postgraduales Masterstudium der Denkmalpflege an der TU Berlin. 2014-2023 assoziierte Doktorandin im DFG-Graduiertenkolleg 1913 „Kulturelle und technische Werte historischer Bauten“ an der BTU Cottbus-Senftenberg, 2014–2017 Promotionsstipendium des Landes Brandenburg. Ab 2018 im Freilichtmuseum am Kiekeberg, dort inhaltliche Leitung des Projekts „Königsberger Straße – Heimat in der jungen Bundesrepublik“. Inzwischen tätig als Kuratorin und stellvertretende Leiterin im Goslarer Museum & Besucherbergwerk "Rammelsberg".
PublikationenHerausgaben
Bauen und Wohnen nach Plan. Siedlungsbau zwischen 1945 und 1975, hg. gemeinsam mit Stefan Zimmermann, Stefan: Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg (Bd. 103), Rosengarten-Ehestorf: 2022.
Artikel
Orte des Ankommens (VII): Das Musterhaus Matz im Freilichtmuseum Kiekeberg, in: Deutschland Archiv der Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/550287/orte-des-ankommens-vii-das-musterhaus-matz-im-freilichtmuseum-kiekeberg/.
Minigolf – großer Spaß. Bahnengolfanlagen als Teil der Freizeitinfrastruktur im Landkreis Harburg, in: Tagungsband „DorfModerne. Bauten der ländlichen Infrastruktur 1950–1980“ (in redaktioneller Bearbeitung)
Neue große Aufgaben. Kirchenbau im Landkreis Harburg 1945–1979, in: Tagungsband „DorfModerne. Bauten der ländlichen Infrastruktur 1950–1980“ (in redaktioneller Bearbeitung)
Zwei Bauten für die höhere Schule. Das alte und das neue Institut in der Siedlung der Tempelgesellschaft Rephaim/Jerusalem, in: Tagungsband des Arbeitskreises für Hausforschung „Gebäude und Orte zum Lehren, Lernen und Lesen“ (in redaktioneller Bearbeitung)
Trotz der „erlebten Misere des Siedlervereins“? Eine Neue Siedlung für Tostedt, in: Stefan Zimmermann und Zofia Durda (Hg.): Bauen und Wohnen nach Plan. Siedlungsbau zwischen 1945 und 1975, Rosengarten-Ehestorf: 2022 (Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg, Bd. 103).
„Dass der Herr uns gebe einen Nagel an seiner heiligen Stätte“ – Die Anfänge der Siedlung der württembergischen Tempelgesellschaft bei Haifa, in: Heiderose Kilper (Hg.): Migration und Baukultur. Transformation des Bauens durch individuelle und kollektive Einwanderung, Basel: Birkhäuser 2019, S. 97–113.
ProjekteLaufende Forschung zur Quelle-Fertighaus-Fibel
Bau- und Forschungsprojekt „Königsberger Straße – Heimat in der jungen Bundesrepublik“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg: Mitarbeit im Projekt seit Februar 2018, inhaltliche Leitung Februar 2021 bis Dezember 2023
Dissertationsvorhaben „Die Siedlungen der Tempelgesellschaft in Palästina. Baugeschichte und kulturhistorische Bedeutung“ an der BTU Cottbus-Senftenberg, Disputation im Januar 2023.
-

Maren-Sophie Fünderich
Maren-Sophie Fünderich
Dr. Maren-Sophie Fünderich
Stadtarchiv Dortmund
Kurzvita
PublikationenMonografien
Wohnen im Kaiserreich. Einrichtungsstil und Möbeldesign im Kontext bürgerlicher Selbstrepräsentation, Berlin/Boston: De Gruyter 2019. [zugleich Dissertation 2018]
Bürgerlichkeit als kulturelle Praxis. Die Selbstrepräsentation des Bürgertums und die Anfänge der Serienmöbelfertigung am Beispiel der bürgerlichen Stadtwohnung im Kaiserreich, Frankfurt am Main 2019 [zugleich Magisterarbeit Frankfurt am Main 2015]
Artikel
Perfektion in Technik und Form. Unternehmensstrategien in der Möbelfertigung zwischen 1750 und 1914, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte: Journal of Business History, H. 1/ Bd. 68, 2023, S. 37-62.
"Komme sofort ins Haus". Gebrauchtmöbel und Möbelreparaturen im Kaiserreich, in: Astrid Venn, Heike Weber, Jörg Rüsewald/Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (Hg.): Reparieren, Warten, Improvisieren. Technikgeschichte des Unfertigen (Neue Berliner Beiträge zur Technikgeschichte und Industriekultur; Schriftenreihe der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, Bd. 7), Berlin 2023, S. 71-77.
Kunst und Geselligkeit: Die Bielefelder Handwerkerschule und die Anfänge der "Roten Erde", in: David Riedel (Hg.): Westfälische Wege in die Moderne. Die Künstlergruppen "Rote Erde" und "Der Wurf" Ausst.-Kat., Böckstiegel Museum Werther (15.1.-23.4.2023), Werther 2023, S. 20-32.
Elizabeth und ihre Möbel in Schloss Homburg, in: Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Katharina Bechler, Kirsten Worms (Hg.): Princess Eliza Ausst.-Kat., Staatliche Schlösser und Gärten Hessen (23.9.2020-18.11.2021), Michael Imhof Verlag, Petersberg 2020, S. 225-227.
ProjekteDie Verbindung von Kunstgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte steht auch im Mittelpunkt meiner laufenden Forschungsarbeiten zu Produktion und Gestaltung von Möbeln, zur Geschichte der Wohnungseinrichtung sowie zum Verhältnis von Kunstgewerbe, Handwerk und Industrieproduktion im Zeitraum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert.
Mitgliedschaftenseit 7/2023: Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte e.V. (GWWG)
seit 1/2023: Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark e.V.
seit 1/2023: Deutsche Gesellschaft zur Erforschung des 19. Jahrhunderts
seit 11/2022: Mitglied im internationalen Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften, Universität Bremen
seit 11/2022: Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte e.V. (GSWG)
seit 3/2022: Mitglied in der Forschungsgruppe Raum (Leiter: Dr. Christoph Schmälzle) im Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (MWW) Klassik Stiftung Weimar
seit 1/2022: Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. (GUG)
seit 1/2022: Mitglied im Arbeitskreis "Women in Economic History" (WIEH)
seit 1/2021: The Furniture History Society (FHS)
seit 1/2021: Mitglied in der AG "Angewandte Geschichte/Public History" des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e.V.
seit 3/2020: Historischer Verein für die Grafschaft Ravensberg e.V.
3/2020-12/2023: Deutscher Museumsbund e.V. (DMB)
seit 10/2019: Deutscher Verband für Kunstgeschichte e.V. (ehemals: Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V. (VDK) (1948-2022))
seit 8/2019: mobile e.V. - Gesellschaft der Freunde von Möbel- und Raumkunst e.V.
seit 10/2016: Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschland e.V. (VHD)
seit 7/2015: Goethe-Alumni
seit 1/2012: Historiae faveo e.V. - Förder- und Alumniverein der Geschichtswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
1/2012-12/2020: Benvenuto Cellini-Gesellschaft e.V. - Verein der Freunde und Förderer des Kunstgeschichtlichen Instituts der J.W. Goethe-Universität -

Mira Annelie Naß
Universität BremenMira Annelie Naß

Mira Anneli Naß, M.A., studierte Kunstgeschichte, Literatur- und Theaterwissenschaft in München und Florenz sowie Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang Universität der Künste. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet sie seit 2019 im Fachgebiet Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie an der Universität Bremen. Ihr Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit künstlerischer Überwachungskritik seit 9/11. Ihre Forschungsschwerpunkte sind zeitgenössische Kunst, insbesondere Fotografie und zeitbasierte Medien, politische Ikonografie und Ästhetik der Überwachung sowie queerfeministische Kunsttheorie.
PublikationenArtikel
Untitled (My Bed). Zum Domestischen als feministische Bildstrategie bei Lina Scheynius, in: Irene Nierhaus, Heinz, Kathrin (Hg.): Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens. Häusliches und Domestisches in der visuellen Moderne, Bielefeld: transcript 2023 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 9).
Ambivalenzen der Bildforensik. Visuelle Verifizierungsstrategien zwischen Aktivismus und Verschwörungserzählung, in: Messy Images, hg. v. Laura Katharina Mücke, Olga Moskatova und Chris Tedjasukmana, montage AV, 31/01/2022, S. 18–39.
Operative Bilder im Kunstfeld. Überwachungskritik nach 9/11, in: Black Box Colour. Kommerzielle Farbfotografie vor 1914, hg. v. Jens Jäger, FOTOGESCHICHTE. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, H. 163, Jg. 42, 2022, S. 61–63.
#feministsurveillancestudies, in: WIE:// SPRECHEN WIR #FEMINISMUS?// NEUE GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN - EIN GLOSSAR, hg. v. Elena Zanichelli und Valeria Schulte-Fischedick, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, H. 70, 2022, S. 99–101.
#toxischerfeminismus, in: WIE:// SPRECHEN WIR #FEMINISMUS?// NEUE GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN - EIN GLOSSAR, hg. v. Elena Zanichelli und Valeria Schulte-Fischedick, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, H. 70, 2022, S. 169–171.
#xenofeminismus, in: WIE:// SPRECHEN WIR #FEMINISMUS?// NEUE GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN - EIN GLOSSAR, hg. v. Elena Zanichelli und Valeria Schulte-Fischedick, FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, H. 70, 2022, S. 169–171.
Architektur von unten? Eine Kritik komplexitätsreduzierender Praktiken bei Forensic Architecture, in: Rassismus in der Architektur, hg. v. Regine Heß, Christian Fuhrmeister und Monika Platzer, kritische berichte, H. 3, 2021, S. 124–138.
ProjekteDas Promotionsprojekt geht von einer Konjunktur künstlerischer Auseinandersetzungen mit staatlichen Überwachungs- und sozioökonomischer Kontrollmechanismen seit den Anschlägen vom 11. September 2001 aus. Zunehmend wird es dabei schwerer, zwischen Überwachungsbildern und Bildern von Überwachung zu unterscheiden. Im Akt des Ausstellens werden zwar standardisierte Formate des Zu-Sehen-Gebens befragt. So können asymmetrische Blickhierarchien und sozialen Raumordnungen zur Disposition gestellt werden. Vermehrt bestimmen in der künstlerischen Analyse eines Überwachungsdispositivs jedoch die Paradigmen des Erzählten die Paradigmen des Erzählens. Diese oberflächlich affirmative Ästhetik scheint signifikant für Überwachungskunst und deren Überschneidungen zu Felder des Aktivismus, des Journalismus oder der Wissenschaft. Dennoch wird ihr häufig ein kritischer Impetus zugesprochen. Für eine gegenwärtige Kunstwelt, die der Forderung nach einer „Verantwortungsästhetik“ (T. Holert) folgt, wird das als Ausdruck eines Kritikalitätsimperativs gewertet. Das bedeute für die Kunst jedoch die Affirmation desjenigen Machtgefüges, das sie zu kritisieren vorgibt. Dem Promotionsprojekt liegt die Frage danach zugrunde, ob – und wenn ja wie – künstlerische Überwachungsbilder in der Lage sein können, ihr Involviert-sein in ein zeitgenössisches Überwachungsdispositiv zu reflektieren und trotz ihrer Partizipation an Ästhetisierungsprozessen Widerstand gegen hegemoniale Schauregime zu leisten.
-

Prof. Dr. Kerstin Brandes
Prof. Dr. Kerstin Brandes
 Publikationen
PublikationenArtikel
Projekte -

Nadja Tamara Siemer
Universität BremenNadja Tamara Siemer

Nadja Tamara Siemer, M.A., studierte mit interdisziplinärem Profil Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft mit British and American Studies in Konstanz und Sussex sowie Kunst- und Medienwissenschaft in Oldenburg. An der Universität Bremen arbeitet Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Visuelle Kultur. Sie arbeitet an einem Dissertationsprojekt, in welchem sie nach postkolonialen Präsenzen im Fotografischen fragt und sich mit Interdependenzen und Ambivalenzen in Umgang und Begegnung mit Fotografie und multiplen Konzepten von Zeitlichkeiten, (kunst-)historischen Narrativen, kulturellen Bilderrepertoires und zeitgenössischen künstlerischen Positionen beschäftigt.
ForschungsschwerpunkteIhre Forschungsschwerpunkte liegen im transdisziplinären Forschungsfeld der Visuellen Kultur, in Theorie und Geschichte der Fotografie, Bild-Text-Relationen, postkolonialer Theorie und dekolonialen Perspektiven.
-

Jorun Jensen
Deutsches ArchitekturmuseumJorun Jensen
Wissenschaftliche Volontärin am DAM - Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main
https://dam-online.de
Jorun Jensen ist Kunstwissenschaftlerin und forscht zum Verhältnis von Architektur, Wohnen und Gender. Sie ist wissenschaftliche Volontärin beim Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt a.M. und arbeitet dort an (Ausstellungs-) Projekten zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Neues Frankfurt". Ihren Master absolvierte sie an der Universität Bremen und arbeitete am Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender. Tätigkeiten im Frauenarchiv und Dokumentationszentrum belladonna, bei filmkulturellen Veranstaltungen sowie szenischen und journalistischen Produktionen.
ForschungsschwerpunkteNeben feministischem Kino, aktuelle Forschung zu Bildpolitiken in visuellen Medien und künstlerischer Re-Inszenierung von historischem Bildmaterial.
PublikationenHerausgaben
Artikel
MitgliedschaftenForschungsgruppe wohnen+/ -ausstellen
Projekte
-
2025
Alessa Paluch
17.6.2025 / 18 Uhr
Vortrag und Heftpräsentation
Alessa Paluch, Greifswald
Schau, wie prekär! – Bilder vom Plattenbau in den deutschen UnterhaltungsmedienUniversität Bremen, SFG 2030 Enrique-Schmidt-Str. 7, 28359 Bremen und via Zoom
Vortrag anlässlich der Heftpräsentation Wohnen mit Klasse, kritische berichte – Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, 2.2025, hg.v. Amelie Ochs und Rosanna UmbachIn deutschen Unterhaltungsmedien wie Filmen und Serien wird der ostdeutsche Plattenbau hartnäckig als eine Architektur der Armut und der menschlichen Abgründe dargestellt. Was bringt diejenigen, die den Plattenbau als Bühnen- oder Szenenbild einsetzen, dazu, diesem Ort in der visuellen Repräsentation stets negative Stereotype von Prekarität zuzuweisen? Warum ist diese unterkomplexe Zuschreibung so erfolgreich?
Im Vortrag werden verschiedene Beispiele von Visualisierungen vom Plattenbau als nicht-ikonische Bilder analysiert. Solche Bilder eröffnen nur sehr enge Bedeutungsräume, die ein So ist es wirklich! behaupten. Die Beispiele aus Defa-Filmen, Spielfilmen der Nachwendezeit sowie ausgewählten Folgen verschiedener Serien wie dem Rostocker Polizeiruf 110 zeigen, dass mit dem Plattenbau klassen- und genderspezifische Vorstellungen verknüpft werden. Aus repräsentationskritischer Perspektive ist daher zu problematisieren, wie sich diese auf die Lebensrealität vieler Menschen beziehen. So stellt sich die Frage nach visueller Gerechtigkeit: Wie wird was wem zu sehen gegeben? -
2025
Jan Engelke
27.5.2025 / 18 Uhr
Jan Engelke, München
Eigene Heime. Identitätskonstruktionen rund ums Einfamilienhausb.zb Bremer Zentrum für Baukultur, Am Wall 165/167, 28195 Bremen und via Zoom
Während das Wohnen im Einfamilienhaus zunehmend unbezahlbar und ökologisch unvertretbar scheint, scrollen wir durch ökologische Fertighäuser namens ,Heimat 4.0’, blättern durch die erfolgreichste Wohnzeitschrift ,Landlust’ und folgen der Entrüstung auf X, wenn das Einfamilienhaus mal wieder verboten werden soll. Die Wohnform Einfamilienhaus war in Verbindung mit Familienbildern, Genderrollen und Eigentumsideologien immer Teil von Identitätskonstruktionen und politischen Projekten. Ihre Homestory führt von Villen und Gartenstädten über die völkische ‚Scholle’ durch Suburbia-Exporte und die Bungalows der Wirtschaftswunderjahre bis in die offenen Küchen und Heizungskeller der Gegenwart, wo uns Tradwives und Homesteader heimsuchen. Wie lässt sich vor diesem Hintergrund über neue Ideen für die 16 Millionen bestehenden Bauten sprechen, die eine Fülle an Wohnraum, -qualität und Potential für Transformation bieten?
Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem b.zb Bremer Zentrum für Baukultur.
-
2025
Darja Klingenberg, Rosanna Umbach, Jorun Jensen
19.1.2025 / 17 Uhr
Buchpräsentation und Gespräch
Küchen/Politiken – Wohnen als politischer SchauplatzGespräch anlässlich der Buchpräsentation
Rosanna Umbach: Un/Gewohnte Beziehungsweisen. Visuelle Politiken des Familialen in der Zeitschrift »Schöner Wohnen«, 1960–1979, transcript Verlag 2025, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 11Darja Klingenberg, Frankfurt/Oder
Rosanna Umbach, Bremen
im Gespräch mit Jorun Jensen, Frankfurt/Main
Kulturzentrum Kukoon, Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen„Die Umgestaltung der Gesellschaft erfordert auch einen radikalen Umbau der Küchen“, heißt es im Sammelband Die Neuordnung der Küchen des Herausgeber*innenkollektivs kitchenpolitics. Das Buch sucht eine neue Auseinandersetzung mit un/verwirklichten Wohnutopien materialistisch feministischer, sozialistischer und bewegungs- linker Kontexte in den 1920er, 1960er und 1980er Jahren. Auch die westdeutsche Zeitschrift Schöner Wohnen verhandelt in der Zeit sozialen Wandels von 1960 bis 1979 die Küche als Ort der Emanzipation, ohne dabei gewohnte Geschlechterdifferenzen aufzulösen. Rosanna Umbach analysiert die ambivalenten Gleichzeitigkeiten im Zeitschriftendisplay zwischen Weckgläsern und Widerstand.
Darja Klingenberg, Mitherausgeberin der Neuordnung der Küchen, und Rosanna Umbach diskutieren die gesellschaftlichen Grundrisse von Küchenarchitekturen und das Wohnen als politischen Schauplatz. Und fragen nach der Geschichte und dem Einfluss queer-feministischer Interventionen ins ,Private‘. Denn die Frage „Wie wollen wir wohnen, arbeiten, trösten, kochen, abwaschen und lieben?“ des Kollektivs kitchenpolitics bleibt aktuell, kontrovers und dringlich.
-
2024
Charlotte Matter
19.11.2024 / 18 Uhr
Charlotte Matter (Zürich)
Abgrenzung und Verbundenheit. Queerfeministische Räume der KunstOlbers-Saal, OG, Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5, 28195 Bremen und via Zoom
In den 1970er Jahren gründeten zahlreiche feministische Kollektive separatistische Räume als Antwort auf männlich dominierte und heteronormative Institutionen. Der Vortrag blickt zurück auf Projekte wie die A.I.R. Gallery in New York, das Woman’s Building in Los Angeles, das Lesbian Art Project und die Great American Lesbian Art Show. Er diskutiert die Grenzen solcher Projekte, die bisweilen neue Dominanzverhältnisse und Ausschlüsse aus einer weißen und essenzialistischen Position heraus reproduzierten. Zugleich lädt er auch ein, die Möglichkeit queer-feministischer Verbundenheit durch Abgrenzung für die Gegenwart zu erkennen. Mit Sara Ahmed (2004) denkend, zieht der Vortrag in Betracht, was es bedeutet, sich in Räumen wohl oder unwohl zu fühlen, und erkundet die anhaltende Relevanz separatistischer Räume.
-
2024
Matthias Noell
25.6.2024 / 18 Uhr
Matthias Noell, Berlin
Die armen Möbel. Stumme, sprechende und mehrdeutige Objekte im Interieur der 1920er-JahreUniversität Bremen, SFG 2010 und via Zoom
Die ein Interieur konstituierenden Dinge und der ihnen zugewiesene Sinn sind spätestens seit den 1920er-Jahren ein konstantes Thema der Wohnliteratur. Stärker als von der Architektur selbst geht vom Interieur ein breiter Diskurs aus, der die Objekte aus Kunst und Design ebenso einschließt wie den Umgang mit ihnen in Literatur und Medien, in Anthropologie oder Soziologie. Die Dinge des Wohnens sind immer in einen instabilen privaten oder einen ebenfalls sich verändernden gesellschaftlichen Diskurs eingespannt. Weder das stumme, noch das mehrdeutige Objekt kann sich der Betrachtung und Auslegung entziehen. Was aber sagen uns die Dinge? Kann heute noch etwas „Menschliches“ in unseren Interieurs gedeihen, oder sind sie mit Walter Benjamin jene „Schlachtfelder, über die der verheerende Ansturm des Warenkapitals siegreich dahingefegt ist“, geblieben?
-
2024
Bernadette Krejs, Mona Mahall, Asli Serbest, Rosanna Umbach
18.6.2024 / 18 Uhr
Buchpräsentation und Gespräch
Drawing Housing Otherwise? Über (digitale) WohnbildweltenGespräch anlässlich der Buchpräsentation
Bernadette Krejs: Instagram-Wohnen Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen Wohnbildwelten transcript Verlag 2024, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 10Bernadette Krejs, Wien
Mona Mahall, Berlin/Weimar
Asli Serbest, Berlin/Bremen
im Gespräch mit Rosanna Umbach, Bremenb.zb Bremer Zentrum für Baukultur, Am Wall 165/167, 28195 Bremen
Welche Auswirkungen hat die mediale Repräsentation ästhetisierter Wohnbildwelten auf Plattformen wie Instagram auf das Verständnis von Architektur, Raum und Wohnen? Was können gegenhegemoniale Wohnbilder als politisch aktivistische Bilder für das Wohnen leisten? Das Spannungsverhältnis von Bild und Architektur wird anhand der forschenden Raumpraxis von Mona Mahall + Asli Serbest (https://monaasli.net/) und Bernadette Krejs diskutiert. Im Gespräch werden alternative (Bild-)Möglichkeiten für mehr Diversität, Widerstand und Gemeinschaft entworfen – und Impulse für den Umgang mit medial vermittelten Bildern gegeben.
Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem internationalen Forscher_innennetzwerk [wohn]zeitschriften und mit dem b.zb Bremer Zentrum für Baukultur.
-
2024
Claudia Blümle
28.5.2024 / 18 Uhr
Claudia Blümle, Berlin
Geschlossene Räume. Interieurvorhänge in der KunstUniversität Bremen, SFG 2010 und via Zoom
Für die Malerei des 19. Jahrhunderts kann vermehrt beobachtet werden, dass mit der Darstellung eines Vorhangs nicht nur das Zeigen, Öffnen und Präsentieren, sondern auch das Verbergen und Verschließen ins Zentrum der Bilder rückt. Insbesondere in der Interieurmalerei sind die Wandteiler, Türvorhänge oder Fenstervorhänge vielfach zugezogen und geben dadurch keine freie Sicht dahinter frei. So zeigen die Vorhänge einerseits die teils beklemmende Situation geschlossener Wohnräume und betonen anderseits einen Raum, der sich vor und nicht hinter den Vorhängen auftut. Dies hat auch Implikationen für die Bilder selbst, die in diesem Fall weniger eine Durchsicht, sondern vielmehr einen nach vorne hin sich erstreckenden Raum im Sinne eines Milieus hervorbringen. Im Vortrag werden diese Fragen abschließend anhand einer zeitgenössischen Position zur Diskussion gestellt werden.
-
2023
Friederike Sigler
13.12.2023 / 18 Uhr
Friederike Sigler, Bochum
Kochen, Putzen, Sorgen. Care-Arbeit in der Kunst seit 1960
Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, 28195 Bremen und via ZoomSeit den 1960er Jahren beschäftigen sich Künstlerinnen aus vielen Teilen der Welt kritisch mit Care-Arbeit. Neben zahlreichen Parallelen zeigen sich auch Unterschiede, zu denen sowohl die künstlerischen Medien und Praktiken als auch die politischen Konzepte von Arbeit und Geschlecht zählen, auf die sich die Künstlerinnen beziehen und innerhalb derer ihre Positionen zu verorten sind. Anhand einer Auswahl von Werken, die Gegenstand der Ausstellung ‚Kochen Putzen Sorgen. Care- Arbeit in der Kunst seit 1960‘ (Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, 22.10.2023–3.03.2024) sind, wird der Vortrag diese Parallelen und Unterschiede vorstellen und dabei die Frage nach einer geopolitisch differenzierten kunsthistorischen Methode diskutieren.
-
2023
Gabu Heindl, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, Drehli Robnik
19.11.2023 / 18 Uhr
Buchpräsentation mit einer Einführung von Drehli Robnik
Gewohnte Gewalt. Häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino, hg. von Drehli Robnik, Joachim Schätz, Wien: Sonderzahl 2022Gespräch
Gabu Heindl, Kassel / Wien
Kathrin Heinz, Bremen
Irene Nierhaus, Wien / Bremen
Drehli Robnik, Wien-ErdbergWeserburg Museum für moderne Kunst, Bibliothek Teerhof 20, 28199 Bremen
Gerade die gewohnte Gewalt dringt nicht „von außen“ ein, sondern wohnt in der Nähe, oft im gemeinsamen Haushalt. Die Filmgeschichte weiß davon: Film-Thriller zeigen vielfach das Heim als Schauplatz einer Gewalt, die von täglichen Nächsten ausgeht. Und die sind meist männlich. Raum-Symptome von Herrschaftsverhältnissen mit Gender-Struktur: Von Hollywoods woman ́s pictures der 1940er bis zum südkoreanischen Welterfolgsfilm Parasite vermitteln domestic thrillers Szenarien der Bedrohung durch männliche Gewalt. Es geht um physische „Ausbrüche“, um Machtansprüche und Verteilungskampf in Sachen Wohnraum – und um manipulatives Gaslighting, wie dies auch in Politik und Gesellschaft wirksam ist. Der Band Gewohnte Gewalt – mit Beiträgen von 50 Autor:innen aus Medien- und Kulturwissenschaft, Aktivismus und Soziologie – untersucht, kritisiert, denkt weiter, wie Spielfilme häusliche Verhältnisse in Spannung versetzen.
-
2023
Nora Sternfeld
13.1.2023 / 18 Uhr
Nora Sternfeld, Hamburg
Commons als KontaktzonenHaus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, 28195 Bremen und via Zoom
Auf der documenta fifteen trat ruangrupa mit einem Projekt an, das die klassische Vorstellung einer „documenta“ herausforderte, indem es anhand des Konzepts „lumbung“ Fragen nach geteilten Res- sourcen und alternativen Ökonomien stellte. Wie viele Theoretiker*innen und Aktivist*innen weltweit betonte die documenta fifteen die performative Dimension der Commons. Die Kunstvermittlerin und Kuratorin plädiert dafür, die Commons nicht nur als fröhliche Zusammenkünfte zu verstehen, sondern auch als Verhandlungsräume und Austragungskontexte von Konflikten: als Kontaktzonen. Als solche definieren Mary Louise Pratt und James Clifford durchaus konfliktuelle Kontexte und Prozesse des Zusammen-Handelns.
Die Vortragende tritt ein für ein Verständnis der Commons als Kontaktzonen, für konfliktfähige Konvergenzen von Kämpfen, die gewohnte und machtvolle Bruchlinien durchkreuzen. -
2022
Susannne Huber
25.10.2022 / 18 Uhr
Buchpräsentation mit Vortrag und Gespräch
Susanne Huber, Bremen
Explizit implizit: Vom Konsum des Begehrens in postmodernen Bildkulturen
GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Teerhof 21, 28199 Bremen
und via ZoomSex sells ist mehr als nur ein Klischee: Feministische Kunstproduktionen in den USA der 1980er Jahre lassen die ökonomischen Bedingungen von hegemonialen Sexualitäts- und Geschlechtermodellen deutlich hervortreten. Situiert im historischen Kontext der Kontroversen um Pornografie und einer Kritik an Darstellungskonventionen in kommerziellen Massenmedien, eröffnen künstlerische Ansätze eigene Perspektiven auf die Ästhetiken der sozialen Bezeichnungsprozesse. Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie Begehren als Schnittstelle dieser Diskurse insbesondere im Umfeld der Appropriation Art aufgerufen ist. Vor dem Hintergrund postmoderner Kulturtheorie und Konsumkritik verweisen die Aneignungen auf normative Differenzkonstruktionen, gesellschaftliche Wertzuschreibungen sowie die formalen Konflikte der Wiederholung.
Die Publikation, in der die Kunstwissenschaftlerin diese Themen untersucht, ist in diesem Jahr unter dem Titel „Vom Konsum des Begehrens. Appropriation Art, Sex Wars und ein postmoderner Bilderstreit“ bei De Gruyter erschienen.
Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst.
-
2022
Anja Zimmermann
21.6.2022 / 18 Uhr
Anja Zimmermann, Oldenburg
Kanon und Aufführung in den Praktiken der KunstgeschichteHaus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, 28195 Bremen und via Zoom
Kunstgeschichte: das sind nicht nur Bücher, Aufsätze, Ausstellungen, sondern auch Gespräche, Gesten und Haltungen. Der Vortrag widmet sich diesen wenig beachteten performativen Anteilen kunsthistorischer Praxis. Dabei steht die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Kanon und Aufführung im Mittelpunkt: Wer spricht über wen? Wer spricht wie? Wer spricht mit wem?
Antworten liefern künstlerische Projekte wie Robert Morris’ Auftritt ‚als‘ Erwin Panofsky (1964), Berichte über Auftritte ‚großer‘ Kunsthistoriker (1928), Erinnerungen an Vorlesungen (2019), Fotografien von Tagungsteilnehmer*innen, die in der Pause schnell einen Kaffee trinken (1948), Anleitungen für einen gelungenen Vortrag (1897) und anderes mehr. Aufeinander bezogen bieten diese Quellen Hinweise auf eine Praxis der Kunstgeschichte, ohne die es keine Theorie gäbe. Die Auflösung des kontrafaktischen Vortragstitels erfolgt am Schluss des Vortrags (oder am Beginn). -
2022
Bernadette Krejs, Monique Miggelbrink, Alexander Wagner, Amelie Ochs, Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach
11.5.2022 / 18 Uhr
Buchpräsentation und Gespräch
Die Wohnzeitschrift als Kaleidoskop – Variationen des ,richtigen‘ Lebens in Bild und TextBuchpräsentation
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.): WohnSeiten: Visuelle Konstruktionen des Wohnens in Zeitschriften, transcript Verlag 2021, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 8Gespräch
Bernadette Krejs, Wien
Monique Miggelbrink, Paderborn
Alexander Wagner, Wuppertal
Amelie Ochs und Rosanna Umbach, BremenWohnzeitschriften zeigen Seite für Seite ideale Wohnräume, Möbel und Dinge, sie vermitteln Einrichtungstipps und liefern Anleitungen zum vermeintlich richtigen Wohnen. Dabei wird Wohnen als erlern- und stetig optimierbar vorgeführt und gleichzeitig Teil gesellschaftlicher und politischer Prozesse und Zuschreibungen. Durch spezifische Zeigestrategien werden Leser*innen als sozial und politisch Agierende, vergeschlechtlichte und konsumierende Subjekte in ihren Wohnweisen adressiert und zum Handeln aufgefordert. Im Gespräch werden Zeitschriften als Diskurs- und Displayformation perspektiviert und auf ihre ästhetischen Strukturen hin analysiert. Im gemeinsamen Blättern durch ausgewählte WohnSeiten verschiedener Zeit(schrift)en diskutieren die Referent*innen die inhaltlichen wie visuellen Dis/Kontinuitäten und medialen Übertragungen der Wohnzeitschrift in andere, beispielsweise digitale Text-Bild-Formate.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem internationalen Forscher*innennetzwerk [wohn]zeitschriften statt.
-
2022
Irene Nierhaus
18.1.2022 / 18 Uhr
Irene Nierhaus, Wien/Bremen
Wohngrenzen. Politiken von Bewohnen und Un/ Sichtbarkeit
b.zb Bremer Zentrum für Baukultur, Am Speicher XI 1, 28217 Bremen
Sichtbarkeit von Wohnen wird oft mit Bildern von Möbeln, Wohnräumen oder Familiengeschichten assoziiert. Als Konsum- und Privatwelten tendieren sie zu Vorstellungen von Wohnen als ‚glücklichem Raum‘ (Bachelard), hinter dem das Prekäre wie auch das Bedingungslose des öffentlich angestrebten, wohlgeordneten Lebens zurückbleibt. Das Verhältnis von Bewohnen und Un/Sichtbarkeit wird auf zwei, letztlich nicht trennbaren Ebenen thematisiert: An Integration und Sichtbarkeit, so in der bevölkerungspolitischen Fixierung der sozialen Klassen, Gruppen und Geschlechter im Wohnen. Und an der Ausgrenzung und Unsichtbarkeit des Prekären, wie den Gefährdungen im Privatraum, dem Wohnen in Obdachlosigkeit, Migration oder bei Zerstörung durch Naturkatastrophen und Kriege.Der Vortrag findet im Rahmen des Ausstellungsprojektes „wohnen³ bezahlbar. besser. bauen. Architektonische Lösungen und künstlerische Interventionen“ (5.12.2021–3.7.2022) statt – ein Ausstellungsprojekt des Hafenmuseums Speicher XI, des b.zb Bremer Zentrums für Baukultur und des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender/Forschungs-feld wohnen+/–ausstellen. Weitere Informationen: www.bezahlbarbesserbauen.net
-
2021
Niloufar Tajeri
14.12.2021 / 18 Uhr
Niloufar Tajeri, Berlin/Braunschweig
Kleine Eingriffe für ein Wohnen in der Postwachstumsstadtb.zb Bremer Zentrum für Baukultur, Am Speicher XI 1, 28217 Bremen
Die Entwurfsmethode des „Kleinen Eingriffs“ präsentiert in Anlehnung an Lucius Burckhardt eine Herangehensweise, die aus der genauen Betrachtung des Vorhandenen in präzise, kleinmaßstäbliche Entscheidungen mündet – und baulich so wenig wie möglich verändert. Wie kann man heute vorhandene Gebäude mit kleinen Eingriffen umbauen? Wie kann man sie beweglicher machen für eine sich verändernde Gesellschaft, ohne ihre Atmosphäre und somit das Fragile, das das „Zuhause sein“ der Bewohnerschaft ausmacht, zu zerstören? Der „Kleine Eingriff“ erweitert Burckhardts Ansatz um Fragen der feministischen Raumpraxis und der Postwachstumstheorie und plädiert für eine andere Art zu gestalten: einer auf soziale und ökologische Gerechtigkeit, Teilhabe und Sorgetragen bedachten Praxis.
Der Vortrag findet im Rahmen des Ausstellungsprojektes „wohnen³ bezahlbar. besser. bauen. Architektonische Lösungen und künstlerische Interventionen“ (5.12.2021–3.7.2022) statt – ein Ausstellungsprojekt des Hafenmuseums Speicher XI, des b.zb Bremer Zentrums für Baukultur und des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender/ Forschungsfeld wohnen+/–ausstellen. Weitere Informationen: www.bezahlbarbesserbauen.net
-
2021
Kathrin Busch
23.11.2021 / 18 Uhr
Kathrin Busch, Berlin
Schwächeln – Selbstgebrauch als WissensformHaus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, 28195 Bremen
Der Vortrag geht von zwei epistemischen Umbrüchen aus: zum einen von den Veränderungen in der zeitgenössischen Kunst, die sich in den aktuellen Debatten um den Begriff der künstlerischen Forschung manifestieren. Zum anderen von einem neuen Gebrauch des Selbst, durch den andere Wissensformen nicht nur intellektuell erschlossen, sondern auch habitualisiert und verkörpert werden. Heutige Selbsttechniken und künstlerische Wissensformen sind aufeinander bezogen. Dabei liegt der Fokus des Vortrags auf Praktiken der Desubjektivierung, Selbstschwächung und Überempfindlichkeit, sofern sie als widerständige ästhetische Wissensformen kultiviert werden. -
2021
Sigrid Ruby
1.6.2021 / 18 Uhr
Sigrid Ruby, Gießen
Die Frau. Das Haus. Das Bild. Von der Geschlechterordnung als einer Heuristik der SicherheitOnline-Vortrag via Zoom
Der Vortrag stellt wesentliche Prämissen und Erkenntnisse aus einem kunsthistorischen Forschungsprojekt vor, das im DFG-Sonderforschungsbereich „Dynamiken der Sicherheit“ die Etablierung des Hauses und der Geschlechterordnung in der Frühen Neuzeit bzw. seit dem frühen 15. Jahrhundert untersucht. Aus fachlicher Perspektive besonders interessant ist hier die „Domestizierung“ der Frau, d.h. ihre erzählerisch, kompositorisch und visuell/rezeptionsästhetisch geleistete Engführung mit dem Haus, die anhand exemplarischer Bildlektüren dargelegt werden soll. In der Kunst der Frühen Neuzeit – so die These – fungierten sowohl das Haus als auch der weibliche Körper (darin) als Schauplätze, mittels derer ein ambivalentes Miteinander von Sicherheitsversprechen und Verunsicherung verhandelt wurde.
-
2020
Sebastian P. Klinger
10.12.2020 / 19 Uhr
Sebastian P. Klinger, New York/Berlin
„Sommeil en bouteille“: Bildwelten von Schlaf und GeschlechtOnline-Vortrag via Zoom
In einem wegweisenden Beitrag zur empirischen Schlafforschung prägte der französische Physiologe Henri Piéron (1913) den Begriff vom „Schlaf in der Flasche“. Er bezeichnete damit das spektakuläre Versprechen, das die Pharmaindustrie denjenigen gab, die auf die moderne 24/7-Gesellschaft mit nervöser Unruhe und Schlaflosigkeit reagierten. Der Vortrag untersucht historische Werbung für Schlaftabletten, Materialien aus der visuellen Kultur, ausgewählte epistemische Genres und Medien der Schlafforschung sowie die literarische Reflexion dieser Praktiken. Er vermittelt zudem, wie Schlafmittel seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Potenzial erreicht haben, Selbstbewusstsein gleichsam zu generieren und zu zerstören. Fragen zu Geschlecht, Handlungsfähigkeit und kulturellen Ängsten gegenüber Produktivität werden dabei zutage treten.
In Kooperation mit der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst im Rahmen der Ausstellung „gerlach en koop. Was machen Sie um zwei? Ich schlafe.“ -
2020
Karin Gludovatz
1.12.2020 / 18 Uhr
Karin Gludovatz, Berlin
Klappen. Zur Topologie des Bildes in der niederländischen Malerei des 15. JahrhundertsOnline-Vortrag via Zoom
Der Vortrag widmet sich ästhetischen Ordnungskriterien, die das Verhältnis von Bildraum und -fläche regeln und den Konflikt zwischen Zwei- und Dreidimensionalität auf pikturaler Ebene versöhnen – als Voraussetzung frühneuzeitlicher Bildproduktion. Er fokussiert auf Interieurs des Flémalle-Kreises, die ein besonderes Interesse an bildimmanenter Bewegung zeigen. Dieses äußert sich einerseits in der Darstellung von Klappen aller Art, andererseits wird die Funktion des Klappens selbst ins Bild gesetzt. Das Klappen lässt sich als Scharnierfunktion verstehen, die Bildtafeln organisieren und Bildwerke performieren konnte, vermittels derer sich innerbildlich aber zugleich das Verhältnis von Raum und Fläche metaphorisieren und präzisieren lässt. Als heuristische Figur verstanden, regelt die Klappe auf verschiedenen Ebenen die Betrachtung und bestimmt damit unter den Konditionen der Beweglichkeit maßgeblich mit, was angesichts steten Wandels als evident verstanden werden kann.
-
2020
Irene Nierhaus
20.11.2020 / 19 Uhr
Irene Nierhaus, Bremen
Weißblende: Zur Ausstattung des Schlafzimmers des Adolf LoosOnline-Vortrag via Zoom
Vorhänge, Fell und Wäsche weiß, der Teppich blau. Adolf Loos radikalisiert 1903 gängige Materialien und Ausstattungen von Schlafzimmern, nimmt ihnen Ornamente und Möbelkonturen, lässt ein verschleiernd Textiles, eine betonte und zugleich poröse Materialität zurück. Das transluzide und fließende weiße All-Over vermittelt ähnlich dem Raum zwischen Wachen und Schlafen Durchlässigkeit und Entgrenzung. Das Schlafzimmer ist auch ein Manifest des schreibenden und disputierenden Architekten, als „Schlafzimmer meiner Frau“ publiziert, ist es in Kampfrhetoriken um ein Ethos der Moderne geflochten. Nah an Text und Bild suchend werden Verweisstellen und Diskursanschlüsse zu De- und Refigurierungen in Gestaltung, Rede und Bild (Sparsamkeit, Disziplinierung, Entgrenzung, Geschlecht, Sexualität) und ihr Imaginäres angesprochen.
In Kooperation mit der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst im Rahmen der Ausstellung „gerlach en koop. Was machen Sie um zwei? Ich schlafe.“ -
2020
Susanne von Falkenhausen
22.1.2020 / 18 Uhr
Susanne von Falkenhausen, Berlin
Was tun mit der Macht der Bilder? Über Identität und ZensurbegehrenUniversität Bremen, SFG 1040
Die heute aktuelle Floskel von der Empörungsgesellschaft findet ihre Anlässe oft in Bildern quer durch die Medien, aber eben auch in der Kunst. Und so ist die Rede von der Macht der Bilder wieder präsent. Die Macht der Bilder ist jedoch eine geliehene, ihnen verliehene, von Individuen und Gesellschaften. Das Phänomen der Kunstskandale ist nicht neu, allerdings haben sich Art und Grad der identitätsorientierten Militanz, welche sich an Bildern entzündet, verändert. Der Vortrag analysiert das Phänomen und nimmt Stellung zu den meist hilflosen Versuchen, es zu erklären und sich ihm gegenüber zu verhalten.
+/-
Workshop zum Vortrag mit
Susanne von Falkenhausen
23. Januar 2020, 15.00–18.00 Uhr
Universität Bremen, GW2 3770
In den letzten Jahren häuften sich die Konflikte um Bilder, die als diskriminierend verstanden wurden. Es gibt also zahlreiche Anlässe, über Identität, Diskriminierung und Zensur in der Kunst nachzudenken. Diskussionsgrundlage sind zwei Arbeiten, die in den letzten Jahren Debatten ausgelöst haben, weil sie Identitäten und ihre Verletzungen radikalpräsentiert haben: Dana Schutz: Open Casket, 2016 und Kara Walker: A Subtlety - an Homage to the unpaid and overworked Artisans who have refined our Sweet tastes from the cane fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the demolition of the Domino Sugar Refining Plant, 2014.
Vortrag und Workshop gehören zum Schwerpunkt privat+/-öffentlich: neue bildmediale Perspektiven (Konzept: Elena Zanichelli) -
2019
Eva Meijer, Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen
26.11.2019 / 18 Uhr
BUCHPRÄSENTATION UND VORTRAG - Vortragsreihe studio
26. November 2019, 18.00 Uhr
Universität Bremen, SFG 1010
Buchpräsentation
Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.)
Heim/Tier. Tier – Mensch – Beziehungen im Wohnen
transcript Verlag 2019, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 6
Tiere und Menschen teilen sich seit jeher ihre Lebensräume. Deutlich zeigt sich dies im Wohnen, wo Tier-Mensch-Beziehungen nicht nur die Gestaltung der Räume, sondern auch die Wohnpraxis wesentlich mitbestimmen. So können Menschen dem lebenden Tier ein Heim geben, umgekehrt kann aber auch das tote Tier als präparierter Tierkörper oder als textile Wohn- und Oberflächengestaltung Teil des Interieurs werden. Die Beiträge des Buches untersuchen mögliche Arten der Einbindung des Tierlichen in Haus und Wohnung und verknüpfen hierzu Ansätze aus dem Bereich der kunst- und kulturgeschichtlichen Wohnforschung mit zentralen Positionen der Human-Animal Studies. Auf diese Weise wird das behauste Wohnen als vermeintlich genuin menschliche Kulturpraxis hinterfragt und neu perspektiviert.
Vortrag
Eva Meijer, Amsterdam
Thinking with birds and dogs in the home: Toward a multispecies philosophy
In order to overcome human bias and challenge anthropocentrism, we need to foreground nonhuman animal agency and voices by, among other scientific approaches, studying more-than-human animals in their habitats. The talk focuses on research that takes place in multispecies households as in the work of a) Len Howard, who studied the behavior of songbirds in and around her cottage in the 1950’s, b) dog trainer and philosopher Vicki Hearne’s work, and c) Meijer’s own political philosophical work with dog companions Doris and Olli. She investigates the meaning of ‘home’ on two levels: the actual home, where humans and other animals build common lifeworlds, and being at home in the world, i.e. how this type of research can contribute to changing larger social and political relations, making the human dominated world more of a home for the other animals. -
2019
Kirsten Wagner
29.10.2019 / 18 Uhr
Kirsten Wagner, Bielefeld
Theorien und Praktiken des WohnensUniversität Bremen, SFG 1010
Im 19. Jahrhundert wird das Wohnen diskursiv. Noch bevor die Architektur den allgemeinen, nicht auf das Stadthaus oder die Villa beschränkten Wohnungsbau als Aufgabe (an)erkennt, setzen sich die Humanwissenschaften mit dem Wohnen in seiner vernakulären Ausprägung auseinander. Stehen bei der Beschäftigung mit dem Wohnen lange Zeit die materiellen Wohn- und Siedlungsformen in ihrer Wechselwirkung mit sozialen Strukturen im Vordergrund, führt erst die Theoriebildung zum Wohnen in Philosophie und Soziologie dazu, die vielfältigen Praktiken des Wohnens zu untersuchen. Aus den Fragen nach den Orten und Formen des Wohnens wird die Frage, was die Bewohner*innen faktisch tun, wenn sie wohnen – und sich dabei notorisch der Askese funktionalen Wohnungsbaus und einer modernen Wohndidaktik entziehen. Der Vortrag thematisiert ebendiese Diskursverschiebung von den Räumen zu den Praktiken des Wohnens.
-
2019
Beatriz Colomina
11.6.2019 / 18 Uhr
VORTRAG - Vortragsreihe studio
Beatriz Colomina, Princeton
X-Ray ArchitectureGästehaus der Universität Bremen
Teerhof 58, 28199 Bremen
This lecture explores the impact of medical discourse and imaging technologies on the formation, representation and reception of twentieth-century architecture. It challenges the normal understanding of modern architecture by proposing that it was shaped by the dominant medical obsession of its time: tuberculosis and its primary diagnostic tool, the X-ray. Modern architecture and the X-ray were born around the same time and evolved in parallel. While the X-ray exposed the inside of the body to the public eye, the modern building unveiled its interior, dramatically inverting the relationship between private and public. Architects presented their buildings as a kind of medical instrument for protecting and enhancing the body and psyche.Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt privat+/-öffentlich: neue bildmediale Perspektiven (Konzept: Elena Zanichelli)
-
2019
Bettina Uppenkamp
21.5.2019 / 18 Uhr
Bettina Uppenkamp, Hamburg
Zwischen piazza und camera. Die italienischen Hochzeitstruhen des 15. JahrhundertsUniversität Bremen, SFG 1040
Ausgehend von Funktion und Dekoration der italienischen Hochzeitstruhen des 15. Jahrhunderts, den sogenannten cassoni, geht der Vortrag den sozial und geschlechtsspezifisch codierten Räumen in der Stadt der Renaissance nach. Stellt man die Frage danach, wie sich die Geschlechterordnung der Frühen Neuzeit in Italien mit einer Kultur des Visuellen verknüpfte, lassen sich die cassoni als eine Art Knoten im kulturellen Gewebe zwischen öffentlich und privat auffassen. Als Behältnis für den Teil der Mitgift, den die Bräute als ihre Aussteuer aus ihrem Elternhaus in das ihres Bräutigams mitbrachten, fanden sie ihren Platz in der camera, dem Schlafzimmer und räumlichen Nukleus des neugegründeten Haushaltes und erinnerten dauerhaft an den Gründungsakt der Ehegemeinschaft und den Beitrag, den die Braut in diese Gemeinschaft eingebracht hatte.+/-
Workshop mit Bettina Uppenkamp
Universität Bremen, GW2, B3850
Der Workshop wird in Anknüpfung an den Vortrag am Beispiel von Florenz, ausgehend von der häuslichen Ausstattung im 15. Jahrhundert, den Blick in den Stadtraum richten und einen erweiterten Einblick in die visuelle Kultur der frühen Renaissance in Italien geben.Vortrag und Workshop gehören zum Schwerpunkt privat+/-öffentlich: neue bildmediale Perspektiven (Konzept: Elena Zanichelli)
-
2019
Alexia Pooth
22.1.2019 / 18 Uhr
Alexia Pooth, Berlin
Experiment mit Hausordnung: Die Bauhaus Residenz in den Dessauer MeisterhäusernUniversität Bremen, SFG 1040
Die Meisterhäuser von Walter Gropius avancierten in den 1920er Jahren zum Inbegriff für modernes Wohnen und individuelles Künstlerleben. Tür an Tür lebten hier die Bauhausmeister mit ihren Familien, bis 1932 die künstlerische Produktion abbrach. Mit ihrem Künstlerresidenzprogramm ermöglichte es die Stiftung Bauhaus Dessau 2016-18 jungen Künstler_innen, die Häuser auf ihre Aktualität hin zu testen. Indes: Wie residiert es sich im Denkmal, wie viel Moderne steckt 100 Jahre nach Gründung des Bauhauses noch in den Häusern und kann mit einem artist-in-residence-Programm die ursprüngliche Funktion des Areals als Künstlerkolonie wiederbelebt werden? -
2018
Elisabeth Fritz, Katharina Eck
19.11.2018 / 18 Uhr
BUCHPRÄSENTATION UND VORTRAG - Vortragsreihe studio
19. November 2018, 18.00 Uhr
Universität Bremen, SFG 1040
Buchpräsentation
Katharina Eck, Bremen/Marburg
Tapezierte Liebes-Reisen. Subjekt, Gender und Familie in Beziehungsräumen des frühindustriell-bürgerlichen Wohnens
Französische Bildtapeten aus der Manufaktur Dufour fanden seit dem frühen 19. Jahrhundert in Interieurs in ganz Europa als begehrtes Ausstattungsobjekt Verwendung – vor allem in bildungsbürgerlichen Haushalten. Das Buch widmet sich der Analyse dieser großformatigen Tapetenszenen und spürt den Subjektivierungsformen, Paarbildungsdidaktiken und einem „In-Beziehung-Setzen“ der Bewohner_innen mit den tapezierten Räumen nach.
transcript Verlag 2018, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 4
+/-
Vortrag
Elisabeth Fritz, Jena
Beziehungsgeflechte. Geselligkeit und Geschlecht in Antoine Watteaus fêtes galantes
Szenen der geselligen Unterhaltung im Freien, wie sie uns in der bürgerlichen Wohnkultur auf Tapeten, Porzellan und Möbeln begegnen, referieren oft auf das von Antoine Watteau im frühen 18. Jahrhundert entwickelte Motivrepertoire der fête galante. Der Vortrag beleuchtet das in dieser besonderen malerischen Gattung vorgeführte soziale und geschlechtliche Rollenspiel. Ausgehend von Bezügen zur zeitgenössischen Spektakelkultur werden insbesondere die im Bild auftretenden Spannungsmomente bei der Paar- und Gruppenbildung sowie ihre imaginativen und ästhetischen Potenziale untersucht.
+/- -
2018
Sabine Plakolm-Forsthuber
10.4.2018 / 19 Uhr
Sabine Plakolm-Forsthuber, Wien
Der Steinhof in Wien – ein ambivalenter Ort der Ab- und AusgrenzungUniversität Bremen, SFG 2010
Die um 1900 errichteten Nervenheilanstalten wollten, in Wien und anderswo, erstmals eine nach dem damaligen Stand der Wissenschaft menschenwürdige Betreuung und Unterbringung psychisch Erkrankter gewährleisten. Der Vortrag thematisiert, wie das architektonische Modell der Zeit, das Pavillonsystem, eingesetzt wurde, um die Separierung nach Geschlecht, Krankheitsbild und nach sozialen Klassen zu ermöglichen. Weiter wird danach gefragt, wie die Orte der Therapie, der Mehrbett-Krankensaal sowie die Tag- und Außenräume gestaltet wurden. Die mit Kirche und Park versehene Anlage Am Steinhof reproduziert innerhalb der Mauern die Metropole im Kleinen, im Zerrspiegel von normal/krank.
Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Unbehaust Wohnen in Forschung und Lehre. -
2018
Monika Ankele
23.1.2018 / 19 Uhr
Monika Ankele, Hamburg
Das Krankenbett als BeziehungsraumUniversität Bremen SFG 1040
Als um 1900 die sogenannte Bettbehandlung in die Psychiatrie eingeführt und das Krankenbett zu einem therapeutischen Hilfsmittel erklärt wurde, veränderte sich auch für die PatientInnen die Bedeutung, die dem Bett bis dahin zugekommen war: untergebracht in gemeinsamen Krankensälen, in denen sich ein Bett an das andere reihte, und dazu angehalten, über Wochen und Monate das Bett zu hüten, wurde dieses für die PatientInnen zunehmend zu einem Beziehungsraum, der spezifische Formen der Aneignung evozierte, wie der Vortrag zeigen wird. -
2017
Rixt Woudstra
7.11.2017 / 19 Uhr
Rixt Woudstra, Cambridge, MA
Public Housing on DisplayUniversität Bremen SFG 1040
While the explicit aestheticization of modern architecture during MoMA’s first decade of exhibitions is well known, is too often forgotten that this interpretation was countered from the beginning by exhibitions advancing an understanding of architecture that emphasized its social effects. Coinciding with America’s first large-scale public housing projects as part of the New Deal, curators such as Catherine Bauer installed several shows advocating for public housing. This lecture explores how the museum was instrumental in introducing and promoting the concept of public housing to the American public during the 1930s. -
2017
Alexandra Staub
30.5.2017 / 19 Uhr
Alexandra Staub, Penn State University (USA)
Gleichmacherei: Warum die Genderwahrnehmung in der Architekturtheorie unerlässlich istUniversität Bremen, GW2, B 3850
Die Architekturtheorie wird überwiegend als geschlechtlich neutral dargestellt, jedoch zeigt schon die Analyse von Inhalten und Vermittlungsformen, dass die in der Lehre gängigen Architekturtheorien überwiegend männliche Erfahrungen widerspiegeln. Im Vortrag wird untersucht, wie eine Architekturtheorie mit Berücksichtigung von Gender aussehen könnte und welche Vorteile eine solche Herangehensweise bringt. -
2017
Carsten Ruhl
25.4.2017 / 19 Uhr
Carsten Ruhl, Frankfurt am Main
Ein Haus wie Ich. Autobiographie und ästhetische Erfahrung in der Architektur des 19. JahrhundertsUniversität Bremen, GW2, B 3850
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Möglichkeit autobiographischer Räume in der Architektur. Ausgehend von der aktuellen Diskussion über Häuser als Verkörperung ihrer Besitzer wird danach gefragt, inwiefern sich mit architektonischen Mitteln Autobiographien herstellen lassen und welche spezifischen Zielsetzungen damit verbunden sind. Anstatt auf ein modernes Beispiel zurückzugreifen, wird der Zusammenhang zwischen Raum und autobiographischer Selbstinszenierung bewusst anhand des im 19. Jahrhundert gegründeten Sir John Soane's Museum in London diskutiert. -
2017
Sabine Pollak
17.1.2017 / 19 Uhr
Sabine Pollak, Linz/Wien
Die Gesetze der Gastfreundschaft. Praktiken des PrivatenUniversität Bremen, GW2 B 3850
Nichts ist beständiger als das Konzept des Privaten. So scheint es zumindest. Tatsächlich wird das Private mehr und mehr von Öffentlichkeit durchdrungen und Privatheit ist im Begriff, in eine Post-Privatheit überzugehen. Wie ist das mit den Praktiken, die seit jeher das private Wohnen bestimmten? Was machen wir in post-privaten Räumen? Welche Rituale sind neu, welche widersetzen sich Veränderungen? -
2016
Hanne Loreck, Irene Nierhaus, Kathrin Heinz
22.11.2016 / 19 Uhr
BUCHPRÄSENTATION UND VORTRAG
Universität Bremen, GW2, B 3850
BUCHPRÄSENTATION
Irene Nierhaus und Kathrin Heinz (Hg.)
Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur, Bielefeld: transcript, 2016
Band 3, Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen
Die Matratze ist Grundelement des Wohnens, jenes Ding unseres Alltags, auf dem wir schlafen, lieben, faulenzen, träumen, gesunden und sterben. Sie ist Inbegriff von Intimität und Körperlichkeit und zugleich Agentin von Normierungen in Subjektivierungsprozessen und sozialen Beziehungen. Die Matrize dient in diesem Band als Theoriefigur, um die Matratze und die mit ihr verbundenen Prägevorgänge und Wissenskomplexe am vermeintlich privatesten Ort zu betrachten.
VORTRAG
Hanne Loreck, Hamburg
Ambivalenzen der Sichtbarkeit im öffentlichen Raum
Während sich an öffentlichen Orten mehr und mehr Kameras auf uns richten und visuelle Daten zur realen oder, nicht weniger fragwürdig, zur potenziellen Kontrolle akkumulieren, mithin das Subjekt seine ‚Sichtbarkeiten’ nicht wählen kann, haben Künstler*innen wie knowbotiq Konzepte wie die „opake Präsenz“ in Performances mit einer Figur (McGhillie) im Tarnanzug entwickelt. Ausgehend von diesen und anderen künstlerischen Aktionen untersucht der Vortrag optische und politische Muster, das Sichtbarkeitsdiktat zu unterbrechen und wirft dazu ebenso einen Blick in die Kolonialgeschichte wie auf die Genese der Camouflage um 1900.
+/-
Die Buchpräsentation Matratze/Matrize: Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und Architektur bei der Österreichischen Gesellschaft für Architektur findet am 15. November 2016 um 19.00 Uhr mit einem Vortrag der Herausgeberinnen statt.
Ort: Räume der IG-Architektur, Gumpendorferstrasse 63b, 1060 Wien -
2015
Birgit Johler
1.12.2015 / 19 Uhr
Birgit Johler, Wien
Freud’s Dining Room. Möbel bewegen ErinnerungUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Fünf bemalte Möbelstücke ländlich-alpiner Herkunft bilden den Nukleus der aktuellen Ausstellung Freud’s Dining Room im Wiener Volkskundemuseum. Anna Freud nahm die Stücke 1938 bei ihrer Flucht aus Österreich in die Emigration mit. Die Ausstellung fragt nach der Bedeutung der Truhen und Kästen für ihre ehemalige Eigentümerin in deren unterschiedlichen Lebenssituationen und -stationen. Auf Grund ihrer „Biografie“ verbleiben die Originale im Freud Museum London; Substitute übertragen die Stücke, ihre Geschichte und auch den Ort, an dem sie sich befinden, nach Wien. -
2015
Annette Tietenberg
2.6.2015 / 19 Uhr
Annette Tietenberg, Braunschweig
Kreativ wohnen. Mediale Selbstentwürfe in Internet-BlogsUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Angesichts der Verschiebungen, die Kategorien wie ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ im digitalen Zeitalter erfahren haben, stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln heute im Interieur „die Perspektive des Subjekts, sein Verhältnis zu sich wie zur Welt“ (Beate Söntgen) zur Anschauung gebracht werden. Die Referentin untersucht Interieurfotografien, die in Internet-Blogs (wie z.B. The Selby) kursieren, auf ihren Vorbildcharakter und interpretiert sie als mediale Selbstentwürfe, deren Wirkungsmacht aus einem Wechselspiel von Sehen und Gesehenwerden resultiert. Welche Bild- und Einrichtungspraktiken finden Anwendung, um zu zeigen, wie die Wohnung eines Kreativen zu Beginn des 21. Jahrhunderts auszusehen hat? -
2015
Ela Kaçel
19.5.2015 / 19 Uhr
Ela Kaçel, Istanbul
Arbeiterwohnheime: Spaces and Identities of Migration in CologneUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Upon their first arrival to Germany as guest workers, Turkish men immediately stepped into the alienating conditions of spaces where migrants worked, lived and socialized by absorbing some of these into their identities. Drawing on the example of Ford AG workers living in the modern high-rise dormitories on the periphery of Cologne in the 1960s, the lecture will highlight the relation between constructing new identities and perceiving spaces of inhabitation as migrants and analyze the visual representation of such relations in migrants’ own snapshots and the professional photographers’ studies of migrants’ experiences of dwelling in the city. -
2014
Gerda Breuer
9.12.2014 / 19 Uhr
Gerda Breuer, Aachen / Wuppertal
Gut wohnen! Zur Identität von Wohn- und Lebenskonzepten nach 1945Universität Bremen, GW 2, B 3850
1965 zog der jüdische Philosoph Theodor W. Adorno vor dem Deutschen Werkbund rückblickend eine düstere Bilanz über den Funktionalismus der Nachkriegsmoderne. Dagegen standen hochgradig ethisch aufgeladene Konzepte der Gestalter von einem „guten Leben“, die sie am Beispiel von Wohnen in bedeutenden Ausstellungen von 1955–1959 vor Augen führten. Im Vortrag werden exemplarisch Reflexionen vor allem in Bezug auf eine Veränderung des Alltagslebens erörtert, die Architekten und Designer gegen die Traumata der jungen Vergangenheit wendeten. -
2014
Annelie Lütgens
11.11.2014 / 19 Uhr
Annelie Lütgens, Berlin
WohnRaumKunst: sachlich – magisch – soziologisch?Universität Bremen, GW 2, B 3850
Der Vortrag konzentriert sich auf drei zeitgenössische Positionen, die Wohnraum und Lebensumwelt zum Ausgangspunkt für künstlerische Untersuchungen, Inszenierungen oder Objekte machen. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob und wie die Künstlerinnen Andrea Zittel (geb. 1965), Alexandra Ranner (geb. 1967) und Pia Lanzinger (geb. 1970) mit ihren jeweiligen Projekten zu Raumsituationen, Wohnobjekten und Wohngeschichten mit den Besuchern im Museum kommunizieren. -
2014
Barbara Thiessen
21.1.2014 / 19 Uhr
Barbara Thiessen, Landshut
Löffel. Windel. Sessel: Wer sorgt für wen? Intersektionelle Beziehungen und WohnenUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Das Familienleben hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verändert. Neu verhandelt wird, wer für Versorgung, Erziehung, Pflege zuständig ist. Entlang der Verschiebungen bezogen auf gender-class-race zeigen sich neue Diskursivierungen von Familie, Mutter- und Vaterschaft, Kindheit und Alter. Untersucht werden Familienverhältnisse unter den Bedingungen neoliberaler Selbstoptimierung, hoher Flexibilitäts- und Mobilitätsansprüche, die ihren Niederschlag in Wohnformen, Interieurs und Haushaltsführungen finden. -
2013
Katia Frey, Eliana Perotti
12.11.2013 / 19 Uhr
Katia Frey, Eliana Perotti, Zürich
Von der Verwandtschaft zwischen Haushalt und Städtebau. Annäherungen an eine Metapher und ihre RealitätUniversität Bremen, GW 2, B 3770
Mit seinem Bild der Stadt als großes Haus und des Hauses als kleiner Stadt begründete der Architekturtheoretiker Leon Battista Alberti in der Frühen Neuzeit eine strukturelle Analogie zwischen Haushaltsführung und Städteplanung, die bis in die städtebauliche Traktatliteratur des 20. Jahrhunderts hineinwirkte, so wenn beispielweise 1923 der britische Architekt Stanley Davenport Adshead die Manchester Industrieregion als ein Wohnhaus mit Küche, Vorratskammer und Wohnstube beschreibt. Umgekehrt werden der Haushaltsführung dem Städtebau vergleichbare Aufgaben zugeordnet, wie dem Wohl der Bewohner/innen zu dienen. Der Vortrag befasst sich ausgehend von dieser Verwandtschaft mit städtebaulichen Diskursen und den darin verhandelten Rollen und Kompetenzen von Frauen im 19. und 20. Jahrhundert.Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Haushaltungen-Ökonomien-Wohnen.
-
2013
Gudrun M. König
7.5.2013 / 19 Uhr
Gudrun M. König, Dortmund
Kaufrausch: Zur Geschichte der KonsumentinUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Der Zeitraum um 1900 kann als Phase modernen Kaufenlernens bezeichnet werden. Diese Erziehung zum Konsum nutzte zwei medikalisierte, partiell kriminalisierte und emotionalisierte Verhaltensmodalitäten, den Kaufrausch und den Warenhausdiebstahl, um das Nichtgelingen "richtigen" Kaufhandelns zu thematisieren. Im Vortrag geht es um die Strategien der Konsumerziehung, die insbesondere die Konsumentin im Blick hatten. -
2013
Peter Mörtenböck
9.4.2013 / 19 Uhr
Peter Mörtenböck, Wien/London
Wohnen im Haushalt der MärkteUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Die Ordnung des Hauses lässt sich mit Giorgio Agamben als eine an ökonomischen Prinzipien orientierte Verwaltung von Dingen, Praktiken, Individuen, Infrastrukturen und Reichtümern beschreiben. Der Vortrag spürt dieser Ordnungsfigur nach und unterscheidet dabei drei immer weiter verbreitete "Wohnformen" unserer Zeit: das Hausen auf informellen Marktplätzen; das Haushalten mittels informeller Märkte; und den Haushalt als eine Ökonomie der Macht. -
2013
Manfredo di Robilant
28.1.2013 / 19 Uhr
Manfredo di Robilant, Turin
The Dolls House syndrome. Residential architecture in the midst of the 20th century in North America and the perspective from aboveUniversität Bremen, GW 2, B 3850
The perspective from above was frequently used in representations of domestic interiors in American home and architectural magazines of the 1930s-1950s. Often including the inhabitants, many of the images were miniaturizing the home to the scale of a dolls house. The talk discusses how the view from above reflects the relationship between technology and domesticity, foregrounding the architect-client relationship and gender issues. -
2013
Michael Müller
14.1.2013 / 19 Uhr
Michael Müller, Bremen
„Seien wir auf der Hut vor jedem Ornament!“Universität Bremen, GW 2, B 3850
Das Ringen um die Bedeutungen des Ornaments sind fester Bestandteil des Modernediskurses. Der Vortrag wird auf Zuschreibungen eingehen, die das Ornament vom rein Dekorativen über das kriminalisierte Zeichen auf der Haut bis hin zum sinnlich Subversiven auszeichnen, und fragen, ob wir heute angesichts einer universellen Ästhetisierung der Lebensverhältnisse von einem untergeordneten, ästhetisch Nebensächlichem als dem potentiell Anderen noch ernsthaft sprechen können. -
2012
Peter J. Schneemann
15.5.2012 / 19 Uhr
Peter J. Schneemann, Bern
Betrachtungs- oder Handlungskontext? Strategien des inszenierten Raumes in der Kunst der GegenwartUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Der Vortrag diskutiert Modi und Funktionen des inszenierten Raumes in der jüngeren Installationskunst. Handlungsfelder der Gesellschaft werden mittels ikonologischer, memorialer und narrativer Referenzen innerhalb der künstlerischen Innenräume angeboten. Die Rezipienten werden in den fragmentierten Interieurs zu Protagonisten.
-
2012
Doris Guth
24.4.2012 / 19 Uhr
Doris Guth, Wien
Wohnen und Lieben! Architektur und Heteronormativität in Baumessen und WerbungenUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Auf aktuellen Baumessen und in Bauwerbungen wird mit Phantasien von idealen Paaren und heilen Familien Wohnen als Refugium des Privaten beworben. Mit Blick auf die Wechselwirkung zwischen Wohnen und „Lieben“ analysiert der Vortrag, wie dabei Heteronormativität hergestellt wird und zum Wohnen erzogen wird. Welche Bilder des Wohnens, welche des „Liebens“ werden vermittelt? Gibt es Ansätze für queeres housing? -
2011
Elena Zanichelli
13.12.2011 / 19 Uhr
Elena Zanichelli, Berlin
Rhetoriken des Privaten dies- und jenseits des des Ausstellungsraums der 1990er Jahre: Monica Bonvicini und Félix Gonzáles-TorresUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Öffentliche Geständnisse, nackte Tatsachen, Privatbilder und -räume: Das „Private“ hatte im Ausstellungsraum der 1990er Konjunktur. Basierend auf mehr oder minder expliziten Subjektdarstellungen versprach eines Suggestionsmechanismus Einblicke ins Private. Ausgewählte Bilder aus dieser Dekade beleuchten, dass es sich mehr um Bilder des Privaten als um Privatbilder handelt: Indem sie sich, ausgehend von kulturell-geschlechtsspezifischen Codierungen des Privatraums, jeweils Rhetoriken des Privaten bedienen, verweisen sie mitunter auf Ambivalenzen des Trennungsdispositivs „privat vs. öffentlich“ selbst. -
2011
Susanne Deicher
8.11.2011 / 20 Uhr
Susanne Deicher, Wismar
Wohnen in Beziehung. Das Utrechter Rietveld-SchröderhuisUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Einer der bekanntesten Bauten der Moderne ist das Rietveld- Schröderhuis, erbaut 1924 von Gerrit Rietveld und Truus Schröder-Schräder. Die Auftraggeberin und Mietentwerferin war Anhängerin Maria Montessoris. Im Entwurf des Hauses verbanden sich die Stiltheorie Piet Mondrians, der Stil als Beziehung definierte, mit der pädagogischen Konzeption eines lernenden Spiels mit den einfachsten Dingen. Im Schröderhuis gewann die handlungspraktische Dimension des Stilbegriffs der abstrakten Moderne Gestalt. -
2011
Gabu Heindl
7.6.2011 / 19 Uhr
Gabu Heindl, Wien
Waschküchen-Urbanismus / Lern-Landschaften / Schaf-Boxen: Zur Ästhetik von Wohn- Arbeit
Ausgehend von einer Unterscheidung zwischen früherer Lohnarbeit mit ihren Platzzuweisungen und Raumtrennungen und heutiger, oft unbezahlter „Wohn-Arbeit“, bei der die scharfe Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsräumen wegfällt, lässt sich anhand neuer Raumtypen wie Waschküchen, Lern-Landschaften, Schaf-Boxen eine Ästhetik deregulierten Alltags diskutieren.Der Vortrag fand in Kooperation mit der internationalen Konferenz Räume der Vermittlung. Ästhetische Prozesse zwischen Alltag und Kunst statt, 6.-9.6.2011, Universität Bremen.
-
2011
Jennifer John
7.6.2011 / 19 Uhr
Jennifer John, Zürich
Geographien des Museums. Geschlechtliche Codierung von Ausstellungen und SammlungenGW 2, Raum B 3850
Untersucht wird, wie museale Strategien der Auswahl, Zusammenstellung oder Platzierung von Exponaten in den Ausstellungsräumen eine kunsthistorische Wissensordnung (re)produzieren. Am Beispiel der Hamburger Kunsthalle geht der Vortrag insbesondere den Einschreibungen von Geschlecht in dieses Ordnungssystem nach.Der Vortrag fand in Kooperation mit der internationalen Konferenz Räume der Vermittlung. Ästhetische Prozesse zwischen Alltag und Kunst statt, 6.–9.6.2011, Universität Bremen.
-
2011
Regina Wonisch
17.5.2011 / 19 Uhr
Regina Wonisch, Wien
Verbürgerlichung der Lebenskultur – zur Ausstellung „Die Frau und ihre Wohnung“ in WienGW 2, Raum B 3850
Mit der Propagierung bürgerlichen Familienideologie wurde in den 1950er Jahren auch eine „zeitgemäße“ Wohnkultur befördert. Eine der wirkungsvollsten Initiativen war die Möbelausstellung „Die Frau und ihre Wohnung“ im Wiener Messepalast. Der Vortrag untersucht, wie sich in dieser Ausstellung der Zusammenhang von Wohnkultur und geschlechterspezifischen Zuschreibungen manifestiert.
-
2011
Christine Threuter
19.4.2011 / 19 Uhr
Christine Threuter, Trier
Ausschlüsse des Unerwarteten: Herlinde Koelbls Fotobuch „Das deutsche Wohnzimmer“ (1980)GW 2, Raum B 3850
In ihrem Fotoband unternimmt Herlinde Koelbl einen „Streifzug“ durch deutsche Wohnzimmer. Dabei geht es um nichts weniger als die Forderung nach einer „wahrhaften Wohnkultur“ als gesellschaftlichem bzw. Nationalem Anliegen. Der Vortrag analysiert die intertextuelle Bildrhetorik des Buches und hinterfragt den großen Erfolg der Fotografin.
-
2011
Andreas K. Vetter
25.1.2011 / 19 Uhr
Andreas K. Vetter, Detmold
„Elemente die fähig sind, auf unsere Sinne zu wirken.“ Über kreative Strategien in der Wohnarchitektur der klassischen ModerneUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Viele Avantgarde- Architekten der 1920er und frühen 1930er Jahre – wie etwas Le Corbusier – prägte eine zeittypische Haltung: Architektur wird als faszinierendes Instrument zur Ausprägung eines neuen „modernen“ Menschentyps verstanden. Der Vortrag widmet sich jenen Strategien, die sich sowohl künstlerisch als auch philosophisch verhalten, die sich den biologischen Grundbedingungen der humanen Existenz ebenso zuwenden wie damals neuartigen technischen Möglichkeiten. Der Fokus wird auf der Betrachtung der Wohnarchitektur liegen, insbesondere wegen ihrer unmittelbaren und psychologischen engen Beziehungen zum Nutzer. Mit welchen architektonischen Mitteln wird gearbeitet? Inwiefern erweitert sich hierbei das Spektrum der Gestaltung, werden eventuell Taktiken und Techniken der Bildenden Kunst mit einbezogen? Den Abschluss bilden Reflexionen dieser progressiven Avantgarde im Wohnbau der folgenden Jahrzehnte und in Konzepten unserer Gegenwart.
-
2010
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz
14.12.2010 / 19 Uhr
Irene Nierhaus und Kathrin Heinz
Eröffnungsveranstaltung der studio-Reihe mit BuchpräsentationLandschaftlichkeit. Forschungsansätze zwischen Kunst, Architektur und Theorie, hg. von Irene Nierhaus, Josch Hoenes und Annette Urban, Berlin: Reimer 2010
Landschaft umfasst nicht nur die Raumbildung der Natur, sondern auch Raumbildungen für kulturelle und gesellschaftliche Ordnungen. Die Autoren dieses Buches betrachten den Begriff Landschaft aus kunst- und kulturwissenschaftlicher Perspektive sowie aus der Sicht der Architekturgeschichte/-theorie und Philosophie. Dabei untersuchen sie u. a. das Verhältnis von Raum- und Körperbildern, von Subjektbildung und Gemeinschaftsvorstellungen sowie von visuellen Repräsentationen und geplanten oder realisierten Raum(an)ordnungen.
In der Kuvert-Reihe werden aktuelle Debatten im Feld der kunst- und kulturwissenschaftlichen Geschlechterforschung aufgegriffen. Seit 2013 werden regelmäßig Künstler*innen zu Vorträgen eingeladen, deren künstlerische Positionen hervorragende diskursive Anschlussstellen und konzeptionelle Verschränkungen zum Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen bieten. Mit den Vorträgen verbindet sich das Anliegen, künstlerisches Denken und die Auseinandersetzung mit diesem stärker in die Forschungs-, Lehr- und Vermittlungspraxis zu integrieren.
Die Kuvert-Reihe wird veranstaltet von der Forschungsgruppe wohnen+/–ausstellen in Kooperation mit dem Forschungskolloquium für Kunstwissenschaft und Visuelle Kultur Bild-Raum-Subjekt
-
2025
Silke Nowak
8.7.2025 / 18 Uhr
Silke Nowak (Berlin)
Klassenfragen in KunsträumenGalerie Herold, Güterbahnhof Bremen – Areal für Kunst und Kultur
Beim Handelsmuseum 9, 28195 Bremen
Silke Nowak ist Künstlerin, Kunstvermittlerin und Betreiberin des Projektraums Schneeeule. Als Mit-Initiatorin der Ausstellung Klassenfragen. Kunst und ihre Produktionsbedingungen (Berlinische Galerie, 2022/23) eröffnet sie klassismuskritische Perspektiven auf Bereiche von Kunst und Teilhabe, die auch im Vortrag diskutiert werden. In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich mit Grenzen, Macht- und Besitzverhältnissen. Dabei geht sie der zentralen Frage nach, wie diese räumlich sichtbar werden. In ihren Zeichnungen zeigen unterschiedliche Elemente, die mit der Reglementierung von Raum durch Architektur einhergehen, beispielsweise Zäune und Mauern: Welche Bereiche sind begehbar, welche sind blockiert? Um dies auch körperlich erfahrbar zu machen, übersetzt die Künstlerin Elemente aus den Zeichnungen als installative Arbeiten in den Ausstellungsraum.
Daran schließt sich ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Klassismus an. In ihren interviewbasierten Kunstprojekten Anders Wohnen (2023) und Klassenarbeit (im Entstehen) gibt Silke Nowak den Geschichten von Betroffenen Raum und spricht mit Menschen aus der Armuts- und Arbeiter*innenklasse über ihre (Wohn-)Erfahrungen. Die Arbeit Anders Wohnen wird im Rahmen der Ausstellung Wohnen mit Klasse in der Galerie Herold, Bremen ausgestellt und eröffnet über das Zusammenspiel aus Interviewsequenzen und den architektonischen Betonobjekten der Künstlerin einen Dialog über Wohnen und Klassismus. -
2024
Anne Glassner
10.12.2024 / 18 Uhr
Anne Glassner (Wien)
SchlafräumeSFG, Raum 2010, Universität Bremen, Enrique-Schmidt-Straße 7, 28359 Bremen
Anne Glassner beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis, die Performances, Videos, Installationen und Zeichnungen umfasst, mit wiederkehrenden und alltäglichen Handlungen. Das Thema Schlaf ist seit geraumer Zeit ein Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit, dem sie u.a. in Schlafperformances und inszenierter Fotografie nachgeht. Befragt werden die Bedingungen von Aktivität und Inaktivität und von Produktivität und Unproduktivität sowie die Grenzziehungen zwischen Privatem und Öffentlichem. Glassners Arbeiten sind nicht nur Momentaufnahmen, sondern Archive der Vergänglichkeit, die in den Betrachter*innen eigene Erinnerungen und Träume wecken sollen. Durch ihre Inszenierungen lenkt die Künstlerin den Blick auf die uns umgebende Welt und eröffnet neue Perspektiven. Die Frage nach Selbst- und Fremdwahrnehmung steht dabei im Zentrum.
In ihrem Vortrag gibt Anne Glassner Einblicke in Projekte, die sich mit den Themen Körper, Schlaf und Raum befassen. Ein Fokus wird auf die kollektive Intervention Sensing the Night in der Villa Tugendhat in Brno 2021 gerichtet wie auf ihren Arbeitsprozess im VALIE EXPORT CENTER 2023 in Linz. -
2024
Johanna Kühne
30.1.2024 / 18 Uhr
Johanna Kühne, Berlin
„Zwangsräume“ – Antisemitische Wohnpolitik in Berlin 1939-1945
Galerie K', Alexanderstr. 9b, 28203 Bremen
Ab 1939 musste fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Berlins ihre Wohnungen verlassen und zwangsweise umziehen. Jüdinnen*Juden wurden als Untermieter*innen in Wohnungen eingewiesen, in denen bereits andere jüdische Mieter*innen lebten. Zumeist waren die Zwangswohnungen der letzte Wohnort vor ihrer Deportation und Ermordung. Das partizipative Projekt „Zwangsräume“ des Aktiven Museums Faschismus und Widerstand in Berlin e.V. hat zu dieser Geschichte der Entmietung und Entrechtung geforscht. Entstanden sind eine Onlineausstellung (zwangsraeume.berlin), die die Forschungsergebnisse dokumentiert, sowie temporäre und dauerhafte Gedenkmodule im Stadtraum. Der Vortrag wird das Projekt vorstellen und auf die Präsentation im (digitalen) Stadtraum eingehen.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender mit der Galerie K‘ und dem b.zb. Bremer Zentrum für Baukultur. -
2023
Luce deLire und Christian Liclair
17.5.2023 / 19 Uhr
Trans Perspektiven
Ein performativer Talk mit Luce deLire und Christian Liclair
zu Hospitalität im KunstfeldGAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Teerhof 21, 28199 Bremen
Trans hörte irgendwann im letzten Jahrzehnt auf, ein politischer Nebenschauplatz zu sein. In welchem Zusammenhang stehen die damit zusammenhängenden sozialen und politischen Entwicklungen zur Kunstwelt? Viele Galerien, Kunstvereine und Museen präsentieren heutzutage nicht-cis Künstler*innen. Doch handelt es sich hierbei lediglich um Lippenbekenntnisse? Ein Pinkwashing verschiedener Kunstinstitutionen, die nicht willens sind, strukturelle Diskriminierungen abzubauen und Räume zu schaffen, in denen sich trans Menschen sicher und willkommen fühlen können? Luce deLire und Christian Liclair laden zu einer performativen Diskussion des Themas mit anschließendem Q & A ein.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Ausgabe von TEXTE ZUR KUNST statt, die unter dem Titel Trans Perspectives anhaltende Vorurteile, Transmisogynie und Antisemitismus in der Kunstwelt und ihren Institutionen adressiert. Mit Trans Perspektive ist dabei ein besonderer trans Materialismus bezeichnet, der von gelebten Erfahrungen ausgehend beispielsweise eine Kritik an Sichtbarkeitspolitik artikuliert, um zu hinterfragen, wie sich trans auf dem Markt, in Museen und darüber hinaus materialisiert. Als Co-Redakteur*innen haben deLire und Liclair die Ausgabe konzipiert und mit der TZK-Redaktion realisiert.
Das Gespräch wird in Kooperation mit der GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst durchgeführt.
-
2023
Annika Lisa Richter
26.4.2023 / 18 Uhr
Annika Lisa Richter, Hildesheim
„If you need me, I’m (still) in the basement!“ – Kunst und Feminismus in Wissenschaft, Institutionen und AktivismusKünstlerhaus Bremen, Am Deich 68/69, 28199 Bremen und via Zoom
„Why Have There Been No Great Women Artists?“, fragte schon 1971 die US-amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin. Wenig später legte das aktivistische Künstler*innenkollektiv Guerrilla Girls nach und zielte mit seiner provokativen Frage „Do women have to be naked to get into the Met. Museum?“ auf das Missverhältnis zwischen nur wenigen ausgestellten Künstlerinnen und zahlreichen weiblich vergeschlechtlichten Akten in einem namhaften Ausstellungsbetrieb. Dass die Frage nach einer Gleichberechtigung der Geschlechter auch im Kunstbetrieb nicht an Aktualität verloren hat, zeigt sich nicht nur an #metoo, sondern auch am Gender Pay Gap sowie dem Gender Show Gap, der die geringere Sichtbarkeit von Künstlerinnen im Ausstellungswesen aufzeigt.
Der Vortrag wirft Schlaglichter auf das Verhältnis von Kunst und Feminismus in Wissenschaft, Institutionen und Aktivismus. Anhand künstlerischer Beispiele vom Mittelalter bis zur Gegenwart werden u.a. folgende Fragen diskutiert: Welche feministischen Perspektiven gibt es in der Kunstwissenschaft? Inwiefern kann künstlerische Praxis auch Aktivismus sein? Und in welcher Form können sich aktuelle Debatten zu Dekolonialität und Diversität und Perspektiven der Kunst(-geschichte) gegenseitig bereichern?Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und dem Künstlerhaus Bremen. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe Ein Haus für Künstler*innen. Gefördert von der Liebelt Stiftung Hamburg
Infos: https://www.kuenstlerhausbremen.de/de/veranstaltungen-2/ein-haus-fuer-kuenstlerinnen/ -
2023
Bettina Knaup und Kaj Osteroth
20.4.2023 / 18 Uhr
Bettina Knaup und Kaj Osteroth, Berlin
re.act.feminism – ein performendes Archiv?Weserburg Museum für moderne Kunst, Teerhof 20, 28199 Bremen und via Zoom
Basierend auf dem Ausstellungsprojekt re.act.feminism #2 – a performing archive gehen die Kuratorinnen Bettina Knaup und Beatrice E. Stammer der Frage nach, ob und wie Performance ausgestellt, archiviert und ein Archiv performt werden kann. re.act.feminism #2 war ein temporäres Performance-Archiv, das von 2011 bis 2013 durch Europa wanderte und dabei laufend ergänzt, erweitert, verändert und aktiviert wurde (u.a. Akademie der Künste, Berlin; Fundació Antoni Tàpies, Barcelona; Tallinn Art Hall; Wyspa Institute of Art, Gdan ́sk). Im Fokus standen Performancedokumente von mehr als 180 feministisch-queeren Performancekünstler_innen und -kollektiven aus verschiedenen Teilen der Welt (www.reactfeminism.org). Aufgefasst wurde der Archivbegriff dabei als Aspiration im Sinne Arjun Appadurais, als Vorschlag für ein lebendiges Archiv im Werden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Aktivitäten der Performance Künstlerinnen der ehemaligen DDR in den 1980er Jahren.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Weserburg Museum für moderne Kunst mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender.
Sie findet statt im Rahmen der Ausstellung What is the Proper Way to Display a Flag? in der Weserburg (19.11.2022–23.04.2023). -
2023
Petra Lange-Berndt
1.2.2023 / 18 Uhr
Petra Lange-Berndt, Hamburg
A Room of One‘s Own – or a House for the Many? Queer-feministische Revisionen des Künstler:innenhausesKünstlerhaus Bremen, Am Deich 68/69, 28199 Bremen und via Zoom
Der französische Künstler und Theoretiker Daniel Buren beschäftigte sich um 1970 in einem Aufsatz mit der Krise des Ateliers und kam zu dem Schluss, dass dieser besondere Ort für das Verständnis von Kunst so wichtig sei, dass er ausgestellt werden müsse. Er definierte das Studio dabei als „Rahmen, Einfassung, Sockel“ und ausdrücklich auch in struktureller Hinsicht als „Macht, Kunstgeschichte, Ökonomie, Markt“: Diese Produktionsstätten verweisen neben dem Schaffensprozess auf den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. In diesem Sinne möchte der Vortrag eine Kritik des Künstler:innenhauses aus queer-feministischer Perspektive vornehmen. Im Mittelpunkt der Analyse stehen historische wie gegenwärtige Institutionen und mit ihnen verbundene Selbstdarstellungen, Künstler:innenrollen, Künstler:innenmythen sowie Ausbildungssysteme seit dem langen 19. Jahrhundert. Was für historische Konzepte, welche Bilder von Künstler:innen in ihren Ateliers und Wohnräumen, sind zu verzeichnen? Was für soziale Räume werden aufgespannt? Was für Konzepte wären im Jahr 2022 zeitgemäß, welche Alternativen sind möglich?
Der Vortrag gehört zur Veranstaltungsreihe Ein Haus für Künstler*innen. Die Reihe knüpft an die interne Diskussion eines geeigneten gendergerechten Namens für das Künstlerhaus Bremen an. Durch Vorträge, Diskussionsrunden, Workshops und künstlerische Beiträge möchte die Reihe externen Perspektiven zu diesem Thema Raum geben und andere Institutionen und Künstlerhäuser in die Diskussion mit einbeziehen.
In Kooperation mit dem Künstlerhaus Bremen, dem Seminar Künstlerische und gestalterische Produktionsräume der Zukunft von Mona Schieren an der Hochschule für Künste Bremen und dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen.Diese Veranstaltung ist Teil von publics & publishings, einem Kooperationsprojekt zwischen GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Künstlerhaus Bremen und Kunsthalle Kunstmuseum Bremerhaven, das entwickelt wird im Rahmen von „dive in. Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR. Mit freundlicher Unterstützung durch die Liebelt Stiftung Hamburg.
-
2022
Mirjam Thomann
18.11.2022 / 19 Uhr
Mirjam Thomann, Berlin
Theory & Action
Künstlerhaus Bremen, Am Deich 68/69, 28199 BremenMirjam Thomanns Interesse gilt der Reflexion und Überschreitung architektonischer, sozialer und institutioneller Ordnungen mit den Mitteln der Skulptur, Installation und mit Text. In ihren Arbeiten nimmt sie den Ausstellungsort als Anlass, als Raum und Struktur, die sie aktiviert und erweitert. Eigenschaften wie Wiederverwendbarkeit, Kombinierbarkeit und Beweglichkeit von Materialien und Einbauten spielen dabei eine entscheidende Rolle. In ihrem Werkvortrag im Künstlerhaus Bremen stellt Thomann ausgehend von ihrem 2021 in Texte für Kunst erschienenen Text The Feminist’s House einige Ausstellungsprojekte der letzten Jahre vor und geht dabei insbesondere auf die Bedingungen ihrer Entstehung ein.
Der Werkvortrag ist der Auftakt der Veranstaltungsreihe Ein Haus für Künstler*innen. Die Reihe knüpft an die interne Diskussion eines geeigneten gendergerechten Namens für das Künstlerhaus Bremen an. Durch Vorträge, Diskussionsrunden, Workshops und künstlerische Beiträge möchte die Reihe externen Perspektiven zu diesem Thema Raum geben und andere Institutionen und Künstlerhäuser in die Diskussion mit einbeziehen. In Kooperation mit dem Künstlerhaus Bremen, dem Seminar Künstlerische und gestalterische Produktionsräume der Zukunft von Mona Schieren an der Hochschule für Künste Bremen und dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen.
Diese Veranstaltung ist Teil von publics & publishings, einem Kooperationsprojekt zwischen GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Künstlerhaus Bremen und Kunsthalle Kunstmuseum Bremerhaven, das entwickelt wird im Rahmen von „dive in. Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR. Mit freundlicher Unterstützung durch die Liebelt Stiftung Hamburg. -
2022
Folke Köbberling
17.5.2022 / 18 Uhr
Folke Köbberling, Berlin/Braunschweig
Wie kann so ein großartiges Material Abfall sein?
b.zb Bremer Zentrum für Baukultur, Am Speicher XI 1, 28217 Bremen und via ZoomFolke Köbberling beschäftigt sich seit 1996 mit der städtebaulichen Umgebung und ihrer Vergänglichkeit als Spiegelbild allgemeiner gesellschaftlicher Prozesse. In skulpturalen Installationen und ortsspezifischen Interventionen setzt sie sich mit Themen in Bezug auf den öffentlichen Raum auseinander wie Basisbeteiligung und Selbstorganisation, Mobilität und Unterkunft, Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit. Mit künstlerischen Mitteln schafft sie Modelle für den Widerstand gegen unsere Vereinnahmung durch die Auswüchse der herrschen- den neoliberalen Wirtschaftsordnung, protestiert gegen den automobilen Individualverkehr als hegemoniale Leitkultur und kommentiert unseren gewohnten Umgang mit städtischer Architektur auf subtile, oft humorvolle Weise. In ihrem Vortrag wird sie den Fokus auf ihre großformatigen Arbeiten mit Rohwolle legen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Ausstellungsprojektes „wohnen³ bezahlbar. besser. bauen. Architektonische Lösungen und künstlerische Interventionen“ (5.12.2021–3.7.2022) statt; ein Ausstellungsprojekt vom Hafenmuseums Speicher XI, b.zb Bremer Zentrum für Baukultur und Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender / Forschungsfeld wohnen +/– ausstellen. Weitere Informationen: http://www.bezahlbarbesserbauen.net
-
2022
Judith Raum
25.1.2022 / 18 Uhr
Judith Raum, Berlin
Stoffgebiete // Textile Territories
Online-Vortrag via ZoomIn raumgreifenden Installationen und Performances setzt sich die Berliner Künstlerin Judith Raum seit 2017 mit gewebten Funktionsstoffen des Bauhauses der frühen 1930er Jahre auseinander. Durch das Überlagern historischer und gegenwärtiger Materialien und Perspektiven sowie die Verknüpfung künstlerischer, wissenschaftlicher und kuratorischer Herangehensweisen entstehen in Raums Arbeiten relationale Konstellationen. Die konzeptionelle Klarheit und ästhetische Eigenart der Gewebe stehen historischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen gegenüber, die sich als nicht frei von Konflikthaftigkeit erweisen. Nicht nur werden in den Stoffen teils vergessene architektonische Anwendungen oder gegensätzliche Designpolitiken manifest. Die textilen Rohmaterialien, die in den Stoffen verwendet wurden, waren auch Teil der zunehmend nationalistischen und territorialen Wirtschaftspolitik. Zudem werden Hierarchien zwischen Architektur, Freier Kunst und Design greifbar, die manipulativ auf die gestalterischen Produktionsbedingungen einwirkten und Mythen produzierten – Mythen, die bis heute wertbildend sind.
In ihrem Vortrag wird Judith Raum über kürzlich für das MoMA, New York City, und die Stiftung Bauhaus Dessau entstandene Installationen, Videos und Performances sprechen, in denen der Schwerpunkt auf dem Werk der Bauhaus-Textildesignerin Otti Berger und der Verknüpfung der phänomenologischen Eigenschaften ihrer Entwürfe mit einer sozialgeschichtlichen Untersuchung der Produktionsbedingungen im zunehmend nationalsozialistisch geprägten Deutschland liegt. Thema werden in diesem Zusammenhang auch die Methodik der Archivrecherche für das Projekt und missverständliche Begegnungen im Feld von artistic research und Interdisziplinarität sein. -
2021
Monica Bonvicini
18.5.2021 / 18 Uhr
Monica Bonvicini, Berlin
„I don’t like you very much and I don’t think you’re fascinating. He put his clothes on, stepped out of the room.“
Quotation from:
Diane Williams: Rhapsody Breeze, in: FINE, FINE, FINE, FINE, FINE (2016), p.660.Online-Vortrag via Zoom
Seit Mitte der neunziger Jahre bezieht sich Monica Bonvicini mit ihren Arbeiten auf sozio-politische Bedingungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ihre Themen entspringen aus einem Interesse für Raum als System – definiert durch materielle und immaterielle Grenzen – in dem gearbeitet, geschaffen, installiert und ausgestellt wird.
Die räumliche Installation I Believe the Skin of Things as in that of Women (ein Zitat von Le Corbusier) wurde vor einem größeren Publikum zum ersten Mal auf der 48. Biennale von Venedig 1999, kuratiert von Harald Szeemann, gezeigt. Die betretbare Installation hat die Größe eines Raumes und ist aus Rigipsplatten und Aluminiumrahmen gebaut. Die Wände sind kahl, kaputt, eingeschlagen und zerschnitten, die inneren Wände mit karikaturhaften Bleistiftzeichnungen verziert, begleitet von Zitaten von Architektinnen und Architekturhistorikerinnen zu Themen wie Wohnen, Bauen und Gender. Architektur, Wände, Konstruktion, räumliche Aufteilungen und Beschränkungen erscheinen häufig in Monica Bonvicinis Arbeiten, dabei ist ihre Kunstpraxis mit Humor durchtränkt, direkt und unehrfürchtig. Ihre architektonische Skulptur von 2019 As Walls Keep Shifting ist ein anderes Beispiel dafür, wie Literatur und Sprache aus dem Feld der Architektur eine Struktur für den sozialen, politischen und geschlechterspezifischen Raum schaffen können. Die Arbeiten zeigen, wie Architektur symbolische Ordnungen verkörpert und dabei immer neue Formen von Körperpolitik hervorbringen kann. -
2019
Elianna Renner
2.12.2019 / 18 Uhr
Elianna Renner, Bremen
lost N found
Universität Bremen, SFG 1040
Die 1977 in der Schweiz geborene und in Deutschland lebende Künstlerin Elianna Renner arbeitet an der Schnittstelle von (Auto)Biografie und Geschichte. Sie hinterfragt auf ästhetisch-visuelle Weise historische Narrative und deren Auslassungen mit dem Ziel, die hinter dem Vergessenen und Verschwiegenen stehenden Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens stehen dabei immer wieder Geschichten von Frauen*, oft solche, die in den offiziellen Geschichtsschreibungen überhaupt nicht oder nur am Rande vorkommen. Elianna Renner geht es darum, Geschichte(n) als Konstruktion(en) wahrnehmbar werden zu lassen, die sich je nach Erzählerin neu darstellen. Wissenschaftler*innen sehen sich permanent mit der Frage konfrontiert, wie sie mit dem nie zu erfüllenden Wahrheitsanspruch von Geschichte umgehen können. Diesen Wahrheitsanspruch versucht die Künstlerin als illusorisch zu entlarven. Sie imaginiert, setzt neu zusammen, verknüpft Fiktives mit „Realem“. Sie nutzt dazu eine Vielzahl künstlerischer Medien wie Skizzen, Film, Fotografie, Audio, Text und Installation. Mit ihren Werken zeigt sie auf, dass sich nicht nur persönliche Erinnerungsprozesse fragmentarisch vollziehen, sondern auch kulturelles Gedächtnis wie Geschichtsschreibung grundsätzlich (un)vermeidliche Lücken produzieren.
-
2019
Rosa Barba
3.6.2019 / 20:30 Uhr
Filmscreening: Subconscious Society (2014) mit Künstleringespräch
Rosa Barba, Berlin/Bremen
Setting a Performative Frame
Kommunalkino City 46 - Birkenstraße 1, 28195 Bremen
„Cinema is a dream machine, but now it has become a didactic dream. I am taking this dream and disturbing it through play with cinematic elements in order to go beyond the dream.“ Rosa Barba 2018
Seit 15 Jahren formuliert Rosa Barba ihre antiillusionistische Kritik an Modi und Konventionen des Kinodispositivs nicht nur durch multiperspektivische, installative Strategien der Involvierung und Dynamisierung des betrachtenden Publikums, sondern auch durch das Festhalten an Einzelbildprojektionen. Neben dem Einsatz anscheinend ‚narrationsexterner‘ Elemente wie Paratexte des Films oder die Behandlung des Filmstreifens als ästhetischem und skulpturalem Material steht also auch ihre konzentrierte wie auch Affekte erzeugende Kameraführung im Zentrum ihrer experimentellen kinematografischen Konzepte. Dabei spielt der Raum eine entscheidende Rolle: Entgegen der Erfahrungen des populären und kommerziellen Kinos schlägt Rosa Barba eine anarchische Erkundung und Gestaltung neuer filmischer Räume vor. Dabei geht es um eine Abwendung von konsumierbaren Räumen und abgeschlossenen imaginären Geschichtswelten hin zu Orten, an denen eine spielerische, unvorhersehbare Öffnung dieser Räume möglich wird. Rosa Barba versteht Kino in ihrer Arbeit im architektonischen Sinne und setzt es als ein Instrument ein, mithilfe dessen die raumzeitlichen Dimensionen des Innen- und Außenraums zusammenfallen und über diese hinausweisen.
In Subconscious Society (2014, 40’) montiert die Künstlerin Filmsequenzen verlassener Industriestandorte, etwa die als Science- Fiction anmutende Maunsell-Seefestung in Kent, mit Interieurszenen feierlicher Aktivitäten in der monumentalen und prächtig ausgestatteten Albert Hall in Manchester. Lange Zeit verlassen, ist der imposante Saal erst vor kurzem zum Veranstaltungsort umgebaut worden, der Innenraum überreichlich angefüllt mit einem Sammelsurium an Objekten, Möbeln, Gliederpuppen, Holzstößen. In Voice-Overs kommentieren gewählte Protagonistinnen, Bewohnerinnen unterschiedlichen Alters aus der urbanen Umgebung den historischen Wandel der Hall. Die fragmentierten, beinahe abstrakten Dialoge implizieren eine Assoziationskette des Unbewussten, die wie gefangen scheint in der ewigen Gegenwart ihrer Umgebung. Erst die im Film gezeigten imaginären wie medialen Projektionen der Industrielandschaften eröffnen neue (Möglichkeits-)Räume.
Diese Veranstaltung ist Teil des Semesterschwerpunktes privat +/- öffentlich: neue bildmediale Perspektive (Konzept: Elena Zanichelli).
Sie findet statt in Zusammenarbeit mit Christine Rüffert und dem City 46 (www.city46.de). -
2018
Suse Itzel
3.12.2018 / 18 Uhr
Suse Itzel, Köln
Raum als Akteur und MarionetteUniversität Bremen, SFG 1040
Wohnen und Arbeiten bedingen sich: Suse Itzel zeigt den Zusammenhang zwischen ihren künstlerischen Arbeiten und den verschiedenen (Wohn-)Orten ihres Entstehens auf. Räume geraten in Bewegung, scheinbar sprechend und nicht still, bedeuten sie Inspiration und Plage zugleich und fordern eine permanente Auseinandersetzung ein. Suse Itzels Videoarbeiten bewahren die Auflösungen von Wohnungen und anderen (nach)gebauten Gebilden. Gegenstand, Raum oder Gebäude sind Akteure. Architektur, mit der sich der Mensch eine vertraute Umgebung geschaffen zu haben glaubt, gerät in Unruhe und löst sich aus ihren Fugen. Der Essayfilm „Wir haben so schön geschlafen“ (2018) behandelt erzählerisch spekulativ die Architektur eines Bauhaus-Gebäudes, in dem die Künstlerin vier Jahre ein Atelier hatte. Geschildert wird die Geschichte dieses in Teilen absichtlich zerstörten Schulgebäudes der Hamburger Architektenbrüder Ernst und Wilhelm Langloh. -
2018
Anna Luise Schubert und Amelie Wegner
11.6.2018 / 18 Uhr
Anna Luise Schubert und Amelie Wegner, Weimar
»Umzugsgut«. Exil und die Wege der Dinge zwischen Deutschland und Palästina
Universität Bremen, SFG 1040
Das Centre for Documentary Architecture präsentiert das Film- und Forschungsprojekt »Umzugsgut«, das sich mit dem Leben und Werk der jungen Innenarchitektin Rahel Weisbach beschäftigt. Diese begann sich in den späten 1920er Jahren eine erfolgversprechende Karriere aufzubauen. Zu ihrer Kundschaft gehörten verschiedene, oftmals jüdische, Berliner Intellektuelle, die Anfang der 1930er Jahre durch die Verfolgungen des NS-Regimes zur Auswanderung gezwungen waren. Bei Migration ihrer Besitzer*innen ließ Rahel Weisbach ihre Möbel zum Transport umgestalten. Darüber hinaus entwarf sie auch direkt transportfähige Möbel. So verließen ihre Entwürfe Deutschland, während sie selbst nicht die Möglichkeit dazu hatte.
Auf der Suche nach den Möbeln versucht das Projekt, die Spuren der ehemaligen Besitzer*innen zu verfolgen und zeigt damit einen Teil der jüdischen Migrationsgeschichte zwischen Deutschland, Großbritannien und Israel. Möbel und ihr Weg sind dabei ein Zeugnis globaler Verbindungen und politisch-gesellschaftlicher Zusammenhänge.
Davon ausgehend erfragt der Film die Umstände der zwangsweisen Migration zur Zeit des Nationalsozialismus, bei der es unzählige Vorschriften und Einschränkungen zu beachten galt. Welchen Besitz wollte und konnte man mitnehmen? Welchen Nutzen hatten transportfähige Möbel und wie sahen sie aus? In dem Paradox zwischen der eigentlichen Sesshaftigkeit eines »Möbels« und seiner vermeintlichen »Transportfähigkeit« spiegelt sich die emotionale Zerrissenheit und die existenzielle Unsicherheit der Aus- und Einwanderung.Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Unbehaust Wohnen in Forschung und Lehre.
-
2018
Pia Pollmanns
14.5.2018 / 18 Uhr
Pia Pollmanns, Bremen
Die Wege der Elisa KoschUniversität Bremen, SFG 1040
In der künstlerischen Arbeit „Die Wege der Elisa Kosch“ widmet sich Pia Pollmanns ausgehend von den autobiografischen Aufzeichnungen ihrer Großmutter einer vielschichtigen Spurensuche in Polen. Die aufgeschriebenen Erinnerungen der Großmutter, die ihre ersten dreißig Lebensjahre und die Flucht aus Schlesien umfassen, waren für die Künstlerin der Anlass, sich der Gegend, in der ihre Großmutter aufgewachsen ist, mit ihrem fotografischen Blick zu nähern. Während mehrerer Aufenthalte besuchte sie zahlreiche Orte und übersetzte sie in ihre Fotografien, in denen sich die Nahsicht auf ein vergangenes Leben und die Distanz einer heutigen Perspektive überblenden. In ihrem Vortrag zeigt Pia Pollmanns die entstandene Fotoserie und berichtet über ihre Herangehensweise und Arbeitsprozesse.
Im Rahmen der Veranstaltung wird „beobachten“, ein Film über Pia Pollmanns und die „Wege der Elisa Kosch" von Pia Weber gezeigt.
Der Film ist im Forschungsseminar „Vor Ort sprechen: Künstler*innen, Produktionsorte, Verhandlungsräume. Kunst/Stadt/Bremen“ im Master Kunst- und Kulturvermittlung der Universität Bremen im Wintersemester 2017/18 entstanden.Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Unbehaust Wohnen in Forschung und Lehre.
-
2018
Martina Padberg
5.1.2018 / 18 Uhr
Martina Padberg, Bonn
Desperate Housewives?
Haus und Haushalt im gesellschaftlichen Diskurs und in der Gegenwartskunst
Universität Bremen, SFG 1040
Haus und Haushalt stehen als typisch ‚weibliches’ Betätigungsfeld für ein Rollenbild, das scheinbar ausgedient hat. Der Begriff ‚Hausfrau’ ist aus dem Sprachgebrauch nahezu verschwunden. Stehen die „Desperate Housewives“, Kunstfiguren der amerikanischen Filmindustrie, also für längst überholte Klischees? Oder gilt diese Analyse nur für eine privilegierte, gebildete, weiße Mittelschicht, wie die britische Feministin Laurie Penny behauptet? Wer erledigt die anfallenden Arbeiten im Haushalt heute? Und: Wie wird diese Tätigkeit in einer ganz auf den ökonomischen Tauschwert basierenden Gesellschaft bewertet? Es geht aber nicht nur darum, wer im Haushalt arbeitet, sondern auch darum, wie sich diese Arbeit gestaltet. Erleichtern die vielen, demnächst digital vernetzten Hilfsmittel tatsächlich Arbeitsprozesse oder zwingen sie zu immer mehr Logistik, Steuerung und Optimierung?
In der Ausstellung Desperate Housewives? Künstlerinnen räumen auf haben 29 internationale Künstlerinnen diesen umstrittenen Lebens- und Arbeitsplatz kritisch unter die Lupe genommen und in Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Installationen und Videos als ambivalenten Ort zwanghafter Pedanterie oder unkontrollierbarer chaotischer Kräfte, als öden Vollzugsraum des Immergleichen oder als alternativen Freiraum inszeniert. Die Ausstellung war in fünf deutschen Museen zu sehen und wurde von vielen kontroversen Diskussionen begleitet. Martina Padberg, eine der Kuratorinnen, lädt zum nachträglichen Umräumen, Einweichen und Abstauben ein.
Für Dr. Kathrin Heinz zum 50. Geburtstag
veranstaltet von der Forschungsgruppe wohnen+/-ausstellen und dem Kolloquium Bild-Raum-Subjekt. -
2017
Evin Oettingshausen und Henning Bleyl
27.11.2017 / 18 Uhr
Evin Oettingshausen und Henning Bleyl, Bremen
Leerstellen und Geschichtslücken
Universität Bremen, SFG 1040
Möbel und andere Gebrauchsgegenstände tradieren Wissen und Erzählungen. Mit ihnen verbinden sich persönliche und emotionale Bezüge, die meist nur im individuellen und familiären Raum sichtbar und erfahrbar sind. Was bedeutet dies hinsichtlich der Unmengen von Wohnungseinrichtungen, die während des Holocaust zwangsweise ihre Eigentümer_innen wechselten? Für die Überlebenden des Holocaust bedeutet(e) die totale „Verwertung“ jüdischen Eigentums auch das Fehlen jedweder Erinnerungsstücke - für die Nachkommen der „Arisierungs“-Gewinnler_innen hingegen eine Erbschaft, deren Kontexte zumeist familienbiographisch tabuisiert werden.
Bremen ist mit dieser doppelten Erinnerungslosigkeit in besonderer Weise konfrontiert: Hier, genauer im Hauptsitz der Spedition Kühne+Nagel an der Weser, wurde der Löwenanteil der Profite aus dem Abtransport jüdischen Eigentums aus Westeuropa verbucht. Evin Oettingshausens Entwurf „Leerstellen und Geschichtslücken“ für ein Mahnmal vor dem Firmensitz arbeitet mit dem Fehlen und den Unterbrechungen der Geschichtserzählung, symbolisiert durch leere Schächte und die Schattenrisse geraubter Möbel. 72 Jahre nach dem Ende des Holocaust übernehmen Dinge wie geraubte Möbel die Funktion von Präsenz, von unmittelbarer und emotionaler Zugänglichkeit; sie fungieren in gewisser Weise als „Platzhalter“ ihrer vertriebenen oder ermordeten legitimen Eigentümer_innen. Doch die Implementierung dieses Zusammenhangs in den öffentlichen Raum ist ein spannungsreicher Prozess, wie der Vortrag zeigen wird. -
2017
Emese Kazár und Doris Weinberger
15.5.2017 / 18 Uhr
Emese Kazár und Doris Weinberger, Bremen
Minds étrangers
Erste Phase eines Künstlerinnen-Austauschprojektes zwischen Bremen und BudapestUniversität Bremen, GW2, B 3850
Was heißt es, Gastfreundschaft zu pflegen - was heißt es, fremd zu sein? Wie viel Heimat braucht ein Mensch? Wie kann gemeinsam Differenz gelebt werden? Aus diesen Fragen heraus entwarfen und initiierten die Künstlerinnen Emese Kazár und Doris Weinberger ein Austauschprojekt: Kazár lud Weinberger nach Budapest ein, wo sie zwei Monate lang in einer Wohnung lebten und arbeiteten. Was dieses unmittelbare, alltägliche Verhandeln von kulturellen und sozialen Unterschieden, von Erinnerung und Zuhause sein für die eigene künstlerische Arbeit bedeutet, bildet sich in den vor Ort entstandenen Werken ab. In ihrem Vortrag zeigen die beiden Künstlerinnen eine Auswahl dieser Arbeiten; sie berichten über die im Herbst 2016 realisierte erste Phase des Projektes und geben Ausblicke auf seine weitere Entwicklung. -
2016
Kornelia Hoffmann
9.5.2016 / 18 Uhr
Kornelia Hoffmann, Bremen
Irgendwo im Raum verankertUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Wohnräume und Raumverhältnisse stehen im Fokus der künstlerischen Praxis von Kornelia Hoffmann. Sie untersucht diese hinsichtlich ihrer emotionalen Bedeutung und Eindrücklichkeit auf das Körperliche, wie z.B. Schwindel, Schwerkraftentzug und Wohlbefinden. Architektur und Lebensräume werden in ihrer Beziehung zu Erinnerungen, Erfahrungen und Traumbildern in verschiedenen Serien und Formaten thematisiert. Ausgangspunkt der Arbeiten sind fotografische Bilder, die sich - ergänzt durch verschiedene Materialien - auch zu räumlichen Installationen und Eingriffen entfalten. Kornelia Hoffmann wird eine Auswahl ihrer Arbeiten vorstellen. -
2015
Daniela Comani
23.11.2015 / 18 Uhr
Daniela Comani, Berlin
Ich war’s.
Selbstinszenierung und RollentauschUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Seit den 1990er Jahren setzt sich Daniela Comani in ihrer künstlerischen Produktion mit Selbstinszenierung und Rollentausch als repräsentationskritischer Umkehrung herkömmlicher Geschichtsschreibung(en) auseinander. Ihren Bilderfundus entnimmt die Künstlerin aus der Medien- und Alltagswelt. Serialität im Text- bzw. Bildeinsatz ist dabei Programm: Etwa wird in der performativen Fotoserie „Eine glückliche Ehe“ (Buch und Fotoserie, seit 2003) Geschlechtsidentität zu einer qua minimaler Unterschiede bespielten Selbstinszenierung. Comanis geglückte Erzählung mit Szenen aus einer/‚ihrer‘ Ehe besteht aus über sechzig Motiven, die heterosexuell konnotierte Alltagsrituale über zehn Jahre fotografisch festhalten. Ihre Gendereingriffe setzt die Künstlerin in den Serien „Neuerscheinungen hrsg. von Daniela Comani“ (Buch und Fotoserie, 2008) sowie „My Film History - Daniela Comani’s Top 100 Films“ (2012) fort: Darin verändert sie die Buch- und Filmtitel so, dass männliche bzw. weibliche Protagonist_innen gegeneinander ausgetauscht werden. Die Selbstermächtigung einer patriarchalischen Geschichtsschreibung legt die Künstlerin bereits in ihrer Arbeit „Ich war’s. Tagebuch 1900-1999“ (Buch, Audio- sowie Wandplakatinstallation im öffentlichen Raum, 2002/2011) offen: Hier läuft die Ich-Erzählerin, als Täter und als Opfer, durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Daniela Comani wird eine Auswahl ihrer Arbeiten aus der letzten Dekade zeigen. -
2015
Florian Wüst, Christiane Keim und Barbara Schrödl
2.11.2015 / 18 Uhr
Moderne Architektur und Stadt im Film
City 46, Birkenstr. 1, 28195 Bremen
Buchpräsentation
Christiane Keim, Bremen und Barbara Schrödl, Linz (Hg.)
Architektur im Film. Korrespondenzen zwischen Film, Architekturgeschichte und Architekturtheorie
Linzer Beiträge zur Kunstwissenschaft und Philosophie, Bielefeld: transcript 2015Seit dem frühen 20. Jahrhundert wird der Film eingesetzt, um Architektur zu dokumentieren, architekturhistorisches Wissen zu vermitteln und neue Erkenntnisse über ästhetische und funktionelle Zusammenhänge des Bauens zu gewinnen. Die Neuerscheinung widmet sich den Wechselwirkungen zwischen Film und architekturhistorischer Theoriebildung, den Beziehungen zwischen innovativen technischen Formaten, deren experimentellem Einsatz sowie der architektonischen Praxis. Schwerpunkte der Beiträge aus Kunst- und Filmwissenschaft, Architekturtheorie und -geschichte sind das Verhältnis zwischen dem neuen Medium Film und dem kinematographisch inspirierten Neuen Bauen in den 1920er Jahren und die Bedeutung der digitalen Medien für die filmische Präsentation von Architektur in der Gegenwart.
DVD Präsentation
Florian Wüst, Berlin
Die moderne Stadt. Filmessays zur neuen Urbanität der 1950/60er Jahre
Hg. Ralph Eue, Florian Wüst, Fridolfing: absolut MEDIEN 2015
Wiederaufbau und Modernisierung der europäischen Großstädte nach 1945 zielten auf bessere Lebensbedingungen für die arbeitende Bevölkerung. Überall fehlte es an Wohnraum. Massenproduktion und Konsumkultur stellten die Menschen und ihre sozialen Beziehungen vor große Veränderungen. Im Medium des Films wurden einerseits die Stadt- und Verkehrsmodelle „von Morgen“ beworben und andererseits der Kritik an der Rationalisierung des Alltags Ausdruck verliehen. Die DVD-Edition umfasst dokumentarische und experimentelle Kurzfilme, die einen einzigartigen historischen Blick auf die Kontroverse um die moderne Stadt eröffnen. Der Berliner Künstler und Filmkurator Florian Wüst präsentiert die folgenden Filme der DVD: „Für einen Platz an der Sonne“ (Rudi Hornecker, 1959), „Die Stadt“ (Herbert Vesely, 1960) und „Bag de ens facader“ (Peter Weiss, 1961). -
2015
Oda Projesi
20.4.2015 / 18 Uhr
Oda Projesi, Istanbul
Project in a RoomZentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg
Oda Projesi is an Istanbul-based artist collective made up of Özge Aꞔikkol, Güneş Savaş and Seꞔil Yersel who founded the project in 2000 by turning an apartment in Galata, a historical urban district in Istanbul which is undergoing a process of gentrification and includes a wide mixture of social classes, into their work space. Since Oda Projesi's first project – which involved Özge Aꞔikkol emptying the room and exhibiting it with George Perec's text “About a Useless Space” – this apartment quickly became a gathering point for other artists, architects, sociologists, musicians, and it became a particularly important space for the gathering of neighbours. Many collaborative projects explored urban politics, not only with regard to public places but also domestic spaces. After being evicted from the apartment during a process of gentrification in 2005, Oda Projesi now has a more mobile status, using different spaces and also different media, such as a local radio station, book, postcards or newspapers.
Der Abend mit Oda Projesi ist eine gemeinsame Veranstaltung des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen an der Universität Bremen mit dem Zentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg.
-
2015
Pia Lanzinger
26.1.2015 / 18 Uhr
Pia Lanzinger, Berlin
Würfeln um Berlin und andere urbane SpieleUniversität Bremen, GW2, B 3850
Der Vortrag stellt eine Auswahl von Projekten vor, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen globalen Strukturen und lokalen Phänomenen beschäftigen. Dabei werden Raumkonzepte und Strukturen des öffentlichen Raums ebenso wie private Wohnarrangements oder Stadt- und Wohnarchitekturen untersucht. Ein Schwerpunkt liegt auf kollaborativen Projekten im öffentlichen Raum, die sich mit dem aktuellen Wandel des Urbanen auseinandersetzen und ihn zum Gegenstand künstlerischer Analysen und provokativer Interventionen machen.
-
2014
Patricia Lambertus, Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen
3.11.2014 / 14 Uhr
Buchpräsentation und Vortrag
Universität Bremen, GW2, B 3850
Buchpräsentation
Interieur und Bildtapete. Narrative des Wohnens um 1800
Hg. Katharina Eck, Astrid Silvia Schönhagen, transcript 2014
Bildtapeten im Interieur um 1800 sind an der Herausbildung und Formung einer spezifischen, an bürgerlichen Werten orientierten Wohnkultur maßgeblich beteiligt. Sie entfalten Erzählungen im Wohn- bzw. Innen-Raum, in dem sich Diskurse über Körper, Geschlecht, Ethnizität und Nation mit ästhetischen Idealen verschränken. Solchen Narrativen und Beziehungsgeflechten spürt dieser Band aus interdisziplinärer Perspektive nach.Vortrag
Patricia Lambertus, Bremen
„Kiss me, Hardy“. Stratigrafien zwischen Kitsch und Gewalt in Bildräumen des WohnensAusgehend von historischen Panoramatapeten wie der „Schlacht bei Austerlitz“ beschäftigt sich die Künstlerin Patricia Lambertus in ihrem aktuellen Oeuvre mit den Themen Gewalt und Krieg. Hierzu verbindet sie die Bildsprache der Tapetenszenerien mit Elementen der medialen Berichterstattung über politische und gesellschaftliche Konflikte der heutigen Zeit. Gezielt setzt sie zur Steigerung des Spannungsfeldes zwischen Schönheit und Gefahr auch Kitsch aus
der Alltagskultur ein. So entstehen collagierte Rauminstallationen, die in ihrer Detailfülle den Stellenwert von Raumdekoren sowie die Autonomie von Bildern und Alltagsgegenständen befragen. Gleichzeitig verweisen diese auf die archäologische Methode der Stratigrafie, der Schichtenkunde, mit der Fundhorizonte analysiert und datiert werden können. Um solche Fundhorizonte, die sich in der Verschränkung von Gewaltbildern mit Diskursen um Wohnen, Privatheit und Geschlecht zeigen, kreisen die Arbeiten der Künstlerin.
-
2014
Moira Zoitl
7.7.2014 / 18 Uhr
Moira Zoitl, Berlin
Eigene OrteUniversität Bremen, GW2, B 3850
Die Künstlerin Moira Zoitl stellt in ihrem Vortrag Arbeiten vor, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Reproduktionsarbeit und ihrer räumlichen Dimension auseinandersetzen. Das Projekt „Chat(t)er Gardens/EXCHANGE SQUARE” beschäftigt sich mit den Lebens- und Arbeitsverhältnissen philippinischer Hausarbeiterinnen in Hongkong. Die seit 2002 entstandenen Videos und Installationen fokussieren Fragen der Re-Präsentation und Selbstermächtigung der Frauen, die sich sowohl im Haus ihrer Arbeitgeber_innen als auch im öffentlichen Raum in einer prekären Situation befinden. Im Zentrum der zweiteiligen Videoarbeit „Küchen Torso – von der Reduzierung der Schritte” (2013) steht die Frankfurter Küche der Architektin Margarethe Schütte-Lihotzky, die als Vorbild für die moderne Einbauküche gilt. Die Arbeit referiert auf die Untersuchungen zur Rationalisierung der Hausarbeit Anfang des 20. Jahrhunderts und den darin involvierten weiblichen Körper. In den Videos nimmt eine Performerin die Rolle einer Wissenschaftlerin, einer „Hausfrau” und eines Torsos ein.
Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Haushaltungen-Ökonomien-Wohnen.
-
2013
Astrid Nippoldt
18.11.2013 / 18 Uhr
Astrid Nippoldt, Berlin
„It all comes, I suppose, it all comes of liking honey so much. Oh help!”*Universität Bremen, GW2, B 3850
Die Künstlerin Astrid Nippoldt spürt in ihren Videos und Fotografien spannungsgeladene Orte und Zustände auf. Traum und Albtraum liegen in ihren Werken dicht beieinander, sichere Urteile geraten ins Schwimmen. In der Kopplung von Seh(n)sucht und Gefährdung erweist sie sich als Bildromantikerin, die gleichermaßen perfektionistisch wie emotional fasziniert nach den Momenten sucht, an denen die rationale Verfügbarkeit über das Bild erlischt. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Astrid Nippoldt mit Wohlstandsphänomenen und der Ambivalenz von Verführung und Beklemmung, wie sie sich insbesondere im Kontext des Wohnens zeigen. Zuletzt untersuchte sie dazu eine Planstadt in den Sümpfen Floridas und einen Apartmentturm in Peking. Im Vortrag stellt Astrid Nippoldt ausgewählte Beispiele ihrer intermedialen künstlerischen Praxis vor.
*aus “Winnie-the-Pooh“, A.A. Milne, 1926Der Vortrag gehört zum Schwerpunkt Haushaltungen-Ökonomien-Wohnen.
-
2013
Antje Schiffers
10.6.2013 / 18 Uhr
Antje Schiffers, Berlin
Sie zeichnet alle BlumenUniversität Bremen, GW2, B 3850
Antje Schiffers ist Blumenzeichnerin, Wandermaler-in und Werkskünstlerin. Sie ist Rollenerfinderin und Dienstleisterin. Sie betreibt mit Unternehmensberatern und mit Bäuerinnen und Bauern in Europa Tauschgeschäfte – ein Gemälde gegen eine Beratung des „Unternehmens Antje Schiffers“, ein Gemälde von ihrem Hof gegen ein Video, in dem die Landwirte ihre Arbeit darstellen. Sie füllt über ein Jahr lang mit 200 Mitproduzent/innen eine „Vorratskammer“ mit Essen, Getränken und Themen und bewirtet daraus ein Festival. Sie entwickelt die „Vechtewaren“: In der Grafschaft Bentheim entstehen Maiskombis, Kornkombis, Kartoffeljanker oder Kartoffelkäferkinderkombis, ein ganzes Dorf pflanzt Flachs für Ohner Leinen. In ihrem Vortrag wird sie von ihren künstlerischen Vorgehensweisen und Verhandlungen berichten.
Der Vortrag gehört zur Schwerpunkt Haushaltungen-Ökonomien-Wohnen.
-
2012
Maike Christadler
10.12.2012 / 18 Uhr
Maike Christadler, Basel
Die Zeichnung als Masterplan: über Verquickungen von Handschrift und KopfarbeitUniversität Bremen, GW2, B 3770
Der Schweizer Künstler Urs Graf (ca. 1480-1529) ist vor allem für seine Zeichnungen bekannt, die in vielfältiger Weise Bezug auf seine eigenen Erfahrungen als Reisläufer in den oberitalienischen Kriegen des beginnenden 16. Jahrhunderts nehmen. Diese Bilder sind immer wieder als Wiedergabe dessen beschrieben worden, was Urs Graf gesehen und erlebt habe, Zeugnisse zugleich von historischen und biographischen Situationen. In diesem Diskurs
gewinnen die Zeichnungen eine doppelte Authentizität: sie dokumentieren und bestätigen ein geschichtliches Ereignis - als direkt ‚vor Ort‘ entstanden - und sie sind zugleich Formationen des disegno, das als Manifestation der idea eng mit Vorstellungen von künstlerischer Kreativität verknüpft ist. Der Vortrag widmet sich der Frage, wie und wieso im kunsthistorischen Diskurs gerade Zeichnungen zu Medien gemacht werden, die künstlerische Präsenz generieren und Authentizitätsvorstellungen transportieren. Dazu werden Überlegungen zur Handschrift des Künstlers mit dem Arbeiten verschiedener Köpfe korreliert.
-
2012
Kathrin Heinz
16.7.2012 / 18 Uhr
Kathrin Heinz, Bremen
Kandinsky sehen und schreiben. Über biografische Anordnungen und mächtige PaarungenUniversität Bremen, GW 2, B 3850
Der Vortrag widmet sich der Künstlerfigur Wassily Kandinsky, insbesondere seinen Selbstpositionierungen und Selbstzeugnissen sowie dem Umgang der Kunstgeschichte mit den vom Künstler entworfenen Bildern und Images. Anhand vermeintlicher diskreter Eingriffe und Arrangements werden Verhandlungen künstlerischer und kunstgeschichtlicher ˏKennerschaft´, das Ringen um Deutungshoheiten, Autorschaft, Autorität und Kanonbildungen, in den Blick genommen. Es geht um eine kritische Reflexion künstlerischer und kunstgeschichtlicher Erzählmuster, zugleich um eine Perspektivierung kunstgeschichtlichen Schreibens in Auseinandersetzung mit mythischen Praktiken.
-
2012
Viktoria Schmidt-Linsenhoff
18.6.2012 / 18 Uhr
Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Trier
Der Hof in Dakar. Politische Ästhetik in der PostkolonieUniversität Bremen, GW2, B 3850
1974 wurde ein ehemaliger Restaurant-Hof im Zentrum von Dakar zum Treffpunkt der Künstlergruppe Leboratoire Agit-Art. Die Gruppe setzte der akademischen Staatskunst des ersten Präsidenten der Unabhängigkeit, L.S. Senghor (1960–80) eine autonome Avantgarde entgegen. Der Ort diente als Bühne und Galerie, Requisitenkammer und Werkstatt, Kino- und Vortragssaal. Irgendwann wurde der Hof zum Wohnatelier von Issa Samb, dem theoretischen und organisatorischen Führer der Gruppe. Der Hof ist bis heute ein unbeschränkt öffentlicher Raum, offenes Archiv und prozessuales Kunstwerk, an dessen Ästhetik die tagtägliche Hausarbeit des Blätter-Kehrens ebenso viel Anteil hat, wie die Kreativität des Zufalls und der Natur.Der Vortrag stellt die Frage nach der politischen Bedeutung des syn-ästhetischen Regimes in dem Hof. Was bedeutet etwa die Gleichbehandlung der unterschiedlichsten Dinge und Sujets, von Bild und Schrift, afrikanischen und europäischen, islamischen und christlichen Traditionen, Popularkultur und hermetischer Poesie?
Zuvor wurde der Film Der Hof von Dieter Reifarth und Viktoria Schmidt-Linsenhoff um 16.00 Uhr im gleichen Raum gezeigt.
Der Film zeigt den Hof von Joe Ouakam in Dakar, Senegal: Atelier und Gesamtkunstwerk, seit 1974 Treffpunkt und lebendes Archiv der Künstlergruppe Laboratoire Agit-Art. Es geht um die filmische Übersetzung einer gattungsübergreifenden Experimentalkunst: Installation und Performance, Theorie und Poesie, Malerei und die Eloquenz der Dinge.
Zeitzeugen und Weggefährten kommentieren aus unterschiedlichen Perspektiven den Ort, den Künstler-Mythos Joe Ouakam, die Geschichte von Laboratoire Agit-Art, das Musée Dynamique, L.S. Senghors Kulturpolitik der Négritude seit der Unabhängigkeit. Der Film dokumentiert eine tagtäglich geleistete, künstlerische Arbeit, die nicht dem Markt verpflichtet ist.
-
2011
Silke Büttner
12.12.2011 / 13:35 Uhr
Silke Büttner, Hamburg
Eugen_ia und die FalteUniversität Bremen, GW2, B 3850
Ausgehend von der Idee, dass der sichtbare menschliche Körper die Inkarnation eines bestimmten Seinsstils ist und auf Wissensordnungen und Machtverhältnissen basiert, werden in dem Vortrag Körper-Bilder des 12. Jahrhunderts im Hinblick auf den Sichtbarkeitsstil im Europa jener Zeit befragt. Welche Aufschlüsse bieten die Visualisierungen eines weiblichen Abtes und eines Effeminatus und die von Engeln und Dämonen, von Rittern, Sarazenen und Fabelwesen über die Form der Körperlichkeit, über die Beschaffenheit von Selbst und Nicht-Selbst und über die Sicherung gesellschaftlicher Ordnung?
-
2011
Insa Härtel
16.5.2011 / 18 Uhr
Insa Härtel, Bremen
Tracey Emin: Kunst – Triumph – SexualitätUniversität Bremen, GW2, Raum 3770
Tracey Emin hat sich mit ‚Bekenntnis‘-Kunst wie Everyone I have ever slept with 1963-1995 einen Namen gemacht und es bis zum „Professor of Confessional Art“ gebracht. In diesem Vortrag soll es um die Arbeiten Why I never became a dancer (1995) und Riding for a Fall (1999) gehen, in denen wiederholt Lebensläufe, Körperbilder und mythische Narrative fusionieren. Die zeitlich vorausliegende Arbeit erzählt von einigermaßen wahllosen jugendlich-sexuellen Kontakten Emins in ihrer Heimatstadt Margate, einer Demütigung bei einem Tanzwettbewerb sowie von Aufbruch und finalem ‚Triumph‘. Riding for a Fall realisiert gleichsam eine ,Rückkehr‘ nach Art eines Cowgirls. Die Referentin interessiert sich vor allem für die libidinösen Verwicklungen in diesem Spiel, denn: Sexualität wird hier nicht nur inhaltlich thematisiert, sondern auch in der künstlerischen Darbietungsform.
-
2025
Robert Bauernfeind
19.6.2025 / 18 Uhr
Robert Bauernfeind (Kunsthistoriker, Universität Augsburg)
Groteske Präparate. Tiergebilde der Frühen Neuzeit und ihre RäumeOnline-Vortrag via Zoom
-
2025
Bettina Henzler
30.1.2025 / 18 Uhr
Bettina Henzler (Filmwissenschaftlerin, Köln)
Anverwandlungen an das Tier. Zum mimetischen Verhältnis von Natur und Mensch im KindheitsfilmOnline-Vortrag via Zoom
-
2024
Apian (Aladin Borioli)
5.12.2024 / 18 Uhr
Apian (Aladin Borioli) (Visueller Anthropologe, Schweiz)
A Ministry of BeesOnline-Vortrag via Zoom
-
2024
Antonia Ulrich
4.7.2024 / 18 Uhr
Antonia Ulrich (Philosophin, Kunsthistorikerin und Designwissenschaftlerin, Potsdam/Hannover)
HabitatbäumeOnline-Vortrag via Zoom
-
2024
André Krebber
6.6.2024 / 18 Uhr
André Krebber (Kulturwissenschaftler, Kassel)
»My Octopus Teacher«: Vom Lernen anders in der Welt zu seinOnline-Vortrag via Zoom
-
2024
Stephan Zandt
14.2.2024 / 18 Uhr
Stephan Zandt (Kultur- und Medienhistoriker, Weimar)
Der Bär im Kinderzimmer. Kindheitsmilieus und -medien um 1900Online-Vortrag via Zoom
-
2023
Anne Hölck
7.12.2023 / 18 Uhr
Anne Hölck (Szenografin, Berlin)
Multispecies Sceno- graphies – L’HippopotameOnline-Vortrag via Zoom
-
2023
Theresa Stankoweit
9.11.2023 / 18 Uhr
Theresa Stankoweit (Kunsthistorikerin, Hamburg)
Das tierliche Habitat als politischer Raum. Naturkundliche Dioramen um 1900Online Vortrag via Zoom
-
2023
Julia Breittruck
6.7.2023 / 18 Uhr
Julia Breittruck (Historikerin, FernUniversität Hagen)
Salontier Vogel. Geselligkeit von Menschen und Vögeln in der Frühen NeuzeitOnline-Vortrag via Zoom
-
2023
Effrosyni Kontogeorgou
1.6.2023 / 18 Uhr
Effrosyni Kontogeorgou (Künstlerin, Bremen)
Nephelokokkygia/ Wolkenkuckucksheim. Von Vögeln kuratierte ZwischenräumeOnline-Vortrag via Zoom
-
2023
Felix Remter
9.2.2023 / 18 Uhr
Felix Remter (Umweltanthropologe, München)
Die posthumanistische Stadt. Streifzüge und Intraventionen.Online-Vortrag via Zoom
-
2022
Hörner/Antlfinger
8.12.2022 / 18 Uhr
Hörner/Antlfinger (Künstler*innen, Kunsthochschule für Medien Köln)
A Dollhouse for Dinosaurs. Einbrüche ins WohnenOnline-Vortrag via Zoom
-
2022
Christina Katharina May
14.7.2022 / 18 Uhr
Christina Katharina May (Kunsthistorikerin und Kuratorin, Halle an der Saale)
Fliegen und Flüchten - Volieren in der Moderne als bewegte HabitateOnline-Veranstaltung via Zoom
-
2022
Jörn Köhler
19.5.2022 / 18 Uhr
Jörn Köhler (Kurator Zoologie - Rezente Wirbeltiere, Naturgeschichte, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt)
Historie und Bedeutung der zoologischen Diorahmen im Landesmuseum DarmstadtOnline-Vortrag via Zoom
-
2022
Karl Schulze-Hagen
19.1.2022 / 18 Uhr
Karl Schulze-Hagen (Ornithologe, Mönchengladbach)
Die Vogel-WG: Forscheralltag in einer nicht-alltäglichen Mietwohnung um 1920Online-Vortrag via Zoom
-
2021
Thomas E. Hauck
18.11.2021 / 18 Uhr
Thomas E. Hauck (Landschaftsarchitekt, Technische Universität Wien)
Animal-Aided DesignOnline-Vortrag via Zoom
-
2021
Christina Ertl-Shirley
8.7.2021 / 18 Uhr
Knisternde Kopffüßer, komponierende Bohrkäfer und grummelndes Moos.
Ein Gespräch mit der Künstlerin und Kuratorin Christina Ertl-Shirley (Berlin) über die künstlerische Erforschung der Lebenswelten von Argonauta, Bärtierchen und HolzwürmernOnline-Veranstaltung via Zoom
-
2021
Kerstin Pannhorst
10.6.2021 / 18 Uhr
Kerstin Pannhorst (Wissenschaftshistorikerin, Berlin)
,Winged insects in all the daintiness of actual life’: Schmetterlingsschuppen auf Papier und Seide in Japan um 1900.Online-Vortrag via Zoom
-
2021
bn+BRINANOVARA
27.5.2021 / 18 Uhr
Artist Talk mit bn+BRINANOVARA (Mailand)
anlässlich der Ausstellung „Rendez-vous de chasse“ im Projektraum XPINKY BERLIN
(in englischer Sprache)Online-Veranstaltung via Zoom
Die Forschungswerkstatt ist eine Veranstaltung der Forschungsgruppe wohnen+/−ausstellen, die regelmäßig stattfindet. Die Forschungswerkstätten dienen einem vertieften wissenschaftlichen Austausch zu für das Forschungsfeld relevanten Themen. Die Forschungswerkstätten unterstützen die Profilierung laufender Forschungsarbeiten; sie sind Teil der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Gefördert werden Prozesse gemeinsamen Forschens, forschenden Lernens und Studierens. Die Forschungswerkstätten sind öffentliche Veranstaltungen, sie finden während des Semesters statt und sind auch für Studierende am IKFK offen. Neben den Mitgliedern der Forschungsgruppe wohnen+/−ausstellen werden Wissenschaftler*innen und Künstler*innen zu Vorträgen und Diskussionen eingeladen.
-
2025
Innen*Architektur. Geschlechterkonstellationen im Bild/Raum
27.6.2025 / 10 Uhr
Innen*Architektur. Geschlechterkonstellationen im Bild/Raum
7. ForschungswerkstattArchitektenkammer der Freien Hansestadt Bremen, Geeren 41/43, 28195 Bremen
Die Forschungswerkstatt widmet sich dem Verhältnis von Wohnen und Geschlecht in Kunst und Architektur sowie den konstitutiv damit verbundenen ästhetischen und medialen Strategien und Politiken. Welche Vorstellungen, Ordnungsprinzipien und Bedingungen bestimmen architektonisches und (wohn-)bauliches Denken und Handeln? Inwiefern prägen vergeschlechtlichte Narrative die kanonischen Erzählungen der Architekturgeschichte – wie lassen sich diese wiederum dekonstruieren? Wie gestaltet sich eine emanzipatorische Raumpraxis historisch wie gegenwärtig in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, -vielfalt und Teilhabe? Welche Anforderungen ergeben sich aus einer zeitgemäßen queer-/feministischen Perspektive?
Die 7. Forschungswerkstatt untersucht und diskutiert verschiedene vergeschlechtlichte Implikationen von Innen*Architektur und die Rolle von Architekt*innen und Künstler*innen im Kontext kritischer Raumpraxis.PROGRAMM
Kathrin Heinz
Begrüßung und Einführung
Christiane Keim
Charlotte Perriand auf LC 4. Das Bild der Designerin und die Blickregimes der Moderne (in den 1920er/1930er Jahren)
Jorun Jensen
Der Architekt denkt, die Hausfrau lenkt? (Visuelle) Diskurse zwischen Individual- und Zentralhaushalt im Neuen Bauen
Sonja Sikora
Farbe für alle? Innenarchitektur und Geschlechterkonzepte zwischen Stil und Stereotyp um 1900
Elena Zanichelli
In die Höhe getrieben. Zur Vergeschlechtlichung der Architektur in der feministischen MontageRosanna Umbach
qu[e]er gebaut – feministische Raumpraxis in Kunst und Architektur
Julienne Philipp, Franziska Rauh, Larissa Rausch
„Making something from nothing“ – Sammeln, Bauen und Ausstellen in/von Tressa Prisbrey’s Bottle Village (1956/2024)
Leonie Mühlegger
Bilderbuchstädte. Helen Rosenaus The Ideal City (1959) als gelesene feministische Architektur
+/-
Eine Veranstaltung des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des WOMEN IN ARCHITECTURE FESTIVAL 2025 statt.
Bundesweit präsentieren vom 19. bis 29. Juni mehr als 200 Akteur*innen 265 Projekte für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Baukultur. Das gesamte WIA-Festivalprogramm mit allen Terminen, Veranstaltungen, Akteur*innen und Orten ist auf der Website http://www.wia-festival.de veröffentlicht. Vom 19. bis 29. Juni 2025 finden bundesweit insgesamt 265 Events zur Sichtbarmachung von Frauen in Architektur, Innenarchitektur, Stadt- und Freiraumplanung sowie Bau- und Ingenieurbaukunst statt. Das Spektrum der Veranstaltungsformate reicht von Filmen, Vorträgen, Führungen über Ausstellungen und Konferenzen bis hin zu interaktiven Workshops.
Das Festivalprogramm für Bremen findet sich sowohl auf der Website http://www.wia-festival.de als auch auf der Website der Architektenkammer Bremen http://www.akhb.de/wia
Sofern nicht anders angegeben, ist der Eintritt zu den Veranstaltungen kostenlos.
Das WIA-Festival Bremen wird gemeinsam von den folgenden Institutionen ausgerichtet:
Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
Architects for Future Bremen
BREBAU GmbH Wohnungsgesellschaft Bremen
Bremer Zentrum für Baukultur
Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA im Lande Bremen
City 46 / Kommunalkino
FOPA Feministische Organisation Planerinnen und Architektinnen, Bremen
GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen
Hochschule Bremen, Fakultät Architektur, Bauen und Umwelt, School of Architecture Bremen
Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Universität Bremen
Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen
←→-
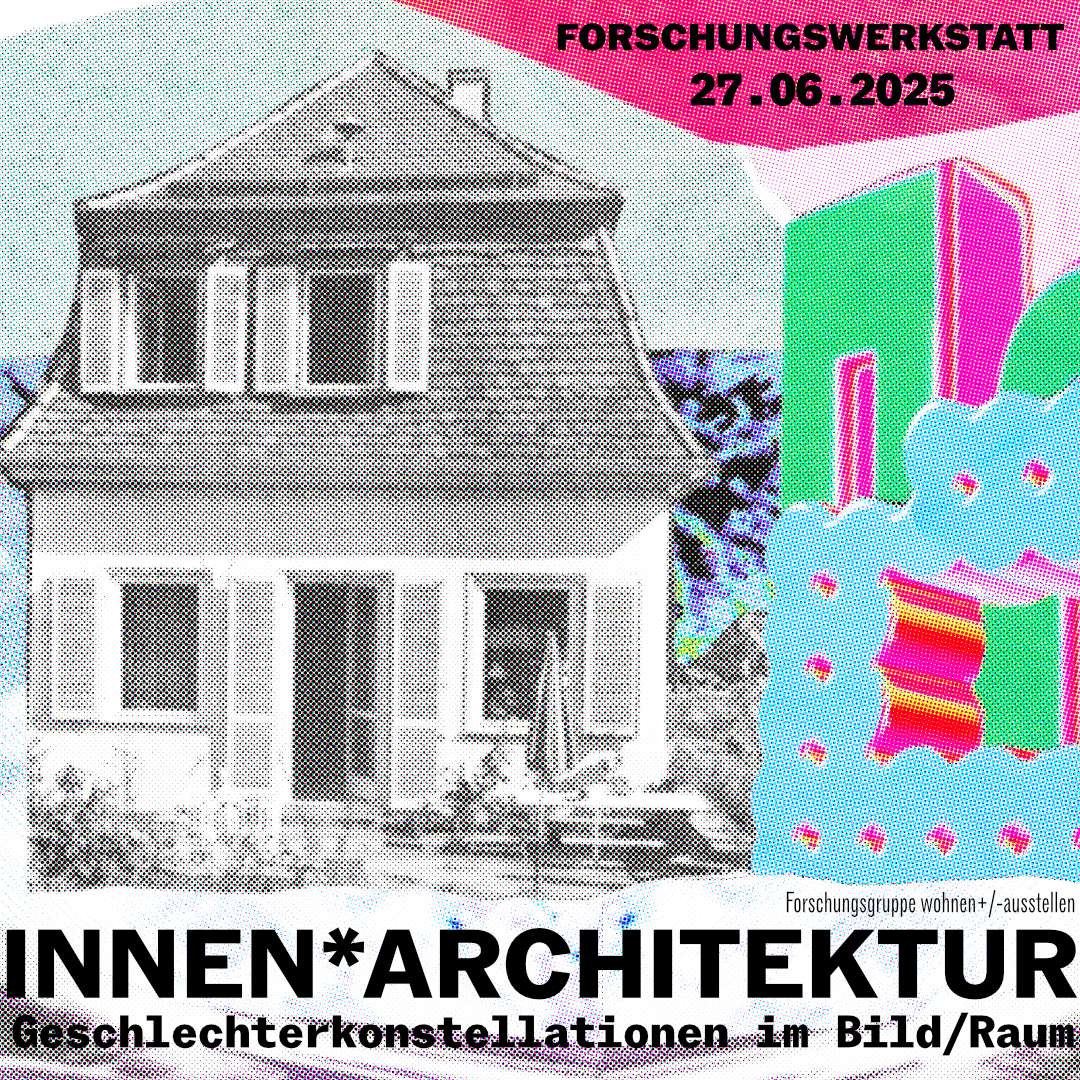
Rosanna Umbach -
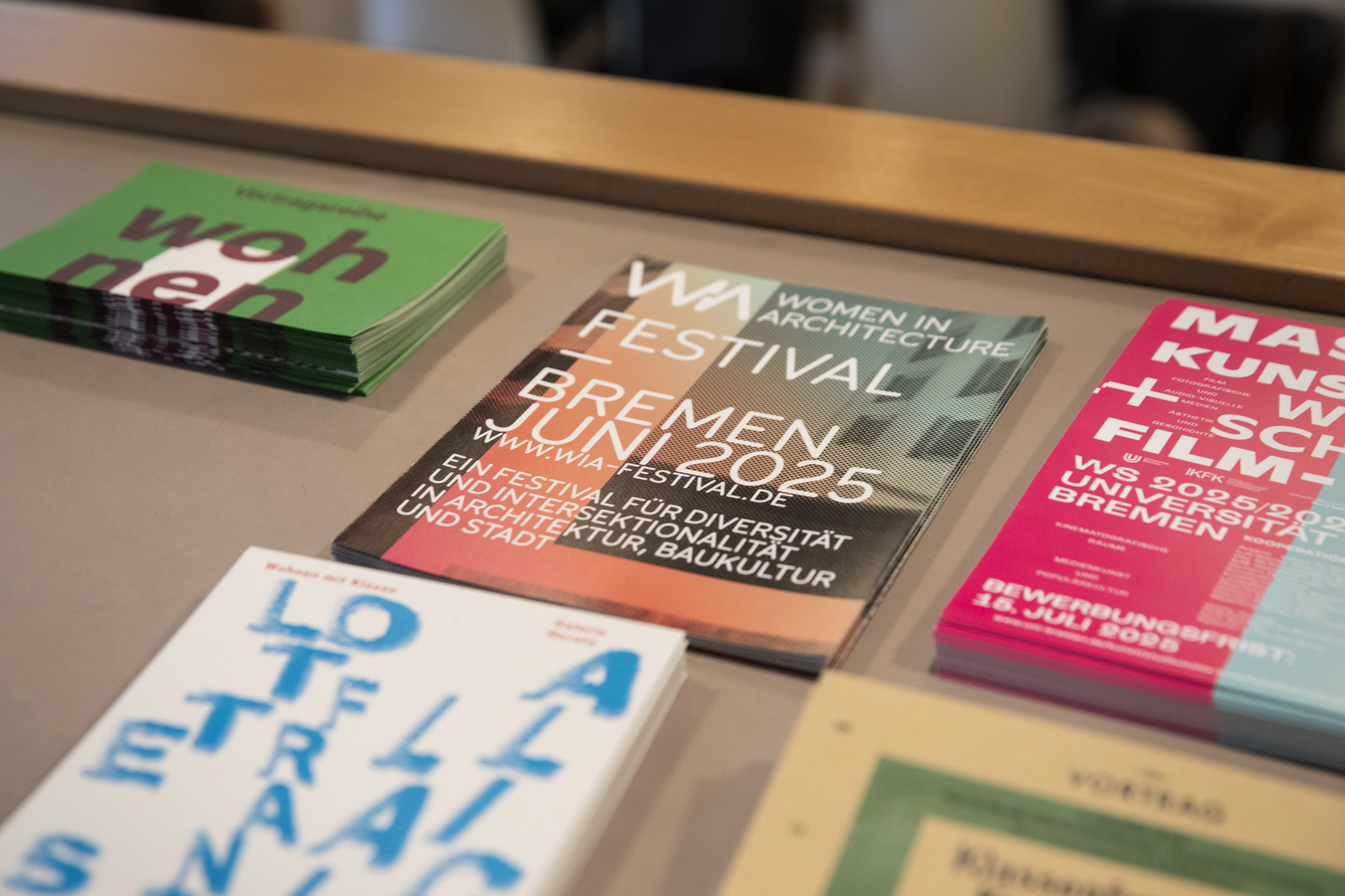
-

-

-

-

-

-
-
2022
RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen
4.2.2022 / 10 Uhr
RückBlicke: Visuelle Um_Ordnungen von Körpern und Räumen
6. Forschungswerkstatt
Online-Veranstaltung via Zoom
Wer schaut wen (und was) an und wer (oder was) blickt zurück? Wie sind Blickkonstellationen eingebunden in räumliche AnOrdnungen und die darin vernetzten Machtstrukturen? Welche EinBlicke ins Wohnen und dem darin verhandelten (Zusammen-)Leben gewähren verschiedene mediale Formate? Wie gestalten diese ästhetischen Strukturen Modi des Zeigens und An_Schauens? Inwiefern produzieren Ausstellungen bestimmte Raumkonfigurationen, in denen sich Blicke überkreuzen und Körper in Bewegung geraten? An welchen (Körper-)Grenzen verschwimmen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, wer ist drinnen, wer bleibt draußen?
Die 6. Forschungswerkstatt beobachtet Phänomene des RückBlickens als visuelle AnOrdnung und (historische) Beobachtung. Die Beiträge nähern sich Prozessen der UmOrdnung von Körpern und Räumen aus verschiedenen Blickrichtungen.PROGRAMM
Kathrin Heinz und Elena Zanichelli
Begrüßung und EinführungRosanna Umbach
Wohnen will gelernt sein. Von Pädagogisierung und Protestinterieur.
Bildlektüren zwischen den Zeit(schrift)en. Schöner Wohnen (1970–1979) und Zeit Magazin (2021).Christiane Keim und Astrid Silvia Schönhagen
Wohnliche Habitate. Perspektiven auf das Ausstellen mensch-tierlicher CohabitationAmelie Ochs
Stillleben der Konsumkultur.
Kunsthistorische Beobachtungen zur Sachfotografie am Beginn des 20. JahrhundertsMira Anneli Naß
Strategische Un_Sichtbarkeiten. Counter-Surveillance in der zeitgenössischen KunstNadja T. Siemer
RückBlicke in (die) Gegenwart.
Zeitlichkeiten in fotografischen Arbeiten von Yuki KiharaLinda Valerie Ewert
Looking back im Grassi Museum für Völkerkunde Leipzig:
Gegenwartskunst aus Kinshasa bekommt die kuratorische Carte BlancheAbschlussdiskussion
-
2017
(Sich-) In-Beziehung-Setzen: Wohndinge und Körperlichkeiten
26.1.2017 / 10 Uhr
(Sich-) In-Beziehung-Setzen: Wohndinge und Körperlichkeiten
5. Forschungswerkstatt
Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58, 28199 Bremen
Wie lassen sich Beziehungen, die im Denken über das Wohnen und gleichermaßen im Wohnhandeln entstehen, geordnet und umgeordnet werden, beschreiben? In welchen Formen treten Beziehungen zwischen Subjekten, Räumen und Dingen auf, in/mit welchen Medien werden sie gezeigt und vermittelt? Welche Rolle kommt Körperlichkeiten und Geschlechtervorstellungen innerhalb der Prozesse des (Sich-) In-Beziehung-Setzens zu? Die 5. Forschungswerkstatt richtet ihren Fokus auf Beziehungsstrukturen und Objektverhältnisse und wie diese Wohnen hervorbringen und vorführen. Die Beiträge nähern sich der Komplexität von Wohn-Beziehungen sowohl über Verhandlungen von Körperfragen, Hygiene und Hausarbeit wie über mediale Inszenierungen von Wohnmodellen in Zeitschriften und Online-Formaten.PROGRAMM
Irene Nierhaus
Begrüßung
Kathrin Heinz
Einführung
Elena Zanichelli
Unboxing, Haul – und die improvisierten Anderen: Räumliche Umordnungen in Online-Videoformaten
Rosanna Umbach
Küchen_Körper – Die Vergeschlechtlichung des technisierten Interieurs der Haus/Arbeit im „Schöner Wohnen“-Magazin der 1970er Jahre
Kathrin Heinz
Beziehungsweise im Sitzen
Mona Schieren
Körper- und Dingkonstellationen in asianistischen (Wohn-)Raumkonzepten
Katharina Eck
Der Schreibtisch als Mannequin: Möbel-Körper im ,showroom‘ zwischen Text und Bild des „Journal des Luxus und der Moden“
Anna-Katharina Riedel
Beziehungsaufbau in „Schöner Wohnen“: Vom „Es-sich-gemütlich-machen“ und „Die-freie-Wahl-haben“
Moderation: Astrid Silvia Schönhagen←→ -
-
2015
gewohnt|ungewohnt. Analysen und Spiegelungen in kunstwissenschaftlichen Forschungsprozessen
15.1.2015 / 09 Uhr
gewohnt|ungewohnt. Analysen und Spiegelungen in kunstwissenschaftlichen Forschungsprozessen
4. ForschungswerkstattUniversität Bremen, SFG, Raum 3070
Die Reflexion über Voraussetzungen unseres Denkens und methodologische Standpunkte ist elementarer Bestandteil wissenschaftlichen, transdisziplinären Arbeitens. Worauf zielt das eigene Lesen, Analysieren und Schreiben? Welche Methoden, Theorien und Forschungsansätze bilden das eigene konzeptuelle Feld? Wo artikulieren sich Widersprüche und (Be-)Grenzungen, wie lassen sie sich produktiv machen?
Im Sinne eines ‚Denklabors‘ befragt die 4. Werkstatt des Forschungsfeldes wohnen+/–ausstellen die Situierung des Forschungssubjekts in seinen (Selbst-)Reflexionen, Arbeitsweisen und Praxen. Anliegen ist eine kritische Haltung im Hinblick auf die Konstruiertheit des eigenen Denkens, seine Motivation, seinen experimentellen Antrieb und sein Begehren.PROGRAMM
Begrüßung durch die Leiterinnen des Forschungsfeldes wohnen +/- ausstellen
Irene Nierhaus und Kathrin HeinzKatharina Eck
Pendeln zwischen Wort und Bild: und was ich schreibe blickt mich an? …Kathrin Heinz
Löchrige Decken: Wissensbildung am ObjektHeidi Helmhold
Winterrock und Kamin. Vom Inner Space und Outer Space im WohnforschenMia Unverzagt
genäht - gestopft + zugefügt. Flickwerk in Gedanken, Gefühlen und BildernIrene Nierhaus
Zeichenflaute: Zeichen-Kontext-Leser_inJohanna Hartmann
Ein Bild als Konzepttext. Medialisierungen des Wohnens lesen mit Richard HamiltonMona Schieren
Von Textbildern, Denkfiguren und archipelischem DenkenChristiane Keim
Die Kunst, über Architektur zu schreibenSilke Bangert
„Kunst muss hängen“. Wer spricht wann, wie über was und wie spreche ich darüber?Astrid Silvia Schönhagen
On display im Wohn-Display: Der ethnografische Blick im Spannungsfeld von Wohnen, Ausstellen und Zu-Sehen-GebenAbschlussdiskussion
Moderation:
Astrid Silvia Schönhagen+/-
Organisation und weitere Informationen:
Astrid Silvia Schönhagen -
2013
Ding-Ich-Ding. Gegenstände und Subjektivierungsprozesse
25.4.2013 / 11:50 Uhr
Ding-Ich-Ding. Gegenstände und Subjektivierungsprozesse
3. ForschungswerkstattUniversität Bremen, GW 2, Raum: B2860
PROGRAMM
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz
EinführungChristiane Keim
What we collect. Dinge und Artefakte in den Ausstellungsinstallationen Alison und Peter Smithsons in den 1950er JahrenBrigitte Härtel
In den Dingen liegen. Otto Dix’ "Reclining Woman on a Leopard Skin" (1927) und Richard Müllers "Liegende mit grünem Sonnenschirm" (1925)Johanna Hartmann
Bilder von Dingen. Zu Visualisierungsstrategien des „Guten“ in der Deutschen Warenkunde, 1955-1961Theres Rohde
Von aufgeschlagenen Lektüren und vergessenen Teetassen – Auf den Spuren der „Wohnlichkeits-Attrappen“ in Ratgebern, Warenbüchern und Bau-AusstellungenCarina Bahmann
Geschmacksache(n). Überlegungen zu Gudrun Königs „Die Fabrikation der Sichtbarkeit: Konsum und Kultur um 1900“ (2011)Katharina Eck
Sich gut platzieren: Tapetenräume, Einrichtungsdinge und die Potenzierung der Imagination am Beispiel des Ovalen Saals in Bad Doberan und des Eisenacher KartausgartenViola Rühse
Siegfried Kracauers Wahrnehmung der DingeAngelika Bartl
Ent-/Materialisierungen? Subjektivierung und Privatheit im PostfordismusSilke Bangert
Subjektivierungsprozesse im Werk von Andrea Fraser. Zwischen Serviceleistung und DingcharakterAbschluss und Ausblick
Die Forschungswerkstatt ist eine Veranstaltung der Forschungsgruppe wohnen+/-ausstellen im Jahresschwerpunkt Haushaltungen – Ökonomien – Wohnen.
+/-
Organisation und weitere Informationen:
Angelika Bartl←→ -
-
2012
wohnen +- Körperlichkeit +/- Sexualität +/- ausstellen
16.-17.2.2012 11:45 Uhr
wohnen +- Körperlichkeit +/- Sexualität +/- ausstellen
2. ForschungswerkstattUniversität Bremen
PROGRAMM
Donnerstag, 16. Februar 2012, 10–19 Uhr, GW 2, B 2860
Freitag, 17. Februar 2012, 9.30–14 Uhr, SFG, 1420Johanna Hartmann
Sehend werden. Verknüpfungslinien von Wohnen und Ausstellen in der BRD der 1950er JahreIrene Nierhaus
Korpus: Wohnen und KörperlichkeitChristian Neumann
Couch Settings- Untersuchung von Möbelanordnungen und ihre Funktion im psychoanalytischen BehandlungszimmerChristiane Keim
Der Pavillon – ein Ort des Begehrens?Kathrin Heinz
Mannsbilder im Atelier. Künstlerische Körperlichkeit im EinsatzSilke Bangert
Der Künstler_innenkörper im Fokus. Andrea Frasers „Official Welcome“Angelika Bartl
Spurensuche. Dimensionen des Privaten bei Laura HorelliInsa Härtel
Doppelter Boden? Zum Phänomen Britney Spears -
2010
wohnen +/- ausstellen
6.5.2010 / 11:45 Uhr
wohnen +/- ausstellen
1. ForschungswerkstattUniversität Bremen
Am 06. Mai wurde die erste ganztägige Forschungswerkstatt veranstaltet, bei der die Mitglieder der Forschungsgruppe Bezüge ihrer Projekte zum Themenfeld wohnen +- ausstellen vorstellten und diskutierten.PROGRAMM
Irene Nierhaus
wohnen +/- ausstellen. Einführung
Johanna Hartmann
Wohnungen ohne Dach, Wohnungen hinter Glas und Mini- Wohnungen in Kisten- Formen des Ausstellens von Wohnraum
Christiane Keim
New (Out)-Looks: Die Case Study Houses (USA, 1940er bis 1960er Jahre) als mediale Ereignisse
Annette Urban
Kulissen – und Modellbau: Inszeniertes Wohnen in der zeitgenössischen Kunst
Annette Geiger
Die Geschmackslehre der Leere / Dinge und Undinge im Wohnraum und in der Kunstbetrachtung (Vom Biedermeier zum Loft-Living, von Goethe zu Judd)
Brigitte Härtel
Imaginationen von idealer Weiblichkeit gebunden an die Innenraumdarstellungen
Ninja Kaupa
Wohn- und Geschlechtermodelle für berufstätige Alleinstehende in Bremen in den 1950er und 1960er Jahren
Alexia Pooth
Die Materialisierung von Räumen am Ort: das Studio C. Holmead Phillips in München
Kathrin Heinz
KAN/DIN/SKY anzeigen – Künstler ausstellen
Silke Bangert
Die Präsentation eines Diskursraums: Selbstkonstituierung durch Kunst/ Kunst als Teil des privaten Lebens, des Wohnens... Andrea Fraser und ihre Ausstellung Eine Gesellschaft des Geschmacks (Kunstverein München: 20. Jan.–07. März 1993)
Mit diesem Format wird die Forschungsdebatte zu spezifischen Forschungsthemen vorangetrieben und die Vernetzung mit der nationalen wie internationalen Forschungsgemeinschaft ermöglicht. Im Sinn der Transdisziplinarität des Forschungsfeldes werden Forschungsansätze aufgegriffen, um diese im Hinblick auf aktuelle Fragestellungen produktiv zu machen und durch die Neuanordnung von Gegenständen, die Verknüpfung von Materialien und Materialitäten sowie von unterschiedlichen theoretisch-methodischen Ansätzen weiterführende Perspektiven entwickeln zu können.
-
2025
#ModeHund
11.-12.4.2025
#ModeHund. Modeinszenierungen, Geschlechtercodes und räumliche Settings in Mensch-Hund-Beziehungen seit der Frühen Neuzeit
Hochschule Trier, Fachbereich Gestaltung (Modedesign), Paulusplatz 4
Mode spielt eine wichtige Rolle im Zusammenleben von Mensch und Hund. Dies betrifft sowohl die menschliche Vorliebe für bestimmte Züchtungen als auch die Kleidung der Tiere. Der Hund als Partner*in, als Familienmitglied oder als Statussymbol ist wie kein anderes Haustier geeignet, die Beziehungen zwischen Tier und Mensch visuell zum Ausdruck zu bringen. Stil, Farbe und Material der tierlichen Kleidung sind dabei ebenso geschlechtlich gekennzeichnet wie das durch Züchtung hervorgebrachte körperliche Erscheinungsbild der Tiere – man denke etwa an sogenannte Modehunde wie den Mops oder den Foxterrier.
Wichtig ist auch die räumliche Situierung und Inszenierung der Mensch-Hund-Partnerschaft: Insbesondere Straßen und Plätze der Großstadt werden zu Laufstegen menschlicher Selbstdarstellung, wo Herrchen und Frauchen mit zeittypischen ,modischen‘ Hunden flanieren oder sich in modeästhetisch aufeinander abgestimmten Hund-Mensch-Teams präsentieren. Haustierhaltung in den Wohnräumen wiederum ist ein wichtiger Teil imaginierter und praktizierter Häuslichkeit: Sie dient dazu, soziale oder kulturelle Identität(en) auszubilden und zu bestärken.Die ‚Vermodung‘ des Hundes, die immer weiter voranschreitet, wirft aber auch tierethische Fragen auf: Welchen Einfluss hat die Pet-Industrie auf das Leben und den Alltag der Hunde und auf die Partnerschaft mit dem Menschen? Können Hunde tatsächlich, wie es die Werbung verspricht, von den spezifischen Angeboten dieser Industrie profitieren oder schaden sie ihnen eher?
Die Tagung behandelt die vielfältigen Facetten der Verflechtung von Mode(n), Hunden und Menschen von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Dabei werden potentielle Schnittstellen von Modewissen und Human Animal Studies, Gender- und (Wohn-)Raumforschung aufgezeigt. Ziel ist es, strukturelle Zusammenhänge innerhalb des Forschungsfelds aufzuzeigen und erstmals über Einzelbetrachtungen hinauszugehen.
Programm
Freitag, 11. April 2025
10:00–10:30 Uhr
Begrüßung / Einführung10:30–11:15 Uhr
Gundula Wolter
Mode. Pose. Hund: Über die Rolle des Hundes in Statusgemälden der Frühen Neuzeit11:15–12:00 Uhr
Jasmin Mersmann
Luxusgeschöpfe: Frauen und ihre Hunde in italienischen Porträts der Frühen Neuzeit12:00–12:45 Uhr
Klara von Lindern
Mops in Fashion! Objekterkundungen zu Hund-Mensch-Beziehungen, Mode und materieller Kultur im RokokoMittagspause
13:30–14:15 Uhr
Silke Förschler
Jagdgemälde, Porträt, Stilleben. Die Hunde Oudrys als Reflexionsfiguren14:15–15:00 Uhr
Samuel Uwem
Light camera action: Antique Dog Photographs of Dogs and Owners in Colonial South Africa15:00–15:45 Uhr
Adetola Elizabeth Umoh
Aww, how cute! Dogs on Parade in Nigeria Traditional Attire Dog Carnival ShowKaffeepause
16:30–17:30 Uhr
TED Talks: Astrid Silvia Schönhagen (Yinka Shonibares Hunde), Anne Biella („Schöner Wohnen“ mit Hund), Christiane Keim (Foxterrier und die Neue Frau in den 1920/30er Jahren)Samstag, 12. April
10:00–10:45 Uhr
Isabelle Voßkötter-Berens
„Welchen Hund trägt man?“ – Mensch-Tier-Inszenierungen in der Eleganten Welt der 1910er Jahre10:45–11:30 Uhr
Petra Leutner
Die Arbeitskleidung der Hündin Laika und die Bedeutung der „Lufthunde“ von Franz Kafka11:30–12:15 Uhr
Burcu Dogramaci und Helene Roth
Daisy and Me: Der Modeschöpfer Rudolph Moshammer und seine Yorkshire-Hündin12:15–12:45 Uhr
TED Talks: Barbara Schrödl (Haushunde & Brehms Tierleben), Christina Threuter (Dackel-Moden)13:30 Uhr
Verabschiedung (Abreise)
+/-Um Anmeldung zur Tagung unter folgender Adresse wird gebeten: keim@uni-bremen.de
Bitte geben Sie an, ob Sie online teilnehmen oder zum Tagungsort anreisen möchten.Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos.
Konzept und Organisation:
Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen, Barbara Schrödl, Christina ThreuterDie Tagung ist eine Kooperation der Hochschule Trier/ FB Gestaltung, Studiengang Modedesign,
des Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und des netzwerk mode textil. Interessenvertretung der kulturwissenschaftlichen Textil-, Kleider- und Modeforschung e. V.←→ -
-
2024
Wohn-Museen
11.-12.5.2024
Symposium
Wohn-Museen. Sammeln als Lebenspraxis – Charlotte von Mahlsdorf und das GründerzeitmuseumBerlin, Gründerzeitmuseum Mahlsdorf
Das 1960 eröffnete Gründerzeitmuseum ist das Lebenswerk Charlotte von Mahlsdorfs. Über Jahrzehnte hat die einstige Bewohner*in gründerzeitliche Möbel und Alltagsgegenstände zusammengetragen und in selbst eingerichteten Räumen präsentiert. Ihre Vorliebe für die Epoche zwischen 1870 und 1900 sowie ihre extensive Sammelleidenschaft verschränkten sich dabei zu einer beeindruckenden musealen Inszenierung gründerzeitlichen Wohnens. Zugleich wurde das ehemalige Gutshaus in den 1970er Jahren zu einem Treffpunkt für Lesben und Schwule in der DDR. Heute steht das Gründerzeitmuseum für das Werden eines biografisch geprägten Ausstellungsortes, an dem sich persönliche Erinnerung und Erinnerungsarbeit, politische Geschichte und historisches „Wohnwissen“ (Irene Nierhaus) verknüpfen.
Das Symposium rückt das Gründerzeitmuseum als Beispiel eines Sammler*innen-Museums in den Fokus und kontextualisiert es mit weiteren Formen musealisierten Wohnens. Sammeln, Ausstellen und Archivieren als widerständige, teils nonkonforme Alltagspraktiken werden in diesem Zusammenhang ebenso untersucht wie mögliche Wohnerzählungen, die von den Bewohner*innen solcher Orte entworfen werden. Zugleich wird gefragt, welche Herausforderungen und Perspektiven diese Orte für eine kunst- und kulturwissenschaftliche Wohnraumforschung eröffnen.PROGRAMM
Donnerstag, 11. Juli 2024
14.30–15.45 Uhr
Monika Schulz-Pusch (Gründerzeitmuseum Mahlsdorf)
Begrüßung
Kerstin Brandes, Kathrin Heinz, Astrid Silvia Schönhagen (Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen, Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender)
Einführung
15.45–17.00 Uhr
Monika Schulz-Pusch
Führung durch das Gründerzeitmuseum Mahlsdorf
17.00–17.30 Uhr
Pause
17.30–19.30 Uhr
Dokumentarfilm „Sonntagskind. Erinnerung an Charlotte von Mahlsdorf“, D 2018, 108 min, Regie: Carmen Bärwaldt
Freitag, 12. Juli 2024
10.00–10.45 Uhr
Irene Nierhaus (Wien/Bremen)
Möbelbezug: Sammeln und Aussagepolitiken
10.45–11.30 Uhr
Birgit Johler (Graz)
Bauernzimmer mit Vitrine oder das geteilte Haus. Wohnwelten eines Wiener volkskundlichen Akteurs
11.30–11.45 Uhr
Pause
11.45–12.30 Uhr
Anja Eichler (Wetzlar)
Lebenswelten einer Sammlerin. Dr. Irmgard von Lemmers-Danforth und ihre Sammlung „Europäische Wohnkultur der Renaissance und des Barock“ in Wetzlar
12.30–13.30 Uhr
Mittagspause
13.30–14.15 Uhr
Stefan Gruhne (München)
Wohnort queerer Geschichte(n). Einblicke in die Sammlungs- und Ausstellungspraxis im Forum Queeres Archiv München
14.15–15.00 Uhr
Susanne Huber (Bremen)
Bürgerlichkeit als Kink: Queere Häuslichkeit in Rosa von Praunheims „Ich bin meine eigene Frau“ (1992)
15.00–15.15 Uhr
Pause
15.15–16.15 Uhr
Abschließende Diskussion zur Perspektivenentwicklung+/-
Veranstaltungsort:
Gründerzeitmuseum Mahlsdorf, Hultschiner Damm 333, 12623 Berlin
http://www.gruenderzeitmuseum-mahlsdorf.de
Der Eintritt ist frei.
Begrenzte Teilnehmer*innenzahl, Anmeldung bitte bis zum 23. Juni 2024 unter info@msi.uni-bremen.de.
Das Symposium ist eine Kooperation des Gründerzeitmuseums Mahlsdorf mit dem Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik / Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen.
Konzept:
Kerstin Brandes, Kathrin Heinz, Astrid Silvia Schönhagen←→ -
-
2023
Classifying home
16.-17.6.2023
Classifying home – Wohn-Raum-Bilder und Klassenverhältnisse in Zeitschriften und seriellen Medien
Welche Rolle spielen Zeitschriften und serielle Medien bei der Vermittlung von Wohnbildern und Klassenverhältnissen? Wie werden darin Bilder von Wohnen und Klasse (re-)produziert? Inwiefern sind wiederum (Wohn-)Medien und Architektur daran beteiligt, (stereotype) Vorstellungen von Klasse bzw. Klassenverhältnissen zu zementieren? Inwiefern werden Klassenverhältnisse und -zugehörigkeiten über Wohndinge, Geschmacksdiskurse, Ästhetikgemeinschaften und Bild- bzw. Sprachpolitiken reflektiert und wo bleibt das bürgerliche Wohnen zwischen Schöner Wohnen und Instagram als unmarkierte Norm bestehen? Welche Darstellungsformen proletarischen Wohnens finden sich überhaupt in (Wohn-)Zeitschriften und seriellen Medien?
Die Forschungswerkstatt des internationalen Forscher_innennetzwerks [wohn]zeitschriften am Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender richtet den Fokus auf die gesellschaftlichen Anordnungen von Wohnen und Klasse in Bild und Text serieller Medien. Die Beiträge aus Kunstgeschichte und -wissenschaft, Designgeschichte, Architektur(-wissenschaft), Geschichte und Historischer Bauforschung nähern sich über Zeitschriften und andere serielle Medien den ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Wechselverhältnissen, die in Wohn-Raum-Bildern (mit) produziert werden.
PROGRAMM
Freitag, 16. Juni 2023, 18–20 Uhr, City 46, Kino 2
Filmscreening und Künstlergespräch
Arne Schmitt mit Radek Krolczyk, Amelie Ochs und Rosanna Umbach
Arne Schmitt: Mit weniger mehr schaffen (2016) und Wohnbedarf. Zum Verhältnis von kulturellem und ökonomischem Kapital (2021)Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender/Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen mit der Galerie K′ und dem b.zb Bremer Zentrum für Baukultur.
Samstag, 17. Juni 2023, 10–18 Uhr, Universität Bremen, GW2 B2900 und hybrid*
Kathrin Heinz, Bremen
Leiterin des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender
BegrüßungAmelie Ochs und Rosanna Umbach, Bremen
Wohnen klassifizieren, Klasse zeigen? Eine Einführung mit Blick auf den Krisenherd Küche in WohnzeitschriftenWohnen mit Klasse?!
Warm-Up WorkshopValentin Hemberger, Gießen
Von „Wanzenburg“ bis „Wohnpalast“: Darstellungsformen proletarischen Wohnens in linkspolitischen Illustrierten der Weimarer Republik" – erste Annäherungen und ÜberlegungenLaura Ingianni Altmann, München
Rationalisierung für alle?
Der Neue Haushalt in Ausstellungen der Weimarer RepublikModeration: Sonja Sikora
Linda Stagni, Zürich
Joseph Gantner's Das Werk and the Idea of the Public, 1923–1927Zofia Durda, Ehestorf
„Menschen wie du und ich“. Geschmackserziehung und Vorstellungen von Klasse in
der Quelle-Fertighaus-FibelModeration: Amelie Ochs
Monique Miggelbrink, Paderborn
„Futuristische Wohnzimmer“? Das Interieur als (vergangene) Zukunft des elektrischen AutosBernadette Krejs, Wien
Plattform Wohnen
Über die (Re)Produktion visueller Werte- und Ästhetikgemeinschaften auf InstagramModeration: Rosanna Umbach
Abschluss
+/-
Die Forschungswerkstatt ist eine Veranstaltung des internationalen Forscher_innennetzwerks [wohn]zeitschriften.
Konzeption und Organisation:
Amelie Ochs und Rosanna Umbach←→ -
-
2022
Das Jagdzimmer
4.-5.11.2022
Das Jagdzimmer. Wohnstile, Geschlechterkonstruktionen und die Aneignung von Natur im Zeichen des erlegten Tieres
Universität Bremen, GW 2, Raum B2900 und hybrid
Das Jagdzimmer repräsentiert in der Geschichte des Wohnens einen komplexen Typus. Dieser zeichnet sich durch eine Vielzahl von Raumformen und unterschiedliche gestalterische Inszenierungen aus. Sowohl von der kulturwissenschaftlichen Wohnraumforschung wie auch den Cultural Human-Animal Studies sind die im Jagdzimmer sichtbar werdenden Praktiken des Einrichtens und Wohnens mit erlegten Tieren und Waffen bisher weitgehend vernachlässigt worden. Die Tagung lenkt den Blick auf exemplarische Räume und räumlich konzipierte Imaginationen des Jagdlichen sowie deren koloniale, soziale und geschlechtliche Implikationen.PROGRAMM
Freitag, 4. November 2022
Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen (Bremen/Berlin)
Begrüßung und Einführung
JAGDZIMMER UND SCHLOSSARCHITEKTUR
Heiko Laß, München
Jagdzimmer im frühneuzeitlichen Schlossbau des Alten Reiches
TROPHÄEN (IN) DER KOLONIALGESCHICHTE
Sandy Nagy, Waldenburg
Von der Wildnis an die Wand – Die Geschichte(n) der Jagdtrophäen im Naturalienkabinett Waldenburg
Maximilian Preuss, Kassel
Das Jagdzimmer als Vorzimmer des Museums.
Die koloniale Jagd und die Provenienz tierlicher Relikte im Museum Witzenhausen
Samstag, 5. November 2022
(GESCHLECHTLICHE) IMAGINATIONEN JAGDLICHEN WOHNENS
Kerstin Brandes, Bremen
Das Jagdzimmer in Charlotte von Mahlsdorfs Gründerzeitmuseum – Wild-Fantasien und Abstaube-ObjekteChristian Saehrendt, Thun/CH
Das Jagdzimmer des Hochstaplers: Karl Mays Selbstinszenierung in der Villa Shatterhand
JAGD, HEIMAT, NATION
Helmut Suter, Groß-Schönebeck
Jagdzimmer unter dem Hakenkreuz am Beispiel der SchorfheideBarbara Schrödl, Wolfsburg/Berlin
Die Wirtshausstube im Heimatfilm der 1950er-Jahre. Ein jagdlich dekorierter Raum der (Re-)Organisation der Geschlechterordnung
MUSEALE DISPLAYS DES JAGDLICHEN
Raphael Beuing, München
Der Jagdsaal im Bayerischen Nationalmuseum in MünchenVerena Kuni, Frankfurt am Main
Trophäen der Wissenschaft. Das Naturkundemuseum als Jagdzimmer
Sarah Wade, Norwich/GB
Challenging Trophies? Artistic and Curatorial Approaches to Displaying Hunting Trophies at a Time of Mass Extinction
+/-Konzeption und Organisation:
Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen
Die Tagung ist eine Veranstaltung des Forschungsprojekts c/o HABITAT TIER im Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen, in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender.←→ -
-
2021
Ästhetische Ordnungen des Wohnens
18.-20.6.2021
Ästhetische Ordnungen des Wohnens
Zu bildlichen Politiken des Wohnens, Häuslichen und Domestischen in Kunst und visueller Kultur der ModerneEine Internationale Tagung pandemiebedingt als Online-Veranstaltung via Zoom
Künste und Visuelle Kultur produzieren Vorstellungswelten des Wohnens. Im Zeigen der Bilder machen verschiedene Bildsorten, Genres, Bildstrategien und visuelle Verfahren (An)Ordnungen, Prinzipien, Praxis und Poiesis vom Wohnen, Häuslichen und Domestischen augenscheinlich. Das Domestische ist ein Geflecht aus den unter-schiedlichsten Diskursen zur gesellschaftlichen Formation des Wohnens als normalisierender Aufenthalt innerhalb des Sozialen. Darin werden Beziehungen zwischen Bewohner*innenschaft, Räumlichkeit und Objekten/Dingen gestaltet. Mit der Moderne seit 1800 werden diese Beziehungen als identitätsproduzierende Verhältnisse in Subjektivierungs- und Gemeinschaftsbildungsprozessen konzipiert, gelebt und fortwährend ästhetisch entworfen und in Bildlichkeit transformiert.
PROGRAMM
Freitag, 18. Juni 2021
Irene Nierhaus und Kathrin Heinz
Ästhetische Ordnungen des WohnensPhilipp Zitzlsperger, Berlin
Interieurmalerei und das Interieur als Gesamtkunstwerk vor dem 20. JahrhundertSusan Sidlauskas, New Brunswick/New Jersey
Cézanne’s Domestic UncannyModeration: Elena Zanichelli
Edith Futscher, Wien
„...aber das Haus, das war bereits ein Film“Amelie Ochs, Bremen
Domestische Ding-Bilder. Über das Stillleben als Einrichtungsgegenstand im 20. JahrhundertModeration: Mona Schieren
Temma S. Balducci, Fayetteville/Arkansas
Creativity, Domesticity, and the Female Body: Matisse’s Red StudioModeration: Christiane Keim
Samstag, 19. Juni 2021Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâthie, Paris
The Domestic Space as an Artistic Strategy: the Intimate Photographic Album of Pablo PicassoMira Anneli Naß, Bremen
"Untitled ('My Bed')". Zum Domestischen als feministische Bildstrategie bei Lina ScheyniusModeration: Astrid Silvia Schönhagen
Burcu Dogramaci, München
Wohnen mit Stachel: Kaktusfenster, Kakteengefäße und Interieur(-Fotografie) der 1920er JahreAnnette Tietenberg, Braunschweig
Wo das Domestizierte und das Domestische sich begegnen: der Monstera deliciosa und der Ficus elastica als Dekorelemente des Sachlichen WohnensChristiane Keim, Bremen
CATviews. Eine Lektüre von David Hockneys Mr. and Mrs. Clark and Percy (1971) als interspecies- Begegnung im WohnenModeration: Rosanna Umbach
Piotr Korduba, Posen
Wie verwendet man die Volkstümlichkeit in Innenräumen? Die propagandistischen Bildstrategien vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in PolenPhilipp Oswalt, Kassel
Der Film „Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich“. Konstruktion und Fiktion der Marke BauhausEliana Perotti, Zürich
Befreite Körper – befreiter Raum. Vom Unterwäschedesign zur Ausstellungs- und Wohnraumgestaltung von Lilly ReichModeration: Amelie Ochs
Sonntag, 20. Juni 2021
Rosanna Umbach, Bremen
Familienanumordnungen im Display der Zeitschrift Schöner Wohnen (1960–1979)Elena Zanichelli, Bremen
Zwischen Baby- und Beischlaf. Der dissonante Charme des Häuslichen in Deana Lawsons afro-amerikanischen Familienporträts (2009–2016)
Bernadette Krejs, Wien
Insta(gram) Wohnen – How we fell for (or in love with) digital image worlds. Über die (Re)produktion neuer WohnidealeModeration: Mira Anneli Naß
+/-
Konzept und Tagungsleitung
Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus, Dr. Kathrin HeinzKoordination und Organisation
Amelie OchsGestaltung
Christian Heinz←→ -
-
2019
WohnSeiten
10.-12.5.2019
WohnSeiten: Ins Bild gesetzt und durchgeblättert.
Zeigestrategien des Wohnens in ZeitschriftenUniversität Bremen, GW 2, B 2880
Wohnen will gelernt sein... Eher veränderlich als un-verrückbarer Zustand, ist Wohnen auch Handeln. Dieses Handeln ist Teil gesellschaftlicher und politischer Prozesse und Zuschreibungen und wird sowohl beständig als auch immer wieder neu vermittelt. Im Angebot der illustrierten (Massen-) Presse findet sich eine schier unüberschaubare Menge an Bildern und Diskursformationen des Wohnens und Einrichtens: Wer wohnt wie und mit wem, mondän, prekär, minimalistisch, prunkvoll ... Seite für Seite werden Einrichtungstipps, Homestories und Anleitungen zum „richtigen“ Wohnen vermittelt und gelehrt. Zeitschriften, Magazine, Journale und mediale Verbünde mit einem Schwerpunkt auf Wohnpraktiken stehen bei dieser Tagung mit ihrer seriellen, auf ein didaktisches Programm ausgerichteten Ästhetik im Fokus: Durch spezifische Zeigemechanismen werden Subjekte in ihren Wohnweisen adressiert und zum Tätigwerden aufgefordert. Es wird geclustert, gefaltet, seitenweise angeordnet, eingeschrieben, ausgelassen, vor allem aber auch: wiederholt und fortgesetzt.
Die ästhetische Struktur der Zeitschrift gibt Machtkonstellationen zu sehen, durch die Bewohner_innen und Leser_innen als sozial und politisch Agierende, vergeschlechtlichte und konsumierende Subjekte adressiert werden. Von frühen Mode- und Familienjournalen bis zu aktuellen Formaten sollen Darstellungen des Wohnens als sich selbst in Gang haltende Kategorisierungs- und Bewertungspraxen untersucht werden.
Die transdisziplinäre Tagung möchte Positionen aus Kunstwissenschaft, visueller Kultur, Architektur, Design und Medienwissenschaft zusammenbringen, um im Display der Zeitschrift über das Zu-Sehen-Geben von Wohn-Raum, seiner Architektur und Einrichtung sowie der in ihm und mit ihm agierenden Bewohner_innen zu diskutieren.PROGRAMM
Freitag, 10. Mai 2019
Begrüßung durch die Leiterinnen des Forschungsprojekts Wohnseiten
Irene Nierhaus
Seiten des Wohnens
Kathrin Heinz
Gewohnte Blätter
Einführung in das Tagungsprogramm
Katharina Eck, Anna-Katharina Riedel, Rosanna Umbach
WohnSeiten: „Vorweg gesagt“ und aufgeblättert
Stefan Muthesius, Norwich
Zur Publizistik des „schönen Heims“ im späteren 19. Jahrhundert
Nina Reusch, Berlin
Wohnen als Kulturgeschichte – Zur Vergeschlechtlichung von Wohnen und Geschichte in Familienzeitschriften des 19. Jahrhunderts
Beate Söntgen, Lüneburg
Bloomsbury en Vogue. Vom Leben in Darstellungen
Moderation: Katharina Eck
Samstag, 11. Mai 2019
Vance Byrd, Grinnell
Creating Home by Hand in Nineteenth-Century Illustrated Fashion Periodicals
Dagmar Venohr, Hamburg
Medienclash und Modehandeln – Zur Ikonotextualität der Modestrecke
Moderation: Johanna Hartmann
Annette Tietenberg, Braunschweig
„Gutes und Böses in der Wohnung in Bild und Gegenbild“
Moralische Appelle an die „Hüterinnen des Geschmacks“ in der „Deutschen Frauen-Zeitschrift“ in der Ära des Nationalsozialismus
Amelie Ochs, Berlin
Flugschrift? Fibel? Fotobuch?
Ein Bilderbuch des Deutschen Werkbundes für junge Leute (1958)
Moderation: Rosanna Umbach
Rudolf Fischer, Dresden
Behaglichkeit im Kalten Krieg? Kontinuitäten im Wohn- und Raumdesign
Lea Horvat, Hamburg/Berlin
From Mass Housing to Celebrity Homes:
Socialist Domesticities in Yugoslav Popular Magazines
Alexander Wagner, Wuppertal
Kultur im Heim. Die Sphärendynamik des „Wohnens“ in Wohnzeitschriften der DDR
Moderation: Anna-Katharina Riedel
Sonntag, 12. Mai 2019
Monika Wucher, Hamburg
„Wir leben nicht, um zu wohnen.“
Soziale Kritik des Wohnens in der Bauhaus-Zeitschrift
Änne Söll, Bochum
„The House of Good Taste“ – Die Rolle von period rooms und historistischen Wohneinrichtungen in amerikanischen Wohnzeitschriften der 1920er bis 1950er Jahre
Donatella Cacciola, Bonn
„Moderne Klassiker“ für alle? Blättern durch 50 Jahre Zeitschriften (1960–2010) in der Bundesrepublik Deutschland – oder: „Glossy paper is elsewhere“
Moderation: Christiane Keim
Monique Miggelbrink, Paderborn
Home Computer: Kulturelle Imaginationen häuslicher Computernutzung in historischen Popularisierungsdiskursen
Insa Härtel, Berlin/Hamburg
Wohndingbezüge und Müll-Aufnahmen: Messiesendungen im Detail
Mona Schieren, Bremen
Einrichten in der Apokalypse. Prepper-Wohnfantasien in Outdoor Magazinen
Moderation: Franziska Rauh
+/-
Internationale Tagung des Forschungsprojekts Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen im Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft - Filmwissenschaft - Kunstpädagogik an der Universität Bremen mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender (Leitung: Prof. Dr. Irene Nierhaus, Dr. Kathrin Heinz).Konzeption und Organisation der Tagung:
Dr. Katharina Eck, Anna-Katharina Riedel, Rosanna Umbach
Organisatorische Unterstützung:
Ellen Haak
Gestaltung:
Christian Heinz←→ -
-
2018
Unbehaust Wohnen
3.-6.5.2018
Unbehaust Wohnen: Verheerende wie diskrete Desaster.
Perspektiven auf gesellschaftliche Wohnorte und Aufenthalte im AlltäglichenEine internationale Tagung im Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58, 28199 Bremen
Das Sprechen über Wohnen ist oft doppelt positiv als Daseiendes und Gutes: Wohnen ist da. Es ist gebaut, es ist ausgestattet, es existiert durch Häuser, Wohnungen, Möbel. Seine Geschichte wird durch seinen Bestand, seine Dinglichkeit in der Wissenschaft bis hin zur persönlichen Erinnerung erzählt. Wohnen erscheint als positivistisch Gegebenes. Und Wohnen wird gerne als positiv, im Sinn von gut als sichernder und glücklicher Raum eines Selbst, einer Familien-, Status- oder Territorialzugehörigkeit beschrieben.
Dem Wohnen als Existenz und Heim/at steht jedoch auch ein unbehaustes Wohnen zur Seite: Zerstörtes Wohnen, wie in kriegerischen Konflikten, verlorenes Wohnen in Migrationen, temporäres Wohnen in Obdach- und Wohnungslosigkeit, prekäres Wohnen in ökonomischer, emotionaler und körperlicher Unversorgtheit, ängstliches Wohnen in Subjektkrisen – Unbehaustes Wohnen von den großen Verheerungen bis zu heimlichen und diskreten Schrecknissen. Unbehaust Wohnen schließt das Konflikthafte im Behausten ein und attackiert und demoliert es zugleich.
Unbehaust Wohnen ist ein stetiger Teil der Geschichte und Theorie des Wohnens. Es ist einerseits vergessen, nicht besprochen, verborgen oder wird zum Diskurs von Spezialist_innen des Sozialen und ist andererseits – wie in Kunst und Theorie – auch ein besonders sichtbar gemachter Teil des Wohnens, denn in der Wohnkritik wird es zur Gegenrede, zum gewollt Nichtidentischen und Instabilen, zur Flucht aus einer als desaströs befundenen Zuflucht. In diesem Entgrenzen des Behausten wohnt oft auch eine Versprechensrhetorik auf Auszug ins Befreite inne.
Die Tagung wird verschiedene Ebenen des Unbehausten aus kunstwissenschaftlicher, architekturtheoretischer, filmwissenschaftlicher, philosophischer, ethnologischer, psychiatrischer und künstlerischer Perspektive thematisieren.PROGRAMM
Donnerstag, 3. Mai 2018
Grußwort der Dekanin des Fachbereichs Kulturwissenschaften
Dorle Dracklé
Unbehaust Wohnen. Konzeptideen
Leiterinnen des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen
Irene Nierhaus und Kathrin Heinz
Burcu Dogramaci, München
Shelter/Disaster: Flucht, Schutz und Architektur in der Moderne
Gabu Heindl, Wien
Zu einer radikaldemokratischen Kritik von solidarischem Wohnen Rotes Wien 1920, habiTAT Wien 2020
Klaas Dierks, Bremen
Filmvorführung „Die letzten Tage des Sommers“ (2006) mit Vortrag des Regisseurs
Moderation: Irene Nierhaus
Freitag, 4. Mai 2018
Salvatore Pisani, Saarbrücken
Le Vele di Scampìa. Sterbende Moderne filmisch beschleunigt
Franziska Rauh, Bremen
„Get Outta My Dreams, Get Into My Car“. Das Fahrzeug als Ort sexualisierter Gewalt und des Widerstands in Three Weeks in May (1977) von Suzanne Lacy
Drehli Robnik, Wien
Einrichtungen zum Zusammensein mit lost causes: Film und Demokratie, behaust und exhausted in Zeiten des Faschismus (gedacht mit Kracauer)
Moderation: Kathrin Heinz
Cathrine Brun, Oxford
Shelter in flux: the temporality of dwelling in crises
Moderation: Christiane Keim
Kurdwin Ayub, Wien
Filmvorführung „Paradies! Paradies!“ (2016) und Gespräch mit der Regisseurin
In Zusammenarbeit mit dem City46
Moderation: Anna-Katharina Riedel
Samstag, 5. Mai 2018
Sara Al-Nassir, Dresden
Narrating Zaatari. The Interplay of Agency and Structure in Constituting Zaatari’s Market Street
Birgit Johler, Wien
„Ausgezogen, umgezogen, abgemeldet“ – zur Wohn- und Lebenssituation der vom NS-Regime als Jüdinnen und Juden Verfolgten in Wien ab 1938
Elke Krasny, Wien
UN_Behaust: Vom Recht auf Wohnen in Zeiten globaler Krise
Moderation: Johanna Hartmann
Christian Berkes, Berlin/Potsdam
Disrupted Living. Wohnen und die Sprache der Sharing Economy
Michalis Valaouris, Berlin
„The Fear of God is an excellent Gift“
Überwachen und Sticken im 17. Jahrhundert
Michael Schödlbauer, Hamburg
Verrückte Möbel: Paranoia der Hausgemeinschaft und andere psychotische Heimsuchungen
Moderation: Rosanna Umbach
Sonntag, 6. Mai 2018
Mehmet Emir, Wien
Da und Dort Zuhause
Sigrid Adorf, Zürich
Sich im Unbehausten einrichten? Gedanken zum kunstkritischen Verbrauch eines Begriffs und seiner kritischen Brauchbarkeit trotz allem
Moderation: Anna-Katharina Riedel
Cornelia Klinger, Hamburg/Tübingen
Allein-Wohnen. ‚Unbehaust‘-Sein als conditio humana und andere Arten von Einsamkeit
Barbara Claassen-Schmal, Bremen
„Shelter I“ 2014
Bericht über ein Projekt von Evelyn Möcking und Daniel Nehring
Moderation: Katharina Eck
+/-
Leitung und Konzept:
Prof. Dr. Irene Nierhaus und Dr. Kathrin Heinz
Organisation:
Johanna Hartmann, Anna-Katharina Riedel
Gestaltung:
Christian Heinz -
2017
Seiten des Wohnens
12.-13.5.2017
Seiten des Wohnens: Bild, Text, Serie
Workshop an der Universität Bremen
Schöner Wohnen, Landlust, Journal des Luxus und der Moden… Diese und weitere Zeitschriften zielen darauf ab, bereits auf den ersten Blick Ideale und Handlungsweisen des Wohnens zu vermitteln. Über Kriterien wie die einer ‚guten‘ und ‚stilvollen‘ Dekoration im Wohnraum hinaus, geht es um die Ausgestaltungen von Beziehungsräumen in all ihren ästhetischen, sozialen, politischen und didaktischen Dimensionen. Seit der Herausbildung und Ausdifferenzierung des Genres der Wohnzeitschriften im Verlauf des 19. Jahrhunderts werden durch Präsentationen von Wohnen, Innenräumen, Architektur und Alltagspraktiken Subjektivierungsweisen mitproduziert. Die Wohndiskurse und die Ästhetiken ihrer Zur-Schau-Stellung wirken buchstäblich und bildlich von allen Seiten in die Gesellschaft und werden im Workshop auf ihre Zeige- und Nichtzeige-Strategien hin untersucht. Dabei werden verschiedene Medien, sowohl aktuelle Zeitschriften als auch historische Presseerzeugnisse und andere serielle Formate, analysiert.
PROGRAMM
Freitag, 12. Mai 2017
Begrüßung und Einführung
der Leiterinnen des Forschungsprojektes Wohnseiten
Irene Nierhaus
Bildraum Wohnen im DisplayKathrin Heinz
Blattwerk WohnenAnna-Katharina Riedel
Schöner wohnen wollen (sollen) - Optimierung als Subjektivierungsweise in der Zeitschrift Schöner Wohnen: Eine Analyse der Titelblätter von 1980 bis 1999Katharina Eck
Wohn-Bilder in frühen Mode- und Gesellschaftsjournalen, 1786–1839: Ameublement in differenter Wiederholung. Zur Verknüpfung von Rubrik, Zeigestruktur und Subjektivierungsformen im Journal des Luxus und der ModenRosanna Umbach
HausFrauenKörper - Visuelle Politiken der Hausarbeit im Schöner Wohnen Magazin und in feministischer Kunst der 1970er JahreWaltraud Indrist
Der gesellschaftliche Entwurf des Wohnens in der Architekturphotographie von Hans ScharounSamstag, 13. Mai 2017
Christiane Keim
Alles in/auf Futura. Die Typografie der Zeitschrift Das Neue Frankfurt (1926–1931) als Signatur der ModerneJohanna Hartmann
Wohnung, Haus und Heim(at) einrichten. Wohnkultur-Sozialwerk-Möbel in intermedialen Narrationen der frühen NachkriegsjahreMaja Lorbek
Das Eigenheim zwischen 1924 und 1970. Eine Analyse der idealisierten Häuser in den Kundenzeitschriften der BausparkassenChristian Schmitt
Landlust! Idyllen bewohnen (in aktuellen Lifestyle-Magazinen und im 19. Jahrhundert)Nora Huxmann
Wohngarten. Narrative des Wohnens in/mit der Natur in der Gartenschönheit 1920–1941+/-
Workshop des Forschungsprojektes Wohnseiten. Deutschsprachige Zeitschriften zum Wohnen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und ihre medialen Übertragungen
Leitung: Prof. Dr. Irene Nierhaus, Dr. Kathrin Heinz
Organisation: Dr. Katharina Eck, Anna-Katharina Riedel, Rosanna Umbach
←→ -
-
2016
Heim-Tier
10.-11.11.2016
Heim-Tier.
Inszenierungspraktiken in tierlichen und menschlichen WohnverhältnissenSenatssaal der Universität Kassel im Institut für Wirtschaftstechnik
Tiere leben gemeinsam mit Menschen in Innenräumen, ihre Beziehung bestimmt die Wohnpraxis und die Gestaltung von Räumen mit. Menschen können dem lebenden Tier damit ein Heim geben, aber auch das tote Tier kann Teil des Interieurs werden. Fragen nach dem Tier-Mensch-Verhältnis sind in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus kulturwissenschaftlicher Forschungen gerückt. Insbesondere das Heim-Tier als ,treuer‘ Gefährte und Wegbegleiter des Menschen eröffnet vielfältige Assoziationen mit diesem Diskursfeld. Neben lebenden Tieren finden sich aber auch ausgestopfte oder präparierte Tierkörper im Interieur; tierische Artefakte wie Jagdtrophäen, Körperteile von Tieren sowie textile Wand- und Oberflächengestaltungen aus Tiermaterialien gehören zudem vielfach zum Ausstattungsprogramm von Innenräumen. Die Tagung untersucht diese unterschiedlichen Aneignungen des ,Animalischen‘ in den eigenen vier Wänden und fokussiert damit einen bisher wenig berücksichtigten Aspekt der Animal Studies. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach den unterschiedlichen medialen Formen der Verhäuslichung des tierlichen Verhaltens und deren Auswirkung auf das Zusammenleben von Tier und Mensch. Inwiefern können über häusliche Tier-Mensch-Relationen (familiäre) Identitätsbeziehungen im und durch das Wohnen konstruiert werden? Welche Rolle kommt dem Heim-Tier bei der Subjektformierung von Wohnenden zu? Lässt sich im Hinblick darauf die dichotome Unterscheidung von Subjekt und Objekt überhaupt aufrechterhalten oder setzt das ,Ein-Wohnen‘/Eingewöhnen des ,Animalischen‘ in den häuslichen Kontext nicht vielmehr dessen Subjektivierung voraus?PROGRAMM
Donnerstag 10. November 2016
Hörner/Antlfinger (Köln/Berlin) im Dialog mit Anne Hölck (Berlin)
Lunch in a cross-species household. Interspecies Collaborations in der künstlerischen Arbeit
Präsentation mit Publikumsgespräch, im Anschluss gemeinsames Abendessen
Freitag 11. November 2016
Begrüßung und Einleitung
HABITUS//HABITAT
Sabine Nessel, Berlin
Wie zusammen leben. Am Beispiel von Vittorio de Sicas Film Umberto D. (1952)
Maurice Saß, Hamburg
Schön, gefährlich, mächtig. Trophäen der Jagd
Barbara Schrödl, Linz
Ab ins Körbchen? Das Wohnen mit/von Hunden zu Beginn des 21. Jahrhunderts
VERRÄUMLICHUNG VON NATURFORMEN
Mareike Vennen, Berlin
„den Kindern der salzigen Flut bei uns Wohnung zu bereiten“– Heimaquarienpraxis im 19. Jahrhundert
Ellen Spickernagel, Frankfurt am Main
Tierskulpturen für die „Neue Wohnung“
(ÜBER)INTIMISIERUNG: HEIMLICHKEIT UND UNHEIMLICHKEIT
Aline Steinbrecher, Konstanz
„Des Menschen Liebe zum Hund ist natürlich“– Hunde als Gefährten- und Haustiere 1650–1850
Stephanie Milling, Kassel
Un-Heimliche Nähe: Heimtier-Mensch-Beziehungen in künstlerischer Perspektive
Abschlussdiskussion+/-
Veranstalter:
Forschungsfeld wohnen+/–ausstellen in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender (Leitung: Irene Nierhaus/Kathrin Heinz)
In Kooperation mit:
LOEWE-Schwerpunkt "Tier-Mensch-Gesellschaft", Universität Kassel
Konzept & Organisation:
Silke Förschler (Kassel), Christiane Keim (Bremen), Astrid Silvia Schönhagen (Bremen)←→ -
-
2015
Wohn/Raum/Denken
10.-11.7.2015
Wohn/Raum/Denken
Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur
Für Irene Nierhaus zum 60. GeburtstagInternationale Tagung an der Universität Bremen, GW 2, B 3009
Häuslichkeit, Häusliches, Haus – diese Begriffe artikulieren das sogenannte Private, seinen privilegierten Ort, seine Atmosphären und Befindlichkeiten. Das Haus bezeichnet den Raum des vermeintlich Eigenen und Individuellen. Es verspricht jenseits besseren Wissens über die Durchlässigkeit und Fragilität dieser Wunschanordnung Rückzug vor gesellschaftlichen Regeln und Anforderungen. Das häuslich Private als das Andere des öffentlich Politischen ist jedoch seit jeher Territorium von Regulierungstechniken, Erziehungsstrategien, emotionalen Bindungen und Arbeitsbeziehungen.
Im Wohn/Raum werden Subjektivität konstituiert, Geschlecht hergestellt, Verhalten eingerichtet, gleichermaßen aber auch Kompetenzen vermittelt und eingeübt. Die Forschungen von Irene Nierhaus und der von ihr entwickelte Begriff des „Wohnwissens“ sind der Ansatzpunkt für die Tagung, die Wohn/Raum als Denkfigur und mediale Formation in den Blick rücken und in Richtung auf eine Perspektivierung des Häuslichen als Kernbestimmung des Gesellschaftlichen weiterdenken will.PROGRAMM
Freitag, 10. Juli 2015
Grußworte
Christoph Auffarth
Dekan des Fachbereiches Kulturwissenschaften, Universität Bremen
Winfried Pauleit
Institut für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik, Universität Bremen
Urs Brunner
Mariann Steegmann Stiftung
Kathrin Heinz, Christiane Keim, Katharina Eck, Johanna Hartmann
Einführung
Daniela Hammer-Tugendhat, Wien
Die Malerei als Baumeisterin des Interieurs. Zur ‚Geburt‘ des bürgerlichen Interieurs in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts
Caroline Arscott, London
Whistler and the Women in White: ‚Cleaner, Softer, Brighter’ Environments
Barbara Paul, Oldenburg
Wohnerfahrungen: feministisch_queer? Aktuelle künstlerische Positionen
Matt Smith, London
Queering the Historic Home: Unravelling National Trust Houses
Elke Krasny, Wien
Von der urbanen Praxis des Häuslichen
Gabu Heindl, Wien
Kontingenz in Permanenz. Über Nicht-Bebauungsplanung und mattierten Urbanismus
Finissage der Ausstellung
DAZWISCHENTRETEN
im Künstlerhaus Bremen
Samstag, 11. Juli 2015
Cornelia Klinger, Hamburg
Cocooning mit Adorno oder: (K)ein richtiges Leben im falschen?
Marie-Luise Angerer, Köln
Das ETUI
Einformen & Rausschälen
Linda Hentschel, Berlin
Versehen, Verstecken, Verfolgen, Vergeben: Dem Affekt Raum einräumen
Silke Wenk, Oldenburg
(Un)Mögliche Wohnräume?
Mit der Kamera durch Katastrophen ins Universum. Eine Bilderfolge im Magazin „Time“
Drehli Robnik, Wien
Unterscheiden über Leichen unter Scheiben und Gleichen: Zum Wahrnehmen politischer Gewalt durch spielfilmische Undurch-und Einsicht in Abscheibungen
Kathrin Peters, Berlin
Über Bildungsarchitekturen
Susanne von Falkenhausen, Berlin
Kunst im Netzzeitalter - digitale Enträumlichung?
Abschluss
SOMMERFEST+/-
Das Ausstellungsprojekt (6. Juni ‑ 10. Juli 2015) findet in Verbindung mit der Tagung statt und ist eine Zusammenarbeit des Künstlerhaus Bremen mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen.Internationale Tagung des Forschungsfeldes wohnen+/−ausstellen in der Kooperation des IKFK mit dem MSI
Konzept und Organisation:
Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim←→-
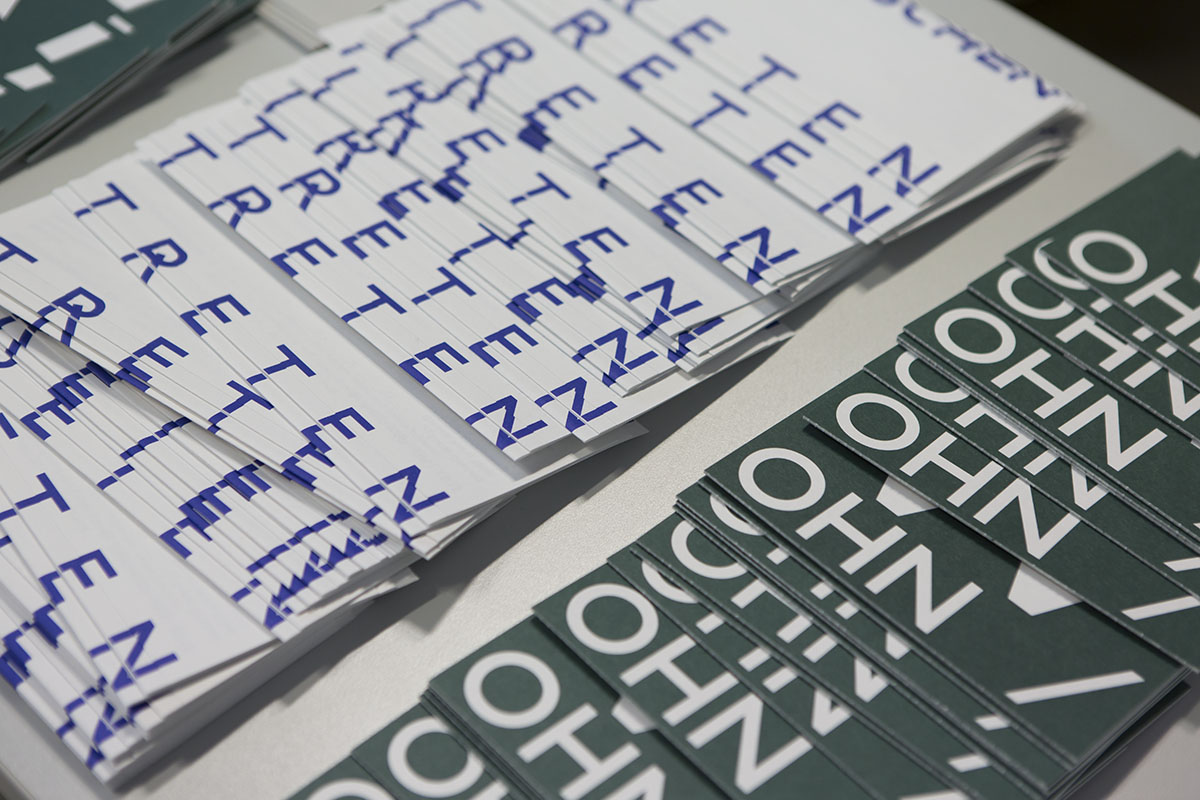
Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch
-
-
2015
Hej, wer ist in der IKEA-Family zuhause?
24.1.2015 / 10 Uhr
Hej, wer ist in der IKEA-Family zuhause? Raum- und Subjektkonstitutionen in den medialen Verfahren einer globalen Wohnerzählung
Ein öffentlicher Workshop am 24. Januar 2015 an der Universität Bremen.
Mit dem Katalog, der Verkaufsausstellung, mehreren Websites, Werbespots und einer Lifestyle-Zeitschrift macht IKEA deutlich, dass es bei der Einrichtung der Wohnung immer schon um mehr geht als nur um das richtige Sofa oder Bücherregal. Eingerichtet wird mit dem Zuhause auch das Subjekt in seinen gesellschaftlichen Zuschreibungen. Das Forschungsseminar „Hej, wer ist in der IKEA-Family zuhause?“ untersucht die verschiedenen medialen Produkte von IKEA. Gefragt wird nach den Wohnerzählungen und den darin unternommenen Verhandlungen von Wohnraum und Bewohner_innen.
PROGRAMM
Begrüßung
Irene Nierhaus, Johanna HartmannSamira Alssaedi, Ulrike Miriam Bausch, Jennifer Gätjen, Hanna Weidemann
Das „unmögliche Möbelhaus“ Katalogtitelblätter von 1980 bis 2015Armin Ahmadi, Lara Nathalie Bader, Karin Grummert, Lena Rieger
Ich mach‘s mir schön zuhaus! IKEAs Wohlfühlrhetoriken – eine Analyse der Kataloginnenseiten von 1995, 2000, 2007 und 2015Anna Lingemann-König, Madita Schumacher, Moyo von Wahlert
Aus Schweden in die ganze Welt
Die Geschichte des bekanntesten EinrichtungshausesCarina Claassen, Johanna Hanke, Clara Mittelgöker, Carla Ravens
„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“
Untersuchung und Vergleich von drei aktuellen IKEA-WerbespotsIsabell Hellemann, Marlene Holenda, Claire Marielle Fröhlich, Melanie Wichlein
„live“ is Life?
Das Style-Magazin von IKEA als Teil der Unternehmensphilosophie
Christine Britting, Anna Riedel, Frauke von Oesen
Weil Zuhause der öffentlichste Platz der Welt ist
Eine Betrachtung des Blogs hej.de, dem „begehbaren Wohnmagazin“Magali Nicol, Johanna Pockels
Vom Wohnzimmer zur Kasse Display- & Parcoursanalyse im IKEA BrinkumJana Matschke, Theresa Thiemann, Miriam Wendel, Hülya Yalçın
Zwischen Hacken und Recyceln
(Pseudo-)Individualisierung von MassenproduktenKevin Barth, Janine Hoffmann, Lisa Hoffmann, Rosa-Maria Kramer
IKEArt
Künstlerische Auseinandersetzungen mit einem Einrichtungshaus
+/-
Der öffentliche Workshop wurde realisiert im Forschungsfeld wohnen +/– ausstellen in der Kooperation des IKFK mit dem MSI und wurde veranstaltet vom gleichnamigen Forschungsseminar im B.A. und M.Ed. Kunst–Medien–Ästhetische Bildung im WS 2014/15Seminarleitung: Prof. Dr. Irene Nierhaus, Johanna Hartmann
←→ -
-
2014
Matratze/Matrize
15.-18.5.2014
Matratze/Matrize: Substanz und Reproduktion im Wohnen.
Konzepte in Kunst und ArchitekturInternationale Tagung im Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58, 28199 Bremen
Matratze/ hingeworfenes Ding, auf dem wir, schlafen, ruhen, lieben, faulenzen, träumen, quälen, reproduzieren, die wir beflecken, unter der das Verdrängte, Unheimliche lauert, auf der wir gesunden und sterben…
Matrize/ Mutterform, die prägt, vervielfältigt, speichert, die Nachkommen hervorbringt, reproduziert, kopiert, die Gedrucktes erzeugt, zu Wissendes überträgt, die Gerüche hinterlässt, aufzeichnet…
Matratze und Matrize sind Medien und Mittler. Matratze bedeutet Intimität, Alltag und Körper, Matrize hingegen Publizität, Wissen und Schrift. Damit wird Differenz zwischen Authentizität, Substanz und Repräsentation, Reproduktion (re)formuliert. Der Schrägstrich zwischen Matratze/Matrize markiert jedoch ein zu diskutierendes Verhältnis. So ist die Matratze, zu Hause am vermeintlich privatesten Ort, auch Agentin von Normierung in Subjektivierungsprozessen und des Biopolitischen. Konfiguriert von Körperlichkeiten ist sie Objekt der Veräußerung, auf ihr findet Gesellschaftsstiftendes in seinen individuellen Bezügen statt. Die auf zu Veröffentlichendes ausgerichtete Matrize als Medium von Multiplizierung und Wissensbildung ist auch Metonym für Prägevorgänge und Einträge in Materialkörper. Die Matrize ist Theoriefigur, Wohnen in der Spanne von Substanzialität und Repräsentation zu denken. Die Matratze hat eine doppelte Position, sie ist Theoriefigur und zugleich Gegenstandsbereich. Alltag, Wissen, Subjektivierung in körperanalogen Medien des Wohnens und ihren Zeigestrukturen werden in Beziehung gesetzt. Beabsichtigt ist eine transdisziplinäre Debatte zwischen Kunst, Architektur, visueller Kultur und Theorie in der Verschränkung von Objekten, Materialitäten, ästhetischen Strukturen und Bedeutungskontexten.PROGRAMM
Donnerstag, 15. Mai 2014
Grußwort des Dekans des Fachbereiches Kulturwissenschaften der Universität Bremen
Christoph Auffarth
Irene Nierhaus und Kathrin Heinz
Matratze/Matrize. Konzeptideen
Leiterinnen des Forschungsfeldes wohnen +/- ausstellen
Elena Zanichelli, Lüneburg
Ein Bett im Stadtraum?
Félix González-Torres’ Untitled (1991) im/ aus dem Museum of Modern Art, New York 1992
Marie-Luise Angerer, Köln
Abdruck und Empfindung
Spuren eines Bewegungsgefüges
Moderation: Irene Nierhaus, Bremen
Freitag, 16. Mai 2014
Angelika Bartl, Bremen
Beweisstück Matratze
Mediale Blicke ins Wohnen der Anderen
Tobias Lander, Freiburg
Vom Playboy-Bett zu Tracey Emins My Bed – Die Matratze als Kommunikationsmaschine
Ilaria Hoppe, Berlin
Aderlass und Heilsversprechen: Die Herrschaft im Bett
Moderation: Kathrin Heinz, Bremen
Andreas Rumpfhuber, Wien
The Working Glamour
Das Bett als erweiterte Sphäre der Arbeit
Tom Lutz, Riverside/ CA
Mattress without a Matrix
Elke Krasny, Wien
Vom Recht auf Obdach: Die UN-Habitat Konferenz 1976 in Vancouver
Moderation: Johanna Hartmann, Bremen
Samstag, 17. Mai 2014
Gabu Heindl, Wien
Matrizenbau und Matratzenlage: von Wohnraumspekulation zu Obdachlosigkeit
Christiane Keim, Bremen
„Betten und Matratzen an die Sonne!“
Die Neue Wohnung und der Normalisierungs- und Sexualisierungsdiskurs in der Weimarer Republik
Moderation: Barbara Paul, Oldenburg
Sibylle Trawöger, Linz
Ein Blick unter die Matrize
Annäherungen an Matratze/ Matrize ausgehend von der Eremitage des Linzer Mariendoms
Georges Teyssot, Québec
„To Dwell amid the Waves”. Sehnsucht between Erogenic and Hysteriogenic Zones
Drehli Robnik, Wien
Die Masse als Matratze, aus der alles hervorgeht: Soziales Fleisch und die „Verlegenheiten“ der Repräsentationskritik in Horrorfilm und Comedy
Moderation: Angelika Bartl, Berlin
Sonntag, 18. Mai 2014
Sonja Kinzler, Bremen
Alles unter Kontrolle?
Schlaf als Forschungsproblem der beginnenden Moderne
Alice Pechriggl, Klagenfurt
LGBT**: Matrizen des contrat sexuel – Matratzen des Begehrens im Aufbruch
Insa Härtel, Berlin
„Sogar das Bett“ – Verwahrloste Matratzen
Zum Phänomen „Messie-Sendung“
Moderation: Christiane Keim, Bremen+/-
Internationale Tagung des Forschungsfeldes wohnen +/− ausstellen in der Kooperation des IKFK mit dem MSI
Konzept und Tagungsleitung:
Prof. Dr. Irene Nierhaus und Dr. Kathrin HeinzOrganisation:
Katharina Eck, M.A.←→←→Franziska von den Driesch: Gäste_Zimmer, 2014
-
-
2014
Zeichen/Momente
31.1.-1.2.2014
Zeichen/Momente Vergegenwärtigungen in Kunst und Kulturanalyse
Für Sigrid Schade
Ein Symposium vom 31. Januar – 1. Februar 2014 an der Zürcher Hochschule der Künste
„Die Welt ist voll von Zeichen, aber nicht alle diese Zeichen besitzen die schöne Einfachheit der Buchstaben des Alphabets.“
Roland Barthes, Die Machenschaften des Sinns (La cuisine de sens), 1964Wie machen sich Übersetzungen, Prozesse der Übertragung zwischen Sinn und Sinnlichkeit bemerkbar? Was zeigt sich in Akten des Zeigens und Verbergens, Interpretierens, Nacherzählens und Umdeutens? Wie wird Macht in Prozessen kultureller Zeichenproduktionen und -zirkulationen wirksam? Es sind politisch motivierte, ästhetisch, räumlich und medial formulierte Fragen, welche die Schnittmenge von Kunst und Kulturanalyse auszeichnen: Von welcher geschlechtlich strukturierten Beziehung zwischen Körperbild und Bildkörper zeugen etwa die Narrationen moderner Kunst(geschichte)? Wie schreibt sich Geschichte in Gegenwärtigem fort, wie formiert sich Vergangenes? Auf welchen Wegen durchwandern Bilder und Begriffe zeitliche und räumliche Distanzen? Wie vermitteln sich gesellschaftliche Rahmungen im individuellen Erleben, in der Einfühlung, im Affekt und umgekehrt? Welche Möglichkeiten des Erzählens, Zeigens, Wahrnehmens und Handelns gibt es, eine kritische Potenzialität produktiv zu machen? Künstlerische und kulturanalytische Praktiken sind Aushandlungs- und Erscheinungsort komplexer Bedeutungs- und Beziehungsgefüge. Sie kennzeichnen kulturelle Sinnkonstruktionen, die nie abgeschlossen sind, gleichsam wuchernde Gebilde eines nicht zu arretierenden Sinns, der nie einfach zu haben ist, aber dennoch in seiner je momentanen, historisch kontingenten Form existiert. Ebenso unaufhörlich gilt es, einen wachen Sinn für die kulturellen Wege und Umwege der Tradierungen, Inszenierungen und Verortungen zu entwickeln und dabei die eigene Involviertheit im Feld der Bedeutungsverschiebungen stets mitzudenken und zu nutzen. Denn wenn wir die Gewordenheit der Gegenwart verstehen wollen, geht es darum, Denk- und Handlungsräume herzustellen, bereitzustellen, die sich dieser Aufgabe widmen. Nichts anderes möchte das Symposium anlässlich des 60. Geburtstags von Sigrid Schade.
PROGRAMM
Freitag, 31. Januar 2014
Sigrid Adorf, Zürich und Kathrin Heinz, Bremen
Begrüßung und EinleitungSilke Wenk, Oldenburg
Überkreuzungen und Anschlüsse. Wie ein gemeinsames Projekt sich entwickeln konntePhilip Ursprung, Zürich
„Promenadologie“: Gehen und KulturanalyseGriselda Pollock, Leeds
Art History, Cultural Analysis, Cultural Studies: Alternatives, Conversations, or Transdisciplinary Encounters in the Search for Understanding the ImageModeration: Carmen Mörsch, Zürich
Art as Cultural Analysis: Buchvernissage Vera Frenkel
(hg. von Sigrid Schade, Hatje Cantz 2013) mit Vera Frenkel, Doina Popescu, Toronto, Sigrid Schade, Zürich
und den Zürcher Premieren der Videos von Vera Frenkel: „ONCE NEAR WATER: Notes from the Scaffolding Archive“ (2008/09) & „The Blue Train“ (2012)Samstag, 1. Februar 2014
Kornelia Imesch Oechslin, Lausanne
Schneewittchen, Kulturindustrie und Celebration City. Eine Phänomen- und StadtanalyseIrene Nierhaus, Bremen
Schau_Platz Wohnwissen. Zum Gesellschaftlichen des EinrichtensInsa Härtel, Berlin
Wirklich nur eine Kleinigkeit. Über Abhub und weggeworfene SignifikateKerstin Brandes, Oldenburg
Kulturelle Übersetzung, visuelle Strategien: Bilder von Khoikhoi und anderen am Kap der Guten HoffnungModeration: Linda Hentschel, Berlin
Sabine Gebhardt Fink, Luzern
„Was, wie zu sehen gegeben wird“ – kritische Nachzeichnungen von Bedeutungsproduktionen im Kontext der Performance-KunstKarin Harrasser, Linz
Prothesen umfunktionieren. Roland Barthes liest Bert BrechtSteffen Schmidt, Zürich
Körperkonstruktionen durch Musik – eine analytische Lektüre von Roland Barthesʼ „Rasch“Mieke Bal, Amsterdam
Long Live Anachronism: Transmission, Response, and RecognitionModeration: Dorothee Richter, Zürich
Anlässlich des Symposiums wurden vom 1. bis 23. Februar 2014 Arbeiten von Mieke Bal (Amsterdam) und Vera Frenkel (Toronto) im Museum Bärengasse in Zürich gezeigt.
+/-Konzept und Durchführung: Prof. Dr. Sigrid Adorf, Dr. Kathrin Heinz
Eine Kooperation des Institute for Cultural Studies in the Arts (ICS), Zürcher Hochschule der Künste mit dem MSI.←→ -
-
2013
Das Prinzip Pavillon in Kunst und Architektur
7.-8.6.2013
Flüchtige Begegnungen/Dauerhafte Bekanntschaften
Das Prinzip Pavillon in Kunst und Architektur
Symposium vom 7.–8. Juni 2013 an der Universität BremenDer Pavillon ist ein ebenso ubiquitäres wie schwer zu fassendes Phänomen, das sich durch vielfältige Eigenschaften und mannigfaltige Funktionen auszeichnet. Der Architekturtypus wird zum dauerhaften Wohnen ebenso genutzt wie zum temporären Präsentieren von Ausstellungsobjekten oder zum Repräsentieren von Ideen und Identitäten; er dient als stationäres Versuchslabor für das Experimentieren mit architektonischen Formen und als Schauraum künstlerischer Interventionen. Auf diesen Mehrfachfunktionen und unterschiedlichen Bedeutungen des Pavillons liegt der Schwerpunkt des Symposiums. Das Augenmerk liegt dabei weniger auf typologischen oder entwicklungsgeschichtlichen Fragestellungen; vielmehr soll der Pavillon als Prinzip oder als konzeptueller Referenzort in den Blick genommen werden, an dem sich beispielhaft komplexe Beziehungszusammenhänge zwischen Architektur, Kunst und Raum sowie zwischen den jeweiligen/verschiedenen Akteur_innen darstellen lassen.
PROGRAMM
Freitag, 7. Juni 2013Irene Nierhaus
Begrüßung durch die Leiterin des Forschungsfeldes wohnen +/− ausstellenChristiane Keim
Einführung
Der Pavillon: Schauplatz für Ideen/Versuchsanordnung für Experimente
Ben Highmore, Sussex
Between Page and Street: The Smithson’s PavilionSamstag, 8. Juni 2013
Katharina Eck, Bremen
Zwischen-Räume: Räume „zwischen“ Gartenkunst, tapezierten Salons und Pavillons zur GoethezeitMechtild Widrich, Zürich
Pavillons als globale BegegnungsarchitekturAnnette Urban, Bochum
Der Pavillon als Modellfall einer Kunst als/über Architektur im Zeichen fluider Räumlichkeit, Bilder und Kopräsenzen
+/-
Konzept und Durchführung: PD Dr. Christiane Keim -
2012
WIE WOHNEN?
29.-30.11.2012 09 Uhr
WIE WOHNEN? Beziehungen zwischen Wohnmodellen, Vorbildern und BewohnerInnen
Ein Symposium vom 29.-30. November 2012 im Wien Museum Karlsplatz
Wohnen ist mit der Moderne ist Wohnen zu einem vielumkämpften Schauplatz gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Handelns geworden, in dessen Mitte die Verhandlung des Subjekts und seiner sozialen Beziehungen steht. Dafür werden Ideale, Vorbilder und Modelle entworfen und in den unterschiedlichen Medien realisiert und verbreitet. Auf diese Weise wird ein fluktuierendes Wohnwissen erzeugt, das an der Organisation der Wohnbauten und Wohnräume, der Bildwelten des Wohnens und der Vorstellungen von und über BewohnerInnen teilhat – zugleich wird dieses Wohnwissen darin performiert und formuliert. Seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart wurden vielfältige Möglichkeiten der Veranschaulichung des Wohnens (Wohnausstellung, illustrierte Berichte, Interieurbilder, Filme etc.) entwickelt, tradiert und transformiert.
Die Tagung untersucht Beziehungen zwischen modellhaftem Wohnen, seinen medialen Bildern und Vorstellungen von Bewohnerschaft.PROGRAMM
Donnerstag, 29. November 2012
Begrüßung
Wolfgang Kos, Wien Museum
Zeitschichten. Wohnen als Produkt von Vergangenheit und Gegenwart, von Konvention und Utopie
Kathrin Heinz, MSI/Universität Bremen
wohnen+/-ausstellen als Forschungsfeld
Einführung
Irene Nierhaus, MSI/Universität Bremen
Andreas Nierhaus, Wien Museum
Wie Wohnen? Beziehungen zwischen Wohnmodellen, Vorbildern und BewohnerInnen
DIDAKTIKEN DES WOHNENS
Johanna Hartmann, Bremen/ Berlin
Möbel, Pläne, Körper. Lehrstücke des Wohnens in den 1950er Jahren
Andreas Nierhaus, Wien
Stahlrohrmöbel, Selbstmordziffer und die „wirkliche Wohnung“. Zur Didaktik von Bau- und Wohnausstellungen um 1930
Greg Castillo, Berkeley
Cold War on the Home Front
Christiane Keim, Bremen/ Berlin
Im richtigen Leben ankommen: Alison und Peter Smithsons „Solar Pavilion“ in Fonthill und das Vorführen der „Kunst des Bewohnens“
Eva-Maria Orosz, Wien
Historische Wohnräume im Wien Museum: Vom Personenkult zum Wohnvorbild
BEWOHNER UND BEWOHNTE
Robert Gassner, Kopenhagen
Prozesshafte Verständnisse von Wohnraum – das „Lebendige“ und das „Zufällige“ bei Josef Frank
Wolfgang Förster, Wien
Einfach bauen. Die Bauten der Wiener Siedlerbewegung und ihre Aneignung im Lichte veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
David Kuchenbuch, Gießen
„Spuren im Schnee“ – Wohnbedürfnisforschung, Bewohnerkonstrukte und Bewohnererziehung in Deutschland und Schweden, 1920er bis 1950er Jahre
Freitag, 30. November 2012
Michael Zinganel, Dessau/ Wien
1:1. Populäre Wohnerziehung im Fertighauspark
Doris Guth, Wien
Wohnen und lieben! Architektur und Geschlecht in Baumessen und Werbungen
BILDER MACHEN
Andreas K. Vetter, Detmold
Auftritt Mensch – Die Bedingungen der humanen Präsenz im fotografischen Architekturbild
Tina Threuter, Trier
Ausschlüsse des Unerwarteten: Herlinde Koelbls Fotobuch „Das deutsche Wohnzimmer“ (1980)
Angelika Bartl, Bremen/ Berlin
Politische Privatheit. Laura Horellis Film The Terrace (2011)
Irene Nierhaus, Bremen/ Wien
Verstellungen: Kollisionen zwischen Interieur und Subjekt in Bildern und Texten der Wohnkritik der 20er und 30er Jahre.
Drehli Robnik, Wien
Wohnen in der Schwebe: Horrorfilm als Einübung ins Un-Heim
Abschluss
Führung durch die Ausstellung „Werkbundsiedlung Wien 1932 – Ein Manifest des Neuen Wohnens“+/-
Konzept: Irene Nierhaus, Andreas Nierhaus
Die Tagung findet im Rahmen der Ausstellung WERKBUNDSIEDLUNG WIEN 1932. EIN MANIFEST DES NEUEN WOHNENS statt, die von 6. September 2012 bis 13. Jänner 2013 im Wien Museum Karlsplatz zu sehen ist.Veranstalter der Tagung ist das Wien Museum in Kooperation mit dem Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen des Instituts für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik der Universität Bremen/ Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender
←→ -
-
2012
Film als Medium der Architektur
4.-6.10.2012
Film als Medium der Architektur
Internationale Tagung vom 4.–6. Oktober 2012 am Institut für Kunstwissenschaft und Philosophie der Katholischen Privatuniversität Linz
Was spricht für den Einsatz des Films in der Architekturvermittlung? Vermögen bewegte Bilder Architektur adäquater wiederzugeben als Fotografien? Diese Überlegungen führten im frühen 20. Jahrhundert zu zahlreichen Versuchen, filmische Bilder zur Dokumentation von Architektur, zur Vermittlung architekturhistorischen Wissens und zur Gewinnung neuer Erkenntnisse einzusetzen. Schon bald aber hatte man im akademischen Bereich das Interesse am Architekturfilm verloren. Erst in den 1960er Jahren wurde diese abgebrochene Tradition wieder aufgenommen. Gegenwärtig fällt das Interesse am Architekturfilm in eine Phase verstärkter Auseinandersetzung mit der Kategorie Raum, die als sozial und kulturell geprägtes Beziehungsgefüge begriffen wird. Zudem eröffnen digitale Medien neue Möglichkeiten und verändern die Wahrnehmung von Architektur. Die zu Beginn gestellten Fragen sind noch immer aktuell. Doch gilt die Aufmerksamkeit heute vor allem den Entstehungsbedingungen und Effekten filmischer Bilder von Architektur und Raum: Wie stellen sie Bedeutung(en) her? Wie prägen sie Rezeptionshaltungen? Wie unterstützen sie (De-) Territorialisierungen? Und schließlich: Wie sind sie als mediale Bilder und Bildersysteme an das soziale Konstrukt der Geschlechterdifferenz gebunden und wirken auf dieses zurück?
PROGRAMM
Donnerstag, 4. Oktober 2012
Helmut Weihsmann, Wien (Eröffnungsvortrag)
Kinetektur. Der hybride Architekturfilm zwischen Artefakt, Dokument und VisionMEDIENSTRATEGIEN MODERNER ARCHITEKTEN
Veronique Boone, Brüssel
Le Corbusier and the promotion of his architecture by filmChristiane Keim, Bremen
Der Schulfilm „Die Frankfurter Küche“ als Teil der medialen Repräsentation des „Neuen Frankfurt“ in den 1920er Jahren
Interner Filmabend im CINEMATOGRAPHFreitag, 5. Oktober 2012
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN FILM UND NEUEM BAUENChris Dähne, Weimar
Die Stadtsinfonie. Von der Produktion und Rezeption moderner ArchitekturLena Christolova, Konstanz
Plansequenz und proménade architecturale. Die gegenseitige Durchdringung von Filmtheorie und Architektur im Film „Le Mépris“ von Jean-Luc Godard (F/I 1963)
KUNSTHISTORIKER, KUNSTHISTORISCHE THEORIEBILDUNG UND FILMLutz Robbers, Weimar
Behne, Giedion, Faure. Architekturgeschichte im Zeitalter des FilmsBarbara Schrödl, Linz
Erfassung des Lichts im barocken Innenraum.
Carl Lamb, der Film und die ForschungNathalie Bredella, Berlin
Mobilität des Urbanen. Zu Reyner Banhams Architektur- und Stadttheorie über Los AngelesÖffentlicher Filmabend im Moviemento
Samstag, 6. Oktober 2012
FILMISCHE ARCHITEKTURPORTRAITS IN DER GEGENWARTDoris Agotai, Zürich
Architektur filmen. Darstellungspraktiken im RaumChristina Threuter, Trier
Raum, Affekt und Geschlecht: „Loos ornamental. Architektur als Autobiographie“, ein Architekturfilm von Heinz Emigholz (AT 2008)
+/-
Konzept und Durchführung:
PD Dr. Christiane Keim gemeinsam mit Dr. Barbara Schrödl, Linz
Kooperation der Katholischen Privatuniversität Linz mit dem IKK und dem MSI←→ -
-
2012
Tapezierte Interieur - Anordnungen
4.-5.5.2012
Tapezierte Interieur - Anordnungen. Narrative des Wohnsubjekts um 1800
Internationaler Workshop vom 4.–5. Mai 2012 an der Universität Bremen
Der Workshop legt den inhaltlichen Schwerpunkt auf die Schnittstelle des Beziehungsgeflechts zwischen Tapete, Bewohner/innen-Subjekt und Wohnraum. Untersucht werden Didaktiken und Narrative von Tapeten-Interieurs um 1800 sowie Fragen ihrer geschlechtlichen und/oder kulturellen Kodierung im Raumgefüge. Zur Diskussion stehen die implizite Wirkmächtigkeit von Geschmackstrends sowie Geschlechter- und Körperdiskursen auf Bildtapeten-Ensembles. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Interdependenz von Reisetopoi und Gender-Diskursen im Medium Wanddekor, das auf sehr komplexe Weise die großen Themen Reise, Bildung und (Erfahrung von) Körperlichkeit oder Bewegung in das scheinbar private Wohnhaus transponiert. Im Austausch mit verschiedenen Fachrichtungen und Disziplinen soll erörtert werden, auf welche Art und Weise Bildtapeten erzählen oder Bild-Räumlichkeit erzeugen und inwiefern in der Interaktion mit den betrachtenden Subjekten kulturelle Verhaltenscodes produziert und gegebenenfalls (bewohn- oder bereisbare) Wissensräume konstruiert werden.PROGRAMM
Freitag, 4. Mai 2012
Begrüßung durch die Leiterinnen des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen
Irene Nierhaus und Kathrin HeinzGrußwort des Dekans des Fachbereichs Kulturwissenschaften der Universität Bremen
Christoph Auffarth
Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen
Lesen, Reisen, Wohnen. Ideengeschichtliche Reflexionen zu Bildtapeten-Räumen im frühen 19. JahrhundertBirgitt Borkopp-Restle, Bern
Tradition und Nouveauté. Die Konfiguration von Interieurs an der Schwelle zum 19. Jahrhundert (Keynote)SEKTION 1
DEKORGESCHICHTEN DES WOHNENS ODER WAS (TAPETEN-)RÄUME ERZÄHLENIngela Broström, Gävle/Gävleborgs län
Death in the dining room. Scenic wallpaper in Swedish 19th century homesSilke Förschler, Kassel
Oudrys ‘gemalte Menagerie’. Konstellationen von Mensch-Tier-Subjekten im InnenraumZusammenfassung / Diskussion der Tagesergebnisse
Samstag, 5. Mai 2012
SEKTION 2
SUBJEKTFORMIERUNGEN IM WOHNRAUM UM 1800Einführung in die Sektion
Tobias Pfeifer-Helke, Dresden
Räume der Empathie. Der Briefwechsel von Johann Heinrich Merck mit Sophie von La Roche und Albertine von GrünAngela Borchert, London/Ontario
Arabeske ‘Zimmerverzierung’. Spielerische Vexierkunst – Allegorische Anspielung – Narrative GenreCornelia Klinger, Wien
Die Einrichtung der Innerlichkeit zwischen Ferne und Vergangenheit. Wohnen und Subjektkonstitution um 1800SEKTION 3
FERNE WELTEN AN DER WAND. IMAGINÄRE TOPOGRAFIEN IN UND AUF BILDTAPETEN
Einführung in die SektionAstrid Arnold, Kassel
Der Wilde im Wohnzimmer. Die Panoramatapete ‘Les sauvages de la mer pacifique’ oder ‘Die Reisen des Kapitän Cook’
Friederike Wappenschmidt, Neuwied
Augenreisen ins Reich der Mitte. Die Rezeption original chinesischer Tapetenpanoramen im europäischen Interieur des späten 17. bis 19. JahrhundertsBetje Klier, Austin/Texas
‘The Bonapartist utopia’ scenic wallpaperAbschlussdiskussion
+/-
Konzept und Durchführung: Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen
Forschungssalons sind ein besonderes Format des MSI und des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen. Publikationen aus dem Bestand der Studienbibliothek werden zu spezifischen inhaltlichen Schwerpunkten zusammengestellt, aus der Studienbibliothek ausgelagert und in anderen Räumen und Ausstellungen für Lektüren und Recherchen bereitgestellt. Ziel ist es mit dem Salon einen Raum der Kommunikation und der Vermittlung zu schaffen, der Forschung auf diese Weise zugänglich macht und ermöglicht, versammeltes Wissen zu teilen.
-
2022
Forschungssalon Architektur / Feminismus
14.10.2022-12.3.2023 11:45 Uhr
im Rahmen des Ausstellungsprojekts Architektur für alle? Emanzipatorische Bewegungen in Planung und Raum im Wilhelm-Wagenfeld-Haus, Bremen, 14. Oktober 2022 bis 12. März 2023, Kooperation mit dem b.zb Bremer Zentrum für Baukultur.
+/-
Vortrag mit Workshop
Elke Krasny, Wien
Architektur und Sorgetragen: An einem anderen Architekturverständnis arbeiten
Wilhelm Wagenfeld Haus, Am Wall 209, 28195 BremenWas hat Architektur mit Sorgetragen zu tun? Warum ist Architektur als kritische Infrastruktur zu begreifen? Wie kann Architektur der Aufgabe nachkommen, die Infrastruk-turen zur Verfügung zu stellen, die alltägliches Sorgetragen möglich machen und unterstützen? Diese Standortbestimmung von Architektur in Zeiten von pandemischer Katastrophe und Klimakrise fragt danach, wie Architektur auf einem zutiefst verwundeten Planeten zu einer Praxis des infrastrukturellen Sorgetragens werden kann.
Ein anderes Verständnis von Architektur als Praxis des Sorgetragens verlangt nach anderen Zugängen im Architekturstudium und in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Architektur. Diese Bildungsarbeit kann entscheidend dazu beitragen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Architektur mit Verantwortung trägt für die gebauten Verhältnisse, die soziale und ökologische Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit mitbestimmen. In diesem Vortrag wird argumentiert, dass es darum geht, kollektiv das Bewusstsein für die infrastrukturellen Bedingungen zu schärfen, die das Leben Einzelner wie des Planeten als Ganzes betreffen.Elke Krasny ist Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien. Als Kulturtheoretikerin, Stadtforscherin und Kuratorin arbeitet sie zu emanzipatorischen und transformativen Praxen in Architektur, Urbanismus und zeitgenössischer Kunst mit Fokus auf sozialen und ökologischen Dimensionen von Care. Gemeinsam mit Angelika Fitz hat sie Critical Care. Architecture and Urbanism for a Broken Planetherausgegeben (MIT Press, 2019). Ihr nächstes Buch widmet sich Fragen von Care unter pandemischen Bedin-gungen: Living with an Infected Planet. Covid 19, Feminism and the Global Frontline of Care (transcript).
Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender / Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen an der Universität Bremen mit dem Bremer Zentrum für Baukultur (b.zb). Sie findet im Rahmen der b.zb-Ausstellung „Architektur für Alle?! Emanzipatorische Bewegungen in Planung und Raum“ im Wilhelm Wagenfeld Haus statt.
←→ -
-
2021
Forschungssalon wohnen³
5.12.2021-3.7.2022 19 Uhr
im Rahmen der Ausstellung wohnen³ bezahlbar. besser. bauen. Architektonische Lösungen und künstlerische Interventionen im Hafenmuseum Speicher XI Bremen.
Ein Ausstellungsprojekt des Hafenmuseum Speicher XI Bremen, des b.zb Bremer Zentrum für Baukultur und des MSI/Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen.
←→ -
-
2019
Forschungssalon Bauhäuslerinnen
23.-25.8.2019 19 Uhr
im Rahmen von Güterbahnhof (GB) OPEN 2019 Never mind the Bauhaus – Here comes the Güterbahnhof! am Güterbahnhof Bremen Areal für Kunst und Kultur.
←→ -
Tätigkeiten am MSI und im Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen umfassen intensive Auseinandersetzungen mit künstlerischen Produktionen und Gestaltungsprozessen sowie deren Zeigepraxen bezogen auf die wechselseitige Bedingtheit von wohnen+/–ausstellen.
Forschungsbildend ist dabei einerseits die Analyse von Ausstellungen und Vermittlungspraktiken und andererseits die theoriegeleitete Konzipierung von und Kooperation mit Ausstellungsprojekten und damit verschränkt die Initiierung und Reflexion dieses Handlungsraums.
-
2025
WOHNEN MIT KLASSE
4.-20.7.2025 20 Uhr
WOHNEN MIT KLASSE
Lotte Agger, Silke Nowak, Alice Hauck & Laila Wiens, Franzi BauerGalerie Herold, Güterbahnhof Bremen – Areal für Kunst und Kultur
Beim Handelsmuseum 9, 28195 Bremen
Eröffnung: Freitag, 4. Juli, 20 Uhr +/- Finissage: Sonntag, 20. Juli 15 – 18 Uhr
Wohnen und Klasse bedingen sich wechselseitig. Ökonomische, kulturelle und soziale Ungleichheiten zeigen sich im Wohnen besonders deutlich. Angesichts aktueller Debatten um Gentrifizierung, Vergesellschaftung und eine ‚Wiederkehr‘ der Wohnungs- wie der Klassenfrage, will die Ausstellung das Wohnen als klassenpolitischen Schauplatz in den Fokus rücken. Die Künstlerinnen Lotte Agger, Silke Nowak, Alice Hauck und Laila Wiens stellen widerständige Wohnverhältnisse aktuellen Gentrifizierungsprozessen gegenüber, formulieren Fragen nach den Zusammenhängen von Armut und (ephemerer) Architektur und diskutieren so das Verhältnis von unsteten Wohnsituationen und gesellschaftlicher Ungleichheit. In der Galerie Herold treffen sie auf die Arbeit Kleister Pt. 2 der Gestalterin Franzi Bauer, die gemeinsam mit Studierenden der Universität Bremen klassismuskritische Fragen im Ausstellungskontext entwickelt.
Kuratorinnen: Amelie Ochs, Rosanna Umbach
Eine Ausstellung des Forschungsfeldes wohnen+/-ausstellen in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen in Zusammenarbeit mit der Galerie Herold. Gefördert durch den Senator für Kultur Bremen.
ÖFFNUNGSZEITEN
Do.: 15 — 20 Uhr, Freitag 11 — 14 Uhr &
15 — 18 Uhr, So.: 15 — 18 Uhr und nach Vereinbarung.PROGRAMM
4. JULI, 20 UHR
Eröffnung8. JULI, 18 UHR
Kurvertvortrag mit Silke Nowak (Berlin)
Klassenfragen in Kunsträumen20. JULI, 15 - 18 UHR
Finissage mit einer Lesung von Leona Koldehoff←→ -
-
2024
KISTE BITTE STEHEN LASSEN
21.6.-23.7.2024 18 Uhr
KISTE BITTE STEHEN LASSEN!
ODER: VON DEN DINGEN, DIE ÜBRIGBLEIBEN, ENTSORGT UND VERWORFEN WERDEN
Gleishalle, Güterbahnhof Bremen, Areal für Kunst und KulturAusstellungsprojekt des Forschungsseminars Ästhetiken des Un/Reinen im Wohnen, Master Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik in Kooperation mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Universität Bremen
Wer stellt was raus? Wer nimmt es mit? Was lassen wir stehen? Was ist der Lauf der Dinge? Was gilt als schmutzig? Was ist Müll und für wen? Wer sortiert was ein? Welche Geschichten erzählen die Gegenstände?Die Zu-Verschenken-Kiste ist ein fester Bestandteil des Bremer Stadtbildes. In ihr befinden sich Kleidung, Tassen, Teller, Spielzeug, Bücher und alles, was mal benutzt und dann nicht mehr gebraucht wurde. Statt im Müll zu landen, können die Dinge so neue Besitzer*innen bekommen. Was als wertvoll/nutzlos und als rein/unrein beurteilt wird, ist kulturell bedingt (Mary Douglas). Die Auf- und Abwertung von Dingen findet ununterbrochen statt und trägt mit zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung bei.
In den in der Ausstellung gezeigten Projektarbeiten nähern sich die Studierenden des Masterstudiengangs Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft mit unterschiedlichen künstlerisch-forschenden Herangehensweisen dem Umgang mit den Dingen an. Dem Vorschlag einer "Schmutzigen Theorie" (Hélène Frichot) folgend verstehen sich die Studierenden als Sammler*innen von aussortierten Dingen. Dabei eröffnet gerade der Blick auf das Weggeworfene, Überflüssige, Dreckige die Möglichkeit, sich kritisch mit gesellschaftlichen Strukturen und Normierungen auseinanderzusetzen.
Die Ausstellung ist im Rahmen des Seminars Ästhetiken des Un/Reinen im Wohnen. Von den Dingen, die übrigbleiben, entsorgt und verworfen werden unter Leitung von Dr. Kathrin Heinz entstanden.
Beteiligte:
Fynn Assent, Júlia Balla, Anna Blahaut, Lia Brinkmann, Laurin Cordes, Annika Erhard, Lisa Gronau, Jakob Reeg, Anna Schubert, Pauline Schweser, Ayse Tekin, Friederike von Westernhagen, Alana Wilhelm, Tanja ZafronskaiaPROGRAMM
21. JUNI, 18 UHR
ERÖFFNUNG UND VORSTELLUNG DER PROJEKTE22. JUNI, 14-20 UHR
15 UHR RUNDGANG23. JUNI, 14-20 UHR
15 UHR RUNDGANG
16-18 UHR COLLAGE WORKSHOP (MIT JÚLIA BALLA)
AB 18 UHR SUCHEN DINGE AUS UNSERER KISTE EIN NEUES ZUHAUSEMit freundlicher Unterstützung von: Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Beirat Mitte, Güterbahnhof Bremen - Areal für Kunst und Kultur.
←→-

Júlia Balla -

Júlia Balla -
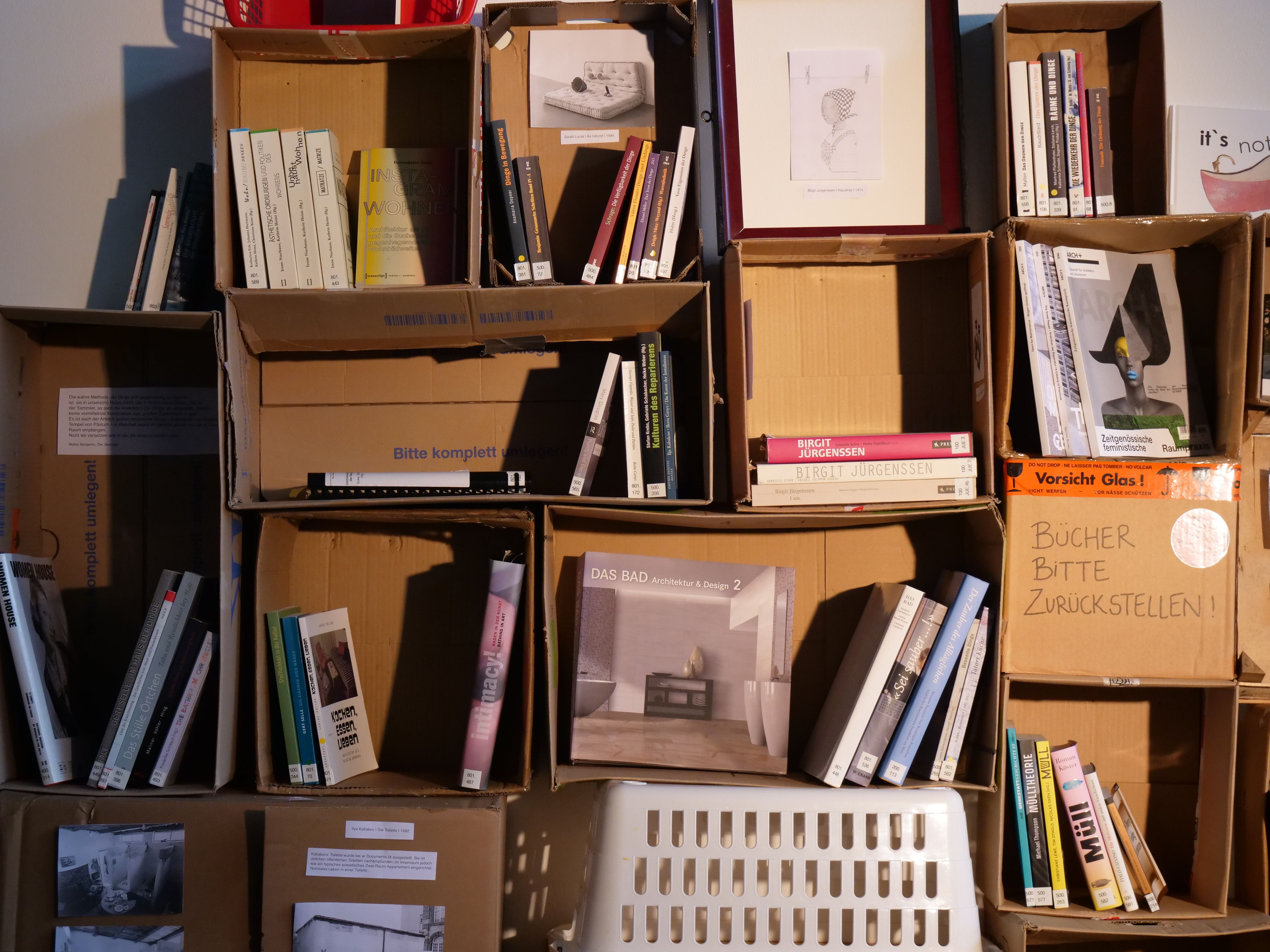
Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla -

Júlia Balla
-
-
2021
WOHNEN³ bezahlbar. besser. bauen.
5.12.2021-3.7.2022
WOHNEN³ BEZAHLBAR. BESSER. BAUEN. ARCHITEKTONISCHE LÖSUNGEN UND KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN
Hafenmuseum Speicher XI BremenEin Ausstellungsprojekt des Hafenmuseum Speicher XI Bremen, des b.zb Bremer Zentrum für Baukultur und des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender/Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen im Hafenmuseum Speicher XI Bremen
Beteiligte Künstler*innen:
Felix Dreesen, Bremen
Folke Köbberling, Braunschweig
Jule Körperich und KLANK, Bremen
Daniela Reina Téllez, BremenKurator*innen:
Dr. Kathrin Heinz (Leiterin MSI/ Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen)
Kim Langer (Hafenmuseum Speicher XI Bremen)
Jörn Schaper (b.zb Bremer Zentrum für Baukultur)
Anne Schweisfurth (Hafenmuseum Speicher XI Bremen)
Prof. Dr. Christian von Wissel (b.zb Bremer Zent- rum für Baukultur, School of Architecture der Hochschule Bremen)ARCHITEKTURAktuelle Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zeigen die zunehmende soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Steigende Mieten und ein an Renditen orientierter Wohnungsmarkt machen es immer mehr Menschen unmöglich, gut und bezahlbar in der Stadt zu wohnen.
Das Ausstellungsprojekt greift die Debatten um die sozialen und politischen Zusammenhänge gegenwärtiger Wohn- und Städtebauplanungen auf und zeigt, wie Architektur auf diese Problemlagen reagieren kann. Lösungen für die Errichtung von bezahlbarem, gutem Wohnraum erstrecken sich von partizipativen Planungsprozessen über neue Modelle des Zusammenlebens bis hin zu flexiblen Grundrissen und kreativen Aus- und Umbaustrategien. Diese und weitere Möglichkeiten werden in der Ausstellung anhand von regionalen, überregionalen und internationalen, modellhaften Wohngebäuden präsentiert. Anschaulich wird, mit welchen architektonischen Eingriffen Wohnen erschwinglicher, nachhaltiger und sozialer realisiert werden kann.
Die ausgewählten Bauprojekte basieren auf der Publikation Bezahlbar. Gut. Wohnen. Strategien für erschwinglichen Wohnraum (hg. von Hans Dömer, Klaus Drexler und Joachim Schultz-Granberg, 2016) und werden für die Ausstellung im Hafenmuseum Speicher XI um drei Beispiele aus Bremen und Bremerhaven erweitert.
KUNSTKünstlerische Positionen, die sich mit grundlegenden Fragen des Wohnens auseinandersetzen, sind ein zweiter Schwerpunkt der Ausstellung. Mit ihnen eröffnet sich ein diskursiver Raum, der zum Nachdenken über Wohnbedürfnisse, Standards, das Verhältnis der Einzelnen zur Gemeinschaft und zukünftiges urbanes Leben einlädt.
Felix Dreesen schärft mit seinen Arbeiten die Wahrnehmung für gegenwärtige Transformationsprozesse im Stadtraum. In der Ausstellung zeigt er wechselnde De/Platzierungen, mit denen er verschiedene Objekte in die Ausstellung verlegt. Über diesen Weg werden urbane Verflechtungen, Stadtgeschichten, Referenzen zu städtischem Wandel und Kommentare zu Wohnumfeldern und -situationen geschaffen und sichtbar.
Folke Köbberling befasst sich mit der Frage: Wie und woraus bauen wir unsere Gebäude? Durch zwei für die Ausstellung gebaute Musterwände wird der Umgang mit Baumaterial und der Verbrauch von Ressourcen kritisch bearbeitet: Gegenübergestellt werden in der Installation Bemusterungsproben aus dem Nachlass eines Architekturbüros und so genanntes Abfallmaterial: lehmhaltiger Erdaushub, Rohwolle, gebrauchte Thermopenfenster.
Die Trickfilmerin Jule Körperich trifft auf das Bremer MusikAktionsEnsemble KLANK. In ihrem gemeinsamen Projekt Ausziehn beschäftigen sie sich mit Besitzverhältnissen von Wohnraum. Die musikalische Einrichtung von KLANK konterkariert und umspielt den Film über einen Auszug aus einer menschenleeren Miniaturwohnung. Film und Vertonung intervenieren visuell und akustisch in den Raum.
Daniela Reina Téllez erkundet mit ihren Zeichnungen, Bewegungen und Gesten im Raum die Frage:
Was ist ein Zuhause? Aus einer dekolonialen Perspektive nimmt sie den architektonischen Plan als Grundmaterial ihrer Erforschung, um ihre Wohnräume der letzten 30 Jahre zu dokumentieren und lädt die Betrachter:innen ein, dadurch ein neues Verständnis vom Raum, Architektur und Wohnen zu erlangen.VERANSTALTUNGEN UND VERMITTLUNGZur Ausstellung fanden zahlreiche Veranstaltungen (Vorträge, Podiumsdiskussion) und ein mannigfaltiges Vermittlungsprogramm (Familiensonntage, Schuloffensive) sowie Führungen statt.
Folgende Vortragende und Podiumsteilnehmer*innen waren beteiligt:
Klaus Dömer, Architekt, Münster, Einführung Eröffnung
Niloufar Tajeri, Architektin, Berlin/Braunschweig
Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus, Kunstwissenschaftlerin, Wien/Bremen
Kassandra Löffler, Architekturforscherin, Weimar
Prof. Folke Köbberling, Künstlerin, Berlin/Braunschweig
Prof. Dr. Gabu Heindl, Architektin, Nürnberg/Wien
Prof. Dr. Lisa Vollmer, Urbanistin, Berlin/Weimar
Gabriele Nießen, Staatsrätin für Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Bremen
Forschungssalon wohnen3
Während der Ausstellungszeit hat das Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender einen Forschungssalon mit Literatur zum Thema in den Räumen des b.zb Bremer Zentrum für Baukultur eingerichtet.
Transfer Forschung/Lehre
Darüber hinaus wurde das Ausstellungsproejkt in die Lehre eingebunden. Dr. Kathrin Heinz hat im MA Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft ein Forschungsseminar zum Thema StadtRaumBewohnen. Kunst, Architektur, Theorie, Vermittlung im Wintersemester 2021/22 durchgeführt. Anknüpfend an die Ausstellung wurde Wohnen aus kunst- und kulturwissenschaftlicher Perspektive in den Blick genommen. Ein Bestandteil des Seminars war die Auseinandersetzung mit den künstlerischen Positionen der Ausstellung. Es fanden in diesem Rahmen Künstler*innengespräche mit Jule Körperich und KLANK, mit Felix Dreesen und Daniela Reina-Téllez statt.Auch Rosanna Umbach hat im Sommersemester 2022 die Ausstellung als Ausgangspunkt für ihr BA-Seminar Wohn/Raum/Politiken - Architektonische Aufbrüche, künstlerische Interventionen, widerständige Praxen gewählt.
←→-
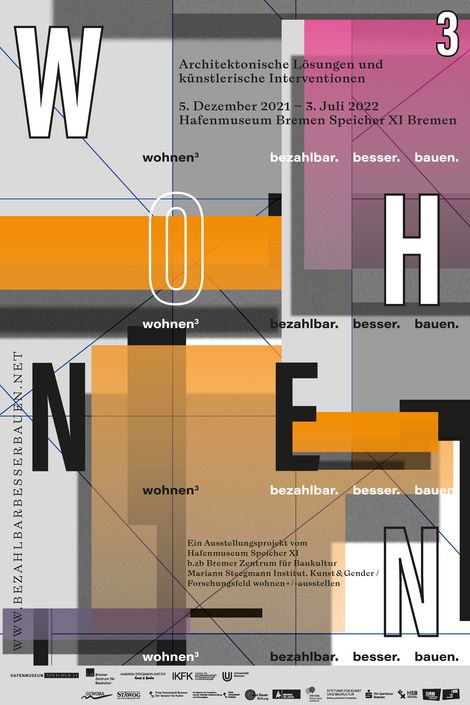
Christian Heinz -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch -

Franziska von den Driesch
-
-
2021
RENDEZ-VOUS DE CHASSE
21.2.-20.6.2021
RENDEZ-VOUS DE CHASSE
XPINKY BerlinAusstellung zum Thema Jagd & Interieur, mit Werken von bn+BRINANOVARA, Patricia Lambertus & Carolin Ott.
Kurator*innen:
Astrid Silvia Schönhagen und Isabella Sedeka im Rahmen des Forschungsprojekts c/o HABITAT TIER im Projektraum XPINKY Berlin.
Die Ausstellung war eine Kooperation des Projektraums XPINKY Berlin mit dem Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft - Kunstpädagogik und Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen
In Jagdzimmern inszeniert sich der Mensch als Bezwinger der wilden, tierlichen Natur. Ob Hirsch- und Eberjagden auf mittelalterlichen Tapisserien, gemalte Wandbespannungen mit exotischen Raubtierkämpfen oder kunstvoll arrangierte Stillleben mit erlegtem Federvieh – im Laufe der Jahrhunderte hat fast jede erdenkliche Tierart Einzug ins Interieur gehalten. Nirgends wird der Triumph über das erlegte Tier allerdings derart in Szene gesetzt wie im Trophäenzimmer. Hier wird das tote Tier Teil der wohnlichen Einrichtung der Lebenden, der präparierte Tierkörper zum Souvenir der erfolgreichen Jagd. Die ausgestopften, mit Glasaugen versehenen Trophäen künden von der Naturverbundenheit der Waidmänner und -frauen, erzeugen gleichzeitig aber ein heimelig-unheimliches Ambiente.
Die Ausstellung nimmt dieses ambivalente Verhältnis von Naturaneignung und -verbundenheit im Innenraum zum Ausgangspunkt, um die Zurichtung und Ästhetisierung von Tier und Natur in unterschiedlichen räumlichen Settings und/oder Szenografien der Jagd zu befragen. Sie reflektiert dabei auch die Bedeutung des Jagdzimmers als gesellschaftlich kodierter Repräsentations- und Illusionsraum.
Im Sinne eines in den Galerieraum verlegten „Rendez-vous de chasse“ (Jagdtreffens) laden Patricia Lambertus (1970, D), Carolin Ott (1994, D) und das Künstlerduo bn+BRINANOVARA (*1993/94, IT) dazu ein, sich diesen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzunähern.
←→ -
-
2016
À LA RECHERCHE: HERMINE DAVID
17.9.2016-22.1.2017
À LA RECHERCHE: HERMINE DAVID
Städtische Galerie DelmenhorstKuratorinnen:
Dr. Annett Reckert (Leiterin der Städtischen Galerie Delmenhorst)
Aneta Palenga (Absolventin des Masterstudiengangs Kunst- und Kulturvermittlung an der Universität Bremen)Die Ausstellung À la Recherche: Hermine David, die in der Städtischen Galerie Delmenhorst von September 2016 bis Januar 2017 gezeigt wurde, folgte mit 100 Exponaten den Spuren der 1886 geborenen französischen Künstlerin, die mit der Pariser Bohème nach 1900 in engem Kontakt stand. Die Ausstellung zeichnete die Biografie der Protagonistin nach und setzte sich kritisch mit den Rezeptionsmustern auseinander, die für die Wahrnehmung Davids und die anderer Künstlerinnen ihrer Zeit bis heute kennzeichnend geblieben sind. Anhand von Arbeiten aus den Gebieten Malerei, Aquarell, Zeichnung, Grafik und Buchillustration wurde die breitgefächerte künstlerische Produktion Davids vorgestellt. Archivmaterialien, Fotografien und einzelne publizierte Texte sowie Werke ihrer Kolleginnen (Jules Pascin, Sigrid Hjertén u.a.) ergänzten die Schau und machten die Kontexte sichtbar, die Leben und Kunst Davids beeinflussten und mitbestimmten.
In Kooperation mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender und dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an der Universität Bremen.
Die Kooperation umfasste die Durchführung des Seminars À la recherche du Hermine David. Künstlerinnen und Avantgarde um 1900, das im Sommersemester 2016 im BA Kunst–Medien–Ästhetische Bildung stattfand (Seminarleiter*innen: Dr. habil. Christiane Keim, Dr. Annett Reckert).
Des Weiteren engagierten sich die BA-Studierenden während der Ausstellung im Rahmen des Begleitprogramms, so hat z.B. eine Studentin für den Freundeskreis des Museums eine Reise nach Paris organisiert, auch wurden Konzepte für Rundgänge von Studierenden erarbeitet und mit Besucher*innen erfolgreich durchgeführt.
Der Katalog À la recherche: Hermine David, hg. von Aneta Palenga und Dr. Annett Reckert ist 2018 erschienen, u.a. mit Beiträgen von Dr. habil. Christiane Keim sowie von den Studentinnen Gesa-Marie Böhme, Insa Melzer und Victoria von Döllen, die an dem Seminar À la recherche du Hermine David. Künstlerinnen und Avantgarde um 1900 teilgenommen haben.
-
2015
DAZWISCHENTRETEN
6.6.-10.7.2015
DAZWISCHENTRETEN
Künstlerhaus BremenEin gemeinsames Ausstellungsprojekt des Künstlerhaus Bremen und des Mariann Steegmann Instituts. Kunst & Gender, Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen, Universität Bremen im Künstlerhaus Bremen
Künstler*innen: Biba Bell, Jeanne Faust, Kornelia Hoffmann, Annika Kahrs & Gerrit Frohne-Brinkmann, Franziska Keller, LIFE SPORT, Lucas Odahara, Daniela Reina Téllez, Matthias Ruthenberg, Watanee Siripattananuntakul, Mia Unverzagt, Doris Weinberger, Noriko Yamamoto
Kurator*innen:
Fanny Gonella, Künstlerische Leiterin, Künstlerhaus Bremen
Christian Heinz, Gestalter, bueroheinz
Dr. Kathrin Heinz, Leiterin Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender, Forschungsfeld
wohnen +/−ausstellen
Mona Schieren, Kunstwissenschaftlerin, Hochschule für Künste BremenDazwischentreten ist gewollt. Im Dazwischentreten, im Eintreten, Hinein- und Hinausgehen geschieht eine hauseingreifende Unterbrechung, die das Künstlerhaus Bremen als programmatischen und tradierten Schauplatz künstlerischer Produktion, eingerichtet und formiert um seine Ateliers, in den Blick nimmt. Das Thema bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung, die durch und um die Ateliers mäandert. Das Künstlerhaus operiert als Modell und Aufenthalt ästhetischer Befragungen: Vermeintlich an der Schwelle, die gewissermaßen in Bewegung gebracht werden soll und die sich zwischen Innen- und Außenräumlichkeiten, zwischen Drinnen- und Draußen-Sein permanent öffnet und schließt, will das Projekt einen Denkraum entwerfen, mit dem die Bedingungen von Kunsttun und -sehen untersucht werden. Es geht um Zeigeordnungen, Arbeitskonstellationen und Raumsituationen. Nicht nur einzelne Künstlerateliers, sondern auch Durchgangsräume, Treppenhäuser und das Gastatelier werden bespielt.
Das Gastatelier hat innerhalb des Hauses eine besondere Stellung, es ist Arbeits- und temporärer Wohnraum für Künstler*innen und steht sinnbildlich für das transitorische, auch das provisorische Bewohnen und Häuslichwerden in globaler Residenz. Beteiligt sind Künstler*innen, die im Haus arbeiten, die bereits zu Gast im Haus waren und die in anderen Städten und Ländern leben und tätig sind. Sie haben für diesen Anlass Interventionen, Performances und partizipatorische Projekte konzipiert, die die Produktionsbedingungen von Kunst reflektieren. Durch die Beteiligung des Publikums oder durch künstlerische Umarbeitungen entwickeln sich einige Werke über die Ausstellungsdauer im Prozess weiter. Das Haus wird als Versuchsanordnung begriffen: Im Erschließen und Ausschließen, im Passieren und Stillstellen von Räumlichkeiten soll ein Haus-Arbeiten an Schwellensituationen zwischen Raumverhältnissen und Raumverhalten künstlerisch erforscht und beobachtet werden, welches die Grenzen zwischen Arbeits- und Ausstellungsraum zur Diskussion stellt.
Die Ausstellung fand statt in Verbindung mit der Internationalen Tagung Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur. Für Irene Nierhaus zum 60. Geburtstag, veranstaltet vom Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen in der Kooperation des Instituts für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender an der Universität Bremen am 10./11.Juli 2015
←→ -
Das Mariann Steegmann Institut initiiert und fördert kunstwissenschaftliche Gender-Forschung in Kooperation mit dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK) der Universität Bremen.
Gemeinsam mit dem IKFK wurde und wird ein Forschungsprofil kontinuierlich entwickelt und realisiert zu Beziehungen zwischen ästhetischen, sozialen und kulturellen Prozessen und Politiken in Bildern und Räumen und den darin formulierten Subjektpositionen und ihren geschlechtlichen Ein- und Zuschreibungen. Im Zentrum steht das gemeinsame Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen.
Forschungsgruppe wohnen+/-ausstellen
Die Forschungsgruppe zum Feld wohnen+/−ausstellen arbeitet kontinuierlich seit Dezember 2009. Sie veranstaltet regelmäßig Forschungswerkstätten zu den thematischen Schwerpunkten des Forschungsfeldes.
Leitung
-

Dr. Kathrin Heinz
seit 2009 -

Prof. Dr. Elena Zanichelli
2021-2023 -

Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus
2009 - 2021
Mitglieder
-

Prof. Dr. Kerstin Brandes
-

Prof. Dr. Insa Härtel
-

Dr. Susanne Huber
-

Jorun Jensen
-

Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)
-

Mira Annelie Naß
-

Amelie Ochs
Organisatorische Betreuung -

Dr. Franziska Rauh
-

Astrid Silvia Schönhagen
-

Nadja Tamara Siemer
-

Dr. Rosanna Umbach
Organisatorische Betreuung
Ehemalige Mitglieder
Carina Bahmann (2013-2016)
Silke Bangert (2009-2016)
Dr. Angelika Bartl (2011-2015)
Dr. Katharina Eck (2010-2018)
Brigitte Härtel (2010-2015)
Johanna Hartmann (2012-2019)
Ninja Kaupa (2010-2014)
Christian Neumann † (2011-2012)
Alexia Pooth (2009-2011)
Anna-Katharina Riedel (2016-2019)
Dr. Annette Urban (2009-2010)
Leitung: Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus, Dr. Kathrin Heinz
Koordination: Amelie Ochs, Rosanna Umbach
Prof. Dr. Insa Härtel (Permanent Senior Research Fellow an der Kunstuniversität Linz und Assoziierte Wissenschaftlerin am MSI): Forschungsprojekt zu „Messie“ mit Methode: Wohnmüll im TV-Format.
Amelie Ochs (Wissenschaftliche Mitarbeiterin): Promotionsprojekt Vom Stillleben zum Display. Sachfotografien und Schaufenster im Kontext von Bildgestaltung und -konsum am Beginn des 20. Jahrhunderts [AT]
Rosanna Umbach (Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Postdoc): Promotionsprojekt Un/Gewohnte Beziehungsweisen - Visuelle Politiken des Familialen im Schöner Wohnen Magazin der 1960er und 1970er Jahre, gefördert durch das Mariann-Steegmann-Stipendium, abgeschlossen 2023
Weitere Beteiligte:
Dr. habil. Christiane Keim (Assoziierte Wissenschaftlerin am MSI)
Der Zeitschriftenbestand zu Wohnzeitschriften wird kontinuierlich erweitert. Neben der Schöner Wohnen oder IKEA-Katalogen finden sich andere internationale Zeitschriften zum Wohnen im Archiv wie die zuhause, House&Garden, La Maison de Marie-Claire, Homes and Gardens, architektur & wohnen, Casa Deco, Das Haus, Landlust, Weltkunst. Die Bestände sind im Projektraum Wohnseiten sowie in der Studienbibliothek einsehbar.
Wie werden Klassenverhältnisse in (Vor-)Bildern des Wohnens, Grundrissen und (Innen-)Architektur re/produziert und wie sind wiederum Kunst- und Architekturgeschichte, (Wohn-)Medien, Stadtplanung und Architektur daran beteiligt, klassistische Strukturen und (stereotype) Vorstellungen von Klasse(nzugehörigkeiten) zu zementieren? Das Forschungsprojekt im Forschungsfeld wohnen+/-ausstellen widmet sich den ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Wechselverhältnissen von Wohnen und Klasse. Es wird analysiert, inwiefern Klassenverhältnisse und -zugehörigkeiten über Wohn-Dinge, Geschmacksdiskurse, Ästhetikgemeinschaften und Bild-, Design- bzw. Sprachpolitiken produziert und reflektiert werden.
VERANSTALTUNGEN
Forschungswerkstatt
Classifying home – Wohn-Raum-Bilder und Klassenverhältnisse in Zeitschriften und seriellen Medien (16.–17.06.2023, Universität Bremen) des internationalen Forscher_innennetzwerks [wohn]zeitschriften, Konzept und Organisation: Amelie Ochs und Rosanna Umbach
Vorträge
Rosanna Umbach: Interieurs der Ungleichheit – Wohnungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur, Vortrag im Rahmen des Workshops Klasse anerkennen. Sozialer Status, Habitus und Klassismus in Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft (18-20.09.2025), Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln, 19.09.2025
Rosanna Umbach: Dwelling With Class – Building Structures of Classism in Architecture, Vortrag im Rahmen der Reihe Housing and… des Center for Critical Studies in Architecture, Frankfurt/Main, 06.11.2024
Amelie Ochs und Rosanna Umbach: Un/sichtbare Klassenverhältnisse in (Vor-)Bildern des Wohnens, Vortrag im Rahmen der Summer School: Kunstgeschichte x Klassismus (25.–28.9. 2023), Universität zu Köln, 26.09.2023
Amelie Ochs und Rosanna Umbach: Wohnen klassifizieren, Klasse zeigen? Eine Einführung mit Blick auf den Krisenherd Küche in Wohnzeitschriften, Vortrag auf der Forschungswerkstatt Classifying home – Wohn-Raum-Bilder und Klassenverhältnisse in Zeitschriften und seriellen Medien (16.–17.06.2023), Universität Bremen, 17.06.2023
PUBLIKATIONEN
Amelie Ochs, Rosanna Umbach (Hg.):
Wohnen mit Klasse. kritische berichte - Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Jg. 53, Nr. 2, 2025, https://doi.org/10.11588/kb.2025.2
Mit Beiträgen von Kristen Lee Bierbaum, Sophie Eisenried, Philipp Hagemann, Henrike Haug,
Gabu Heindl, Valentin J. Hemberger, Andreas Huth, Jorun Jensen, Christiane Keim, Bernadette Krejs,
Nina Manz, Friederike Nastold, Matthias Noell, Martin Papenbrock, Barbara Paul, Charlotte Püttmann,
Hannah Rhein, Alexander Wagner
AUSSTELLUNG
Im Juli 2025 findet die Ausstellung Wohnen mit Klasse in der Galerie Herold statt, die über künstlerische Perspektiven Fragen von Wohnen und Klassenverhältnissen verhandelt.
LEHRE
Amelie Ochs und Rosanna Umbach: Wohungsfrage(n) und Klassenverhältnisse in Kunst und Architektur, Vorlesung im Rahmen der Reihe DNA des Wohnens im Modul Wohnbau, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, WiSe 2023/24, WiSe 2024/25
Rosanna Umbach: Homestorys – (Wohn-)Zeitschriften als Klassendisplays, Seminar im Leuphana Semester, Modul Wissenschaft problematisiert: kritisches Denken, Leuphana Universität Lüneburg, WiSe 2023/24
Amelie Ochs und Rosanna Umbach: Wohnen mit Klasse, Projektseminar im BA Kunst – Medien – Ästhetische Bildung, Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik, Universität Bremen, WiSe 22/23 – SoSe 23, Kooperation mit dem Projekt SPRint des Instituts für Schreibwissenschaft
Das 2020 aus dem Forschungsprojekt Wohnseiten heraus gegründete internationale Forscher*innennetzwerk [wohn]zeitschriften verbindet transdisziplinäre Perspektiven aus Kunstgeschichte und -wissenschaft, Designgeschichte, Architektur(-wissenschaft), Geschichte und Historischer Bauforschung, um die medialen Vermittlung des Wohnens in Text und Bild in Zeitschriften und anderen seriellen Medien zum Wohnen zu untersuchen. Die Nachwuchswissenschaftler*innen fokussieren in verschiedenen Projekten unterschiedliche Formate und Fragestellungen: Wohnzeitschriften und ihre ästhetischen Strukturen werden beispielsweise hinsichtlich ihrer Wohndidaktiken und gesellschaftlichen An-Ordnungen analysiert, Zeige- und Konsumstrategien ins Verhältnis gesetzt mit Kanon- und Geschmacksbildung und architektonische Entwürfe und gebaute Raumstrukturen als integraler Bestandteil von Wohnkonzepten kontextualisiert.
-

Dr. des. Zofia Durda
Weltkulturerbe Rammelsberg -

Dr. Ing. Jan Engelke
TU München -

Maren-Sophie Fünderich
Stadtarchiv Dortmund -

Amelie Ochs
IKFK/MSI Universität Bremen (Koordination) -

Sonja Sikora
Marburg -

Dr. Linda Stagni
ETH Zürich -

Dr. Rosanna Umbach
IKFK/MSI Universität Bremen (Koordination) -
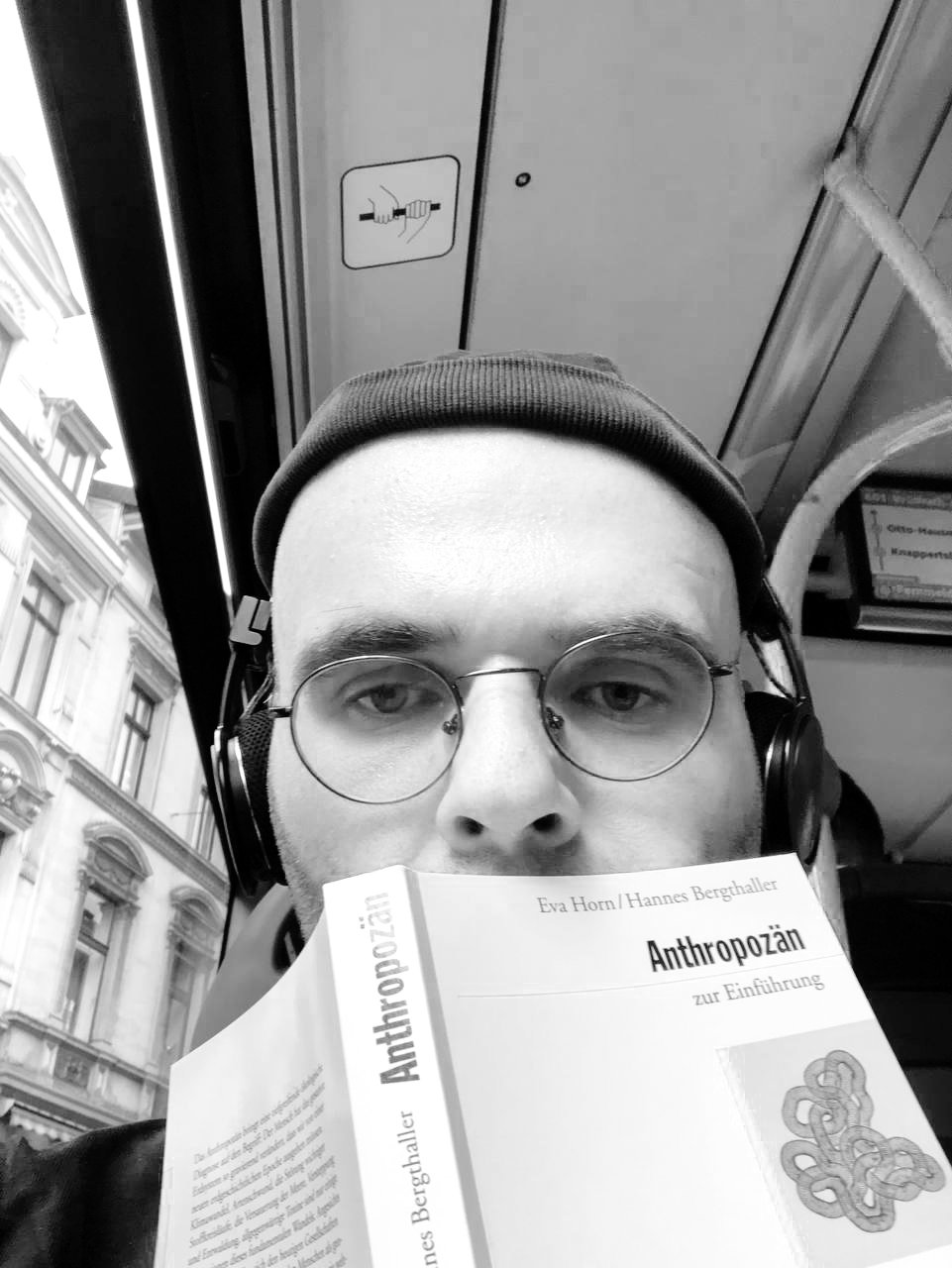
Dr. Alexander Wagner
Bergische Universität Wuppertal
-

Dr. Silke Förschler
Leitung und Konzept -

Astrid Silvia Schönhagen
Leitung und Konzept -

Dr. habil. Christiane Keim (i.R.)
Leitung und Konzept
VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungsreihe SALON TIER
SALON TIER wird seit Sommersemester 2021 von Silke Förschler, Christiane Keim und Astrid Silvia Schönhagen kuratiert.
Tagungen
Das Jagdzimmer. Wohnstile, Geschlechterkonstruktionen und die Aneignung von Natur im Zeichen des erlegten Tieres (4.–5.11.2022, Universität Bremen)
HEIM-TIER. Inszenierungspraktiken in tierlichen und menschlichen Wohnverhältnissen (10.–11.11.2016, Universität Kassel)
Ausstellung
Rendez-vous de chasse, 26.05.–20.06.2021, XPINKY BERLIN (Kuratorinnen: Astrid Silvia Schönhagen, Isabella Sedeka)
PUBLIKATIONEN
Silke Förschler, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.): Trophäen. Inszenierungen der Jagd in Wohn- und Ausstellungsräumen (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Bd. 12), in Vorbereitung.
Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen: Queering Bulldogs. Damenimitatoren und hundlich-menschliche (Selbst-)Inszenierung im Berlin der Weimarer Republik, in: Tierstudien 24/2023 (Tiere und Geschlecht), hg. von Jessica Ullrich/Mieke Roscher, S. 85–97.
Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.): Heim/Tier. Tier-Mensch-Beziehungen im Wohnen, Bielefeld: transcript 2019 (Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen, Band 6).
Silke Förschler: Was macht das Tier im Interieur? Gemälde exotischer Tiere als naturhistorische Objekte und als Mittel der Distinktion am Hof von Schwerin, in: Katharina Eck, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.): Interieur und Bildtapete: Narrative des Wohnens um 1800, Bielefeld: transcript 2014 (Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen, Band 2), S. 165–184.
Die Schriftenreihe wohnen+/–ausstellen erscheint seit 2014 im transcript Verlag. Herausgeberinnen der Reihe sind Irene Nierhaus und Kathrin Heinz. Die bislang erschienenen Bände sind:
-
Band 1 Wohnen Zeigen
Irene Nierhaus, Andreas Nierhaus (Hg.)
Wohnen Zeigen
Modelle und Akteure des Wohnens in Architektur und visueller KulturBielefeld: transcript 2014
Mit der Moderne ist Wohnen zu einem umkämpften Schauplatz gesellschaftlichen Handelns geworden, in dessen Mitte die Verhandlung des Subjekts und seiner sozialen Beziehungen steht. In unterschiedlichen Medien wie Architektur, Ausstellung, bildender Kunst, Zeitschrift, Film oder Literatur werden Modelle und Vorbilder produziert. In diesem Zeigen des Wohnens sind explizit und implizit Bewertungen und Erzählungen von einem ‚richtigen‘ oder ‚schlechten‘ Wohnen enthalten. Damit wird ein Wohnwissen realisiert, das an der Organisation der Wohnbauten und Wohnräume ebenso teilhat wie an den Bildwelten des Wohnens und an Vorstellungen von und über Bewohner_innen. Die Beiträge des Bandes loten Wohnen als Verfahrensspielraum zwischen Anweisung und Handlungspotenzial aus.
Autor*innen: Angelika Bartl, Greg Castillo, Bernadette Fülscher, Cathleen M. Giustino, Johanna Hartmann, Christiane Keim, David Kuchenbuch, Andreas Nierhaus, Irene Nierhaus, Eva-Maria Orosz, Manfredo di Robilant, Drehli Robnik, Theres Sophie Rohde, Christina Threuter, Andreas K. Vetter, Michael Zinganel
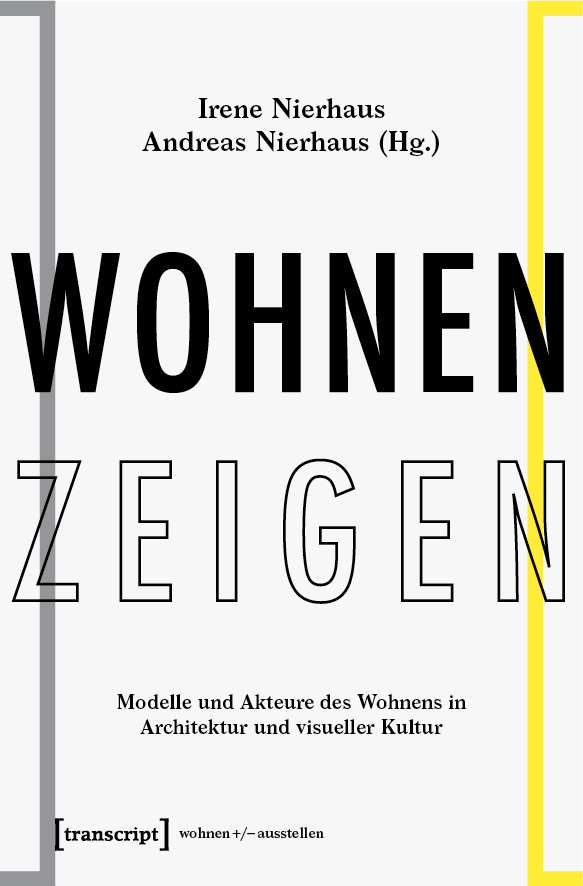
-
Band 2 Interieur und Bildtapete
Katharina Eck, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.)
Interieur und Bildtapete
Narrative des Wohnens um 1800Bielefeld: transcript 2014
Bildtapeten im Interieur um 1800 sind an der Herausbildung und Formung einer spezifischen, an bürgerlichen Werten orientierten Wohnkultur maßgeblich beteiligt. Sie entfalten Erzählungen im bewohnten und bewohnbaren Raum, in dem sich Diskurse über ‚geschmackvolles‘ Einrichten mit ästhetischen und moralischen Wertvorstellungen der Epoche verschränken. Zugleich sind die tapezierten Interieurs Aushandlungsorte von Erzählungen der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer vielfältigen Praktiken im Alltag, die mit zeitgenössischen Idealen von Körper, Geschlecht, Ethnizität und Nation verknüpft sind. Solchen Narrativen und Beziehungsgeflechten spüren die Beiträge dieses Bandes nach, der aus interdisziplinärer Perspektive die mannigfaltigen Verschränkungen von Inneneinrichtung, Raumanordnungen und Subjektkonstitution in Wohndiskursen zu Beginn der Moderne offenlegt und einer kulturhistorischen Neubewertung unterzieht.
Autor*innen: Astrid Arnold, Betje Black Klier, Angela Borchert, Katharina Eck, Silke Förschler, Kathrin Heinz, Cornelia Klinger, Irene Nierhaus, Tobias Pfeifer-Helke, Astrid Silvia Schönhagen, Claudia Sedlarz, Friederike Wappenschmidt,
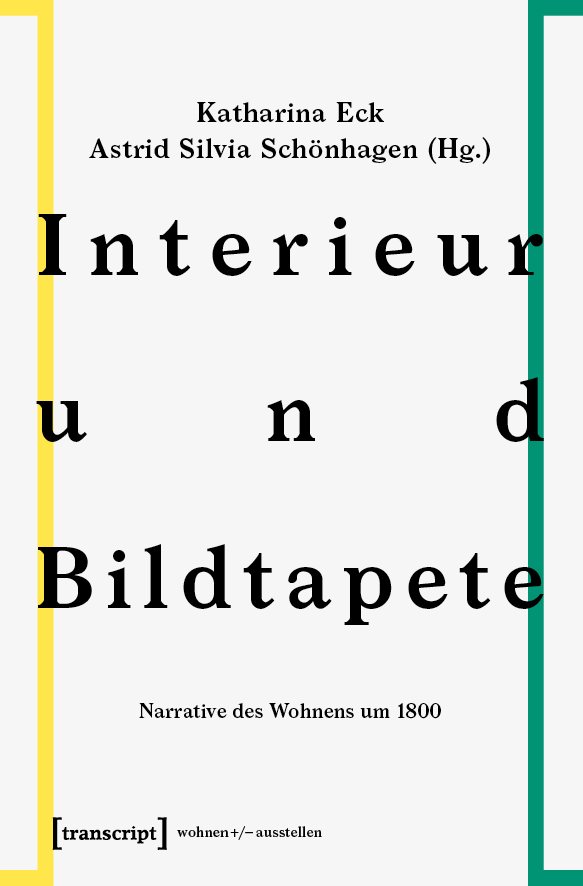
-
Band 3 Matratze/Matrize
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.)
Matratze/Matrize
Möblierung von Subjekt und Gesellschaft. Konzepte in Kunst und ArchitekturBielefeld: transcript 2016
Die Matratze ist Grundelement des Wohnens, jenes Ding unseres Alltags, auf dem wir schlafen, lieben, faulenzen, träumen, gesunden und sterben. Sie ist Inbegriff von Intimität und Körperlichkeit und zugleich Agentin von Normierungen in Subjektivierungsprozessen und sozialen Beziehungen. Die Matrize dient in diesem Band als Theoriefigur, um die Matratze und die mit ihr verbundenen Prägevorgänge und Wissenskomplexe am vermeintlich privatesten Ort zu betrachten.
Autor*innen: Marie-Luise Angerer, Angelika Bartl, Franziska von den Driesch, Katharina Eck, Insa Härtel, Johanna Hartmann, Gabu Heindl, Kathrin Heinz, Heidi Helmhold, Ilaria Hoppe, Christiane Keim, Sonja Kinzler, Elke Krasny, Tobias Lander, Angelika Linke, Tom Lutz, Irene Nierhaus, Alice Pechriggl, Anna-Katharina Riedel, Drehli Robnik, Andreas Rumpfhuber, Georges Teyssot, Sibylle Trawöger, Elena Zanichelli
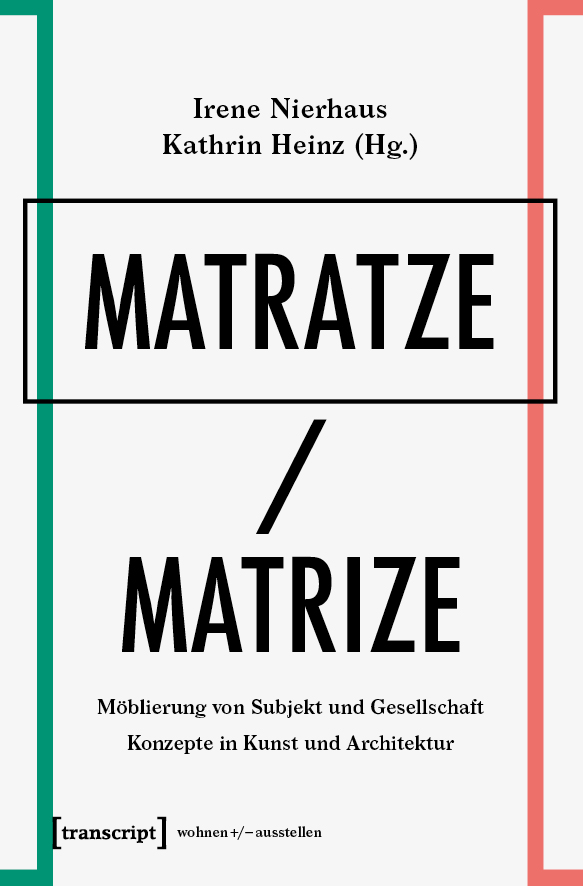
-
Band 4 Tapezierte Liebes-Reisen
Katharina Eck
Tapezierte Liebes-Reisen
Subjekt, Gender und Familie in Beziehungsräumen des frühindustriell-bürgerlichen WohnensBielefeld: transcript 2018
Französische Bildtapeten aus der Manufaktur von Joseph Dufour fanden seit dem frühen 19. Jahrhundert in Interieurs in ganz Europa als begehrtes Ausstattungsobjekt Verwendung – vor allem in bildungsbürgerlichen Haushalten. Katharina Eck stellt die drei großformatigen Tapeten zu „Amor und Psyche“, „Telemach auf der Insel der Calypso“ und „Paul und Virginie“ in den Fokus ihrer Analysen. In einer transdisziplinären Studie (Literatur- und Kunstwissenschaft) untersucht sie die Geschlechter- und Paarbildungsdidaktiken in den Tapetenszenen – wie auch das „in richtigen Bahnen verlaufende“ Sexualitätsdispositiv – zusammen mit den Praktiken des Wohnens und der Geselligkeit um 1800. Sie entwickelt Analyseachsen, die das „In-Beziehung-Setzen“ mit den tapezierten Räumen und deren performatives Potenzial erstmalig in dieser anschaulichen Form ausloten.
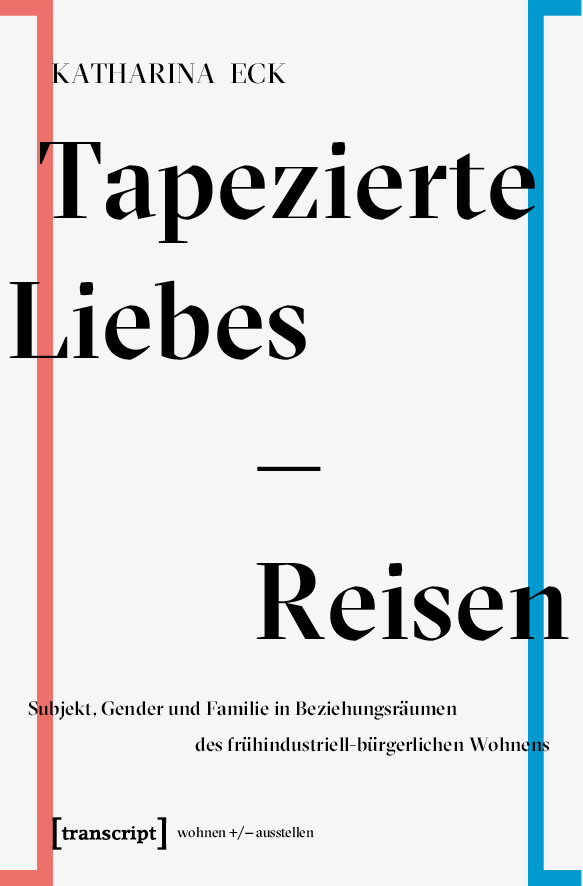
-
Band 5 Wohn/Raum/Denken
Katharina Eck, Johanna Hartmann, Kathrin Heinz, Christiane Keim (Hg.)
Wohn/Raum/Denken. Politiken des Häuslichen in Kunst, Architektur und visueller Kultur
Bielefeld: transcript 2021
Häuslichkeit, Haus, Wohnen – diese Begriffe artikulieren das so genannte ,Private‘, seinen privilegierten Ort, seine Atmosphären und Befindlichkeiten. Das Häusliche wird auch als Sphäre des vermeintlich unpolitisch Eigenen und Individuellen bezeichnet. Tatsächlich ist es jedoch seit jeher Territorium von Regulierungstechniken, Erziehungsstrategien, emotionalen Bindungen und Arbeitsbeziehungen. Die Beiträge dieses Irene Nierhaus gewidmeten Bandes beziehen sich auf ein Denken des ,Wohn/Raums‘ als in diesem Sinne komplexe und flexible Struktur, in der sich Subjektivität, Geschlecht, Nation und Gemeinschaft konstituieren.
Autor*innen: Katharina Eck, Susanne von Falkenhausen, Daniela Hammer-Tugendhat, Insa Härtel, Johanna Hartmann, Gabu Heindl, Kathrin Heinz, Heidi Helmhold, Christiane Keim, Elke Krasny, Barbara Paul, Kathrin Peters, Alexia Pooth, Drehli Robnik, Mona Schieren, Astrid Silvia Schönhagen, Matt Smith, Silke Wenk, Elena Zanichelli
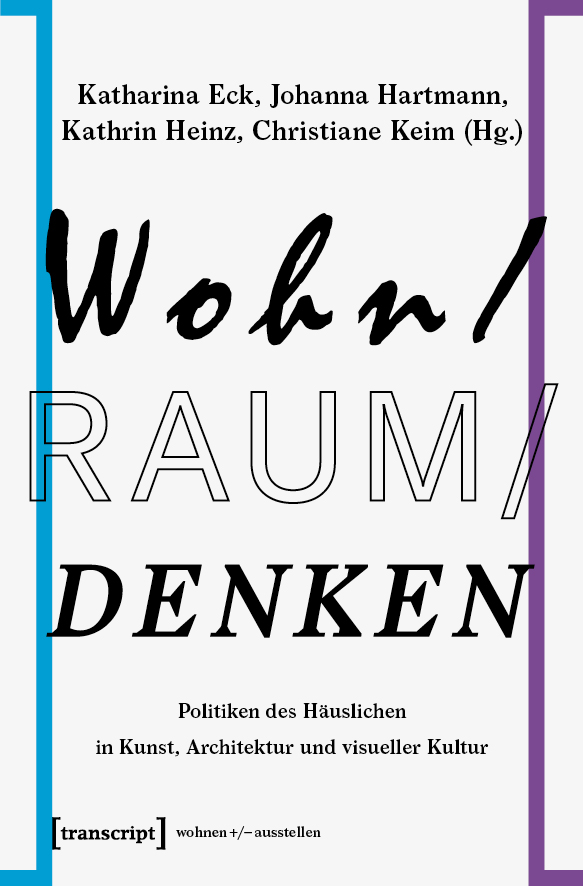
-
Band 6 Heim/Tier
Silke Förschler, Christiane Keim, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.)
Heim/Tier.
Tier – Mensch – Beziehungen im WohnenBielefeld: transcript 2019
Tiere und Menschen teilen sich seit jeher ihre Lebensräume. Deutlich zeigt sich dies im Wohnen, wo Tier-Mensch-Beziehungen nicht nur die Gestaltung der Räume, sondern auch die Wohnpraxis wesentlich mitbestimmen. So können Menschen dem lebenden Tier ein Heim geben, umgekehrt kann aber auch das tote Tier als präparierter Tierkörper oder als textile Wohn- und Oberflächengestaltung Teil des Interieurs werden. Die Beiträge des Bandes untersuchen mögliche Arten der Einbindung des Tierlichen in Haus und Wohnung und verknüpfen hierzu Ansätze aus dem Bereich der kunst- und kulturgeschichtlichen Wohnforschung mit zentralen Positionen der Human-Animal Studies. Im Fokus stehen unterschiedliche Medialisierungen der Verhäuslichung tierlichen Verhaltens sowie deren Bedeutung für das Zusammenleben von Tier und Mensch. Auf diese Weise wird das behauste Wohnen als vermeintlich genuin menschliche Kulturpraxis hinterfragt und neu perspektiviert.
Autor*innen: Silke Förschler, Anne Hölck, Hörner/Antlfinger, Christiane Keim, Katja Kynast, Astrid Silvia Schönhagen, Barbara Schrödl, Ellen Spickernagel, Aline Steinbrecher, Mariel Jana Supka, Christina Threuter, Jessica Ullrich, Mareike Vennen, Friederike Wappenschmidt
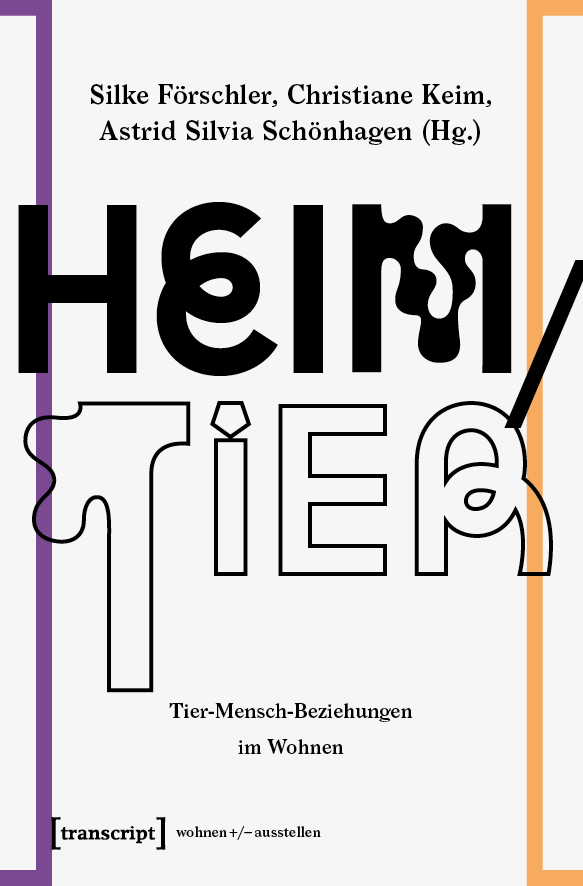
-
Band 7 Unbehaust Wohnen
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.)
Unbehaust Wohnen
Konflikthafte Räume in Kunst – Architektur – Visueller KulturBielefeld: transcript 2020
Unbehaust Wohnen ist ein zentraler Teil der Geschichte und Theorie des Wohnens und wird dennoch häufig vergessen, verborgen, zum Diskurs allein von Spezialist_innen gemacht oder als ein ,Anderes‘ zu einem sichernden und ,eigentlichen‘ Wohnen verhandelt. Dem positiv gedachten Wohnen als Existenz und Heim/at steht also immer auch ein unbehaustes Wohnen zur Seite: Zerstörtes Wohnen in kriegerischen Konflikten, verlorenes Wohnen in Migrationen, temporäres Wohnen in Obdach- und Wohnungslosigkeit, prekäres Wohnen in ökonomischer, emotionaler und körperlicher Unversorgtheit, beängstigendes Wohnen in Subjektkrisen. Der Band nähert sich verschiedenen Zugängen und Ebenen eines Unbehausten aus kunst- und kulturwissenschaftlicher, philosophischer, historischer, ethnografischer, architekturtheoretischer, psychiatrischer sowie künstlerischer Perspektive.
Autor*innen: Monika Ankele, Christian Berkes, Henning Bleyl, Amer Darweesh, Klaas Dierks, Burcu Dogramaci, Mehmet Emir, Johanna Hartmann, Gabu Heindl, Kathrin Heinz, Birgit Johler, Elke Krasny, Irene Nierhaus, Salvatore Pisani, Franziska Rauh, Drehli Robnik, Michaela Schäuble, Michael Schödlbauer, Astrid Silvia Schönhagen, Anna Steigemann, Annette Tietenberg, Michalis Valaouris, Ann Varle
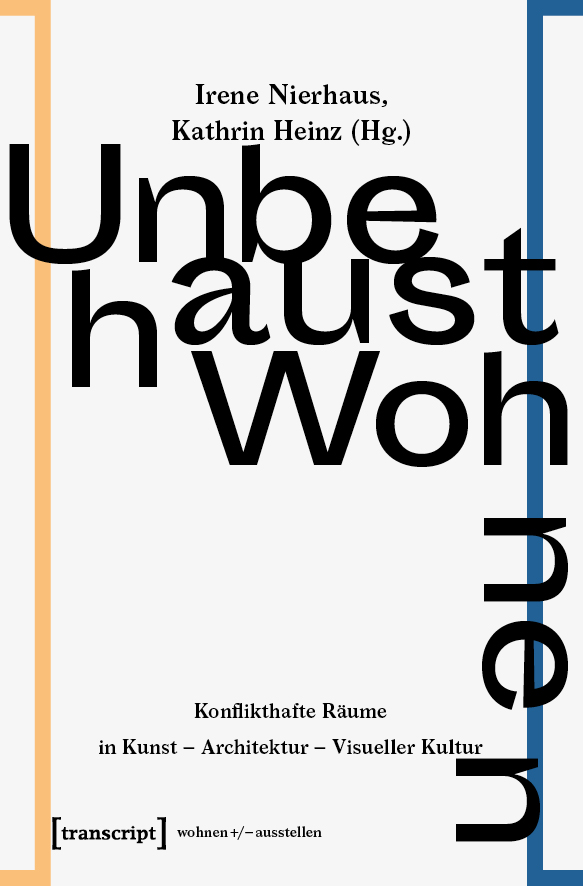
-
Band 8 WohnSeiten
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz, Rosanna Umbach (Hg.)
WohnSeiten. Visuelle Anordnungen des Wohnens in Zeitschriften
Bielefeld: transcript 2021Wohnzeitschriften zeigen Seite für Seite ideale Wohnräume, Möbel und Dinge und vermitteln Einrichtungstipps und Anleitungen zum ‚richtigen‘ Wohnen. Wohnen wird als erlernbar und immer optimierbar vorgeführt. Dieses Wohnhandeln ist Teil gesellschaftlicher und politischer Prozesse und Zuschreibungen, das im Display der ‚WohnSeiten‘ verhandelt, um- oder festgeschrieben wird. Historische und zeitgenössische Zeitschriften, Magazinen, Journale und mediale Verbünde mit einem Fokus auf Wohnpraktiken stehen mit ihrer seriellen, auf ein didaktisches Programm ausgerichteten Ästhetik im Fokus. Durch spezifische Zeigestrategien werden Bewohner*innen und Leser*innen als sozial und politisch Agierende, vergeschlechtlichte und konsumierende Subjekte in ihren Wohnweisen adressiert und zum Tätigwerden aufgefordert. Der Band zeigt die grundlegende Bedeutung von Zeitschriften als Diskursformation für die Wohnforschung.
Autor*innen: Jeremy Aynsley, Donatella Cacciola, Jan Engelke, Rudolf Fischer, Insa Härtel, Lea Horvat, Monique Miggelbrink, Kathrin Heinz, Stefan Muthesius, Irene Nierhaus, Amelie Ochs, Anna Riedel, Mona Schieren, Änne Söll, Annette Tietenberg, Rosanna Umbach, Dagmar Venohr, Alexander Wagner, Monika Wucher
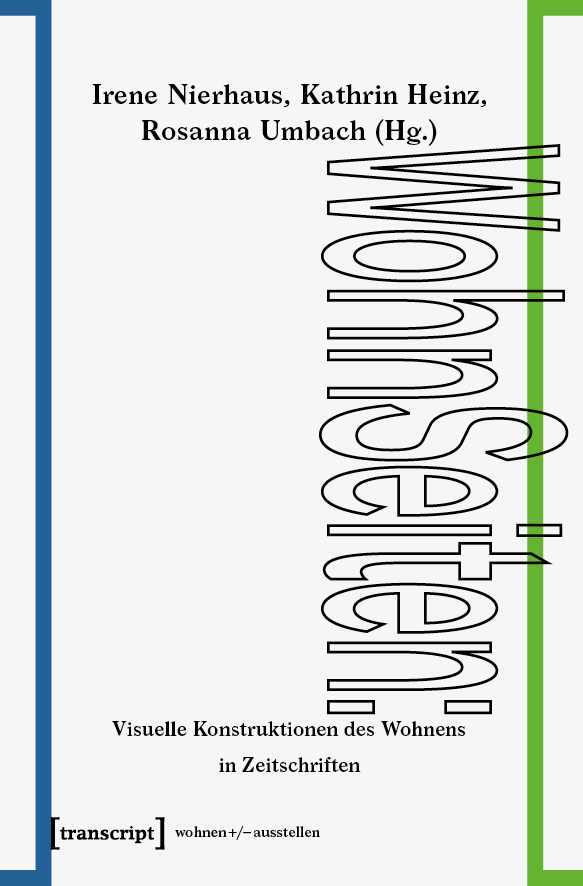
-
Band 9 Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens
Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.)
Ästhetische Ordnungen und Politiken des Wohnens
Häuslichen und Domestischen in der visuellen ModerneBielefeld: transcript 2023
Wohnen ist geprägt von Vorstellungswelten, die in bildlichen und räumlichen Medien produziert werden. Seit 1800 werden Beziehungen zwischen Bewohner*innenschaft, Räumlichkeit und Dingen als identitätsproduzierende Verhältnisse und gemeinschaftsbildende Prozesse formiert, ästhetisch entworfen und in verschiedenen Bildsorten, Genres, Bildstrategien und visuellen Verfahren abgebildet. Die Beiträger*innen des Bandes Fragen nach den Bedeutungsproduktionen und -verschiebungen im Domestischen, die ihrerseits Bildprozesse hervorbringen. Sie diskutieren das Mannigfaltige wie das Reproduktive, das Innovative wie das Affirmative des Ästhetischen – und damit die Potenzialität des Bildlichen im Wohnen.
Autor*innen: Temma S. Balducci, Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie, Nanne Buurmann, Burcu Dogramaci, Jan Engelke, Kathrin Heinz, Christiane Keim, Piotr Korduba, Bernadette Krejs, Burkhard Meltzer, Mira Anneli Naß, Irene Nierhaus, Amelie Ochs, Philipp Oswalt, Eliana Perotti, Alexia Pooth, Mona Schieren, Astrid Silvia Schönhagen, Susan Sidlauskas, Annette Tietenberg, Rosanna Umbach, Elena Zanichelli, Philipp Zitzlsperger
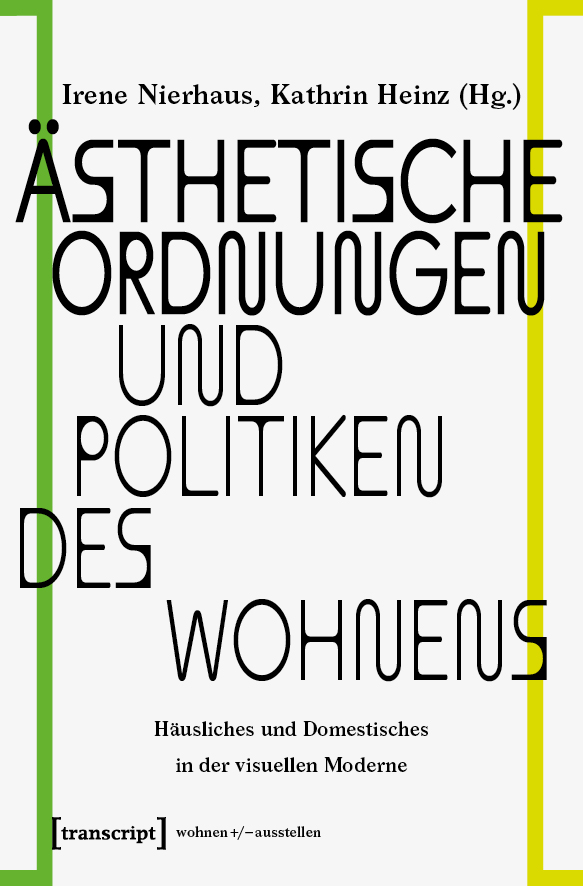
-
Band 10 Instagram-Wohnen
Bernadette Krejs
Instagram-Wohnen
Architektur als Bild und die Suche nach gegenhegemonialen WohnbildweltenBielefeld: transcript 2023
Welche Auswirkungen hat die mediale Repräsentation ästhetisierter Wohnbildwelten auf Plattformen wie Instagram auf das Verständnis von Architektur, Raum und Wohnen? Der Komplexität des Wohnens werden die dominanten Bildnarrative auf Instagram nicht gerecht, trotzdem finden die visuellen Wohnideale auch gebaute Übersetzungen und Anschlussstellen. Bernadette Krejs analysiert, was gegenhegemoniale Wohnbilder als politisch aktivistische Bilder für das Wohnen leisten können. Im Spannungsverhältnis von Bild und Architektur stellt sie alternative (Bild-)Möglichkeiten für mehr Diversität, Widerstand und Gemeinschaft in den Fokus – und bietet Impulse im Umgang mit digitalen und medial vermittelten Bildern.
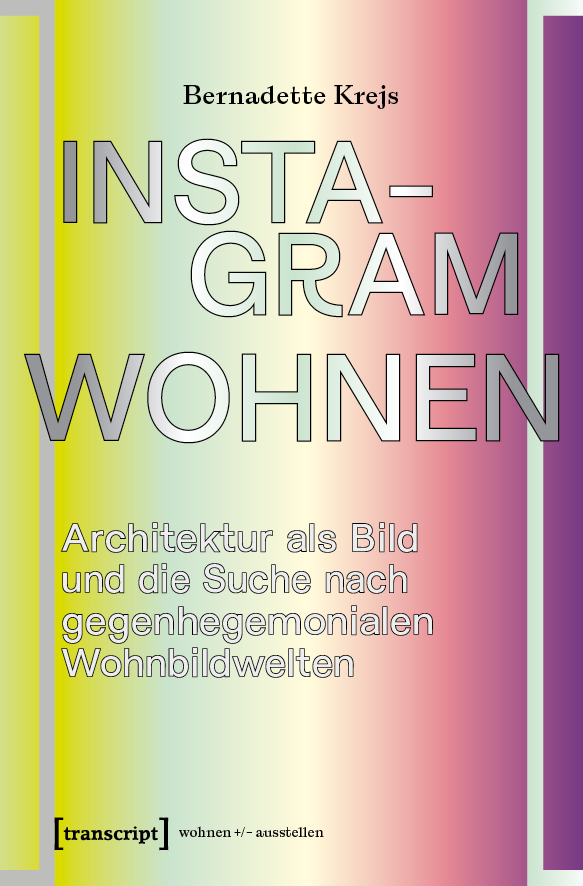
-
Band 11 Un/Gewohnte Beziehungsweisen
Rosanna Umbach
Un/Gewohnte Beziehungsweisen
Visuelle Politiken des Familialen in der Zeitschrift »Schöner Wohnen«, 1960-1979Bielefeld: transcript 2025
Welche visuellen Politiken des Familialen bestimmen das Bildprogramm der Zeitschrift »Schöner Wohnen«? Zwischen Bild und Text verstetigt sich das Ideal der heteronormativen Kleinfamilie. Zugleich avanciert die Familie seit den 1960ern zum Schauplatz gesellschaftspolitischer Umordnungsprozesse, die ausgehend von feministischen Interventionen ins »Private« das Gewohnte in Frage stellen und sich im Display der Zeitschrift niederschlagen. Rosanna Umbach perspektiviert die ambivalenten Gleichzeitigkeiten der (Bild-)Diskurse von Wohnen, Gender und Familie kritisch und zeigt, wie sie zwischen Emanzipation und Einfamilienhaus, Weltraumküchen und demokratischem Wohnzimmer, Rationalisierung und »sexueller Revolution« oszillieren.
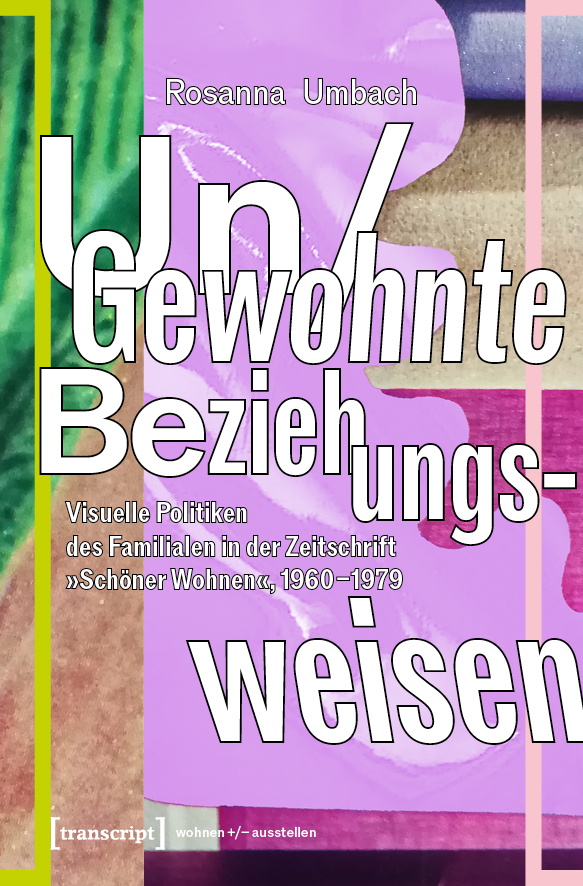
-
Band 12 Trophäen
Silke Förschler, Astrid Silvia Schönhagen (Hg.)
Trophäen
Inszenierungen der Jagd in Wohn- und AusstellungsräumenBielefeld: transcript 2025
Trophäen gelten als Zeugnisse einer erfolgreichen Jagd und werden in unterschiedlichen Kontexten präsentiert: Sie finden Eingang in den privaten Wohnraum, aber auch in die (populäre) Ausstellungskultur. Die Beiträger*innen des Bands beleuchten diese kulturellen Einhegungen des Jagdlichen und historisieren Dekorationen und Ausstellungsdisplays. Dabei analysieren sie die Unterschiede zwischen tierlichen und jagdlichen Objekten, arbeiten deren geschlechtliche, koloniale und ökologische Konnotationen heraus und hinterfragen die räumliche Inszenierung der Jagd als jahrhundertealte Praktik der Aneignung von Tier und Natur.
Autor*innen: Raphael Beuing, Kerstin Brandes, Catherine Girard, Sebastian Hackenschmidt, Heiko Laß, Petra Lange-Berndt , Maximilian Preuss, Mieke Roscher, Barbara Schrödl, Fanny Stoye, Léonie Süess, Christina Threuter, Rosanna Umbach, Sarah Wade, Kea Wienand
PUBLIKATIONEN IM FORSCHUNGSFELD WOHNEN+/-AUSSTELLEN
(Auswahl)
Schriftenreihe wohnen+/-ausstellen
Amelie Ochs, Rosanna Umbach (Hg.):
Wohnen mit Klasse. kritische berichte - Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Jg. 53, Nr. 2, 2025, https://doi.org/10.11588/kb.2025.2
Amelie Ochs, Rosanna Umbach: Wohnseiten. The interior(s) of home journals, in: Sequitur, Issue 7.1 Interiors, 01/2021.
Seitenweise Wohnen: Mediale Einschreibungen, hg. von Katharina Eck, Kathrin Heinz, Irene Nierhaus, FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und Visuelle Kultur, H. 64, 2018.
PRESSE
Das Mariann Steegmann Institut in der taz am 02.01.2023 in orte des wissens.
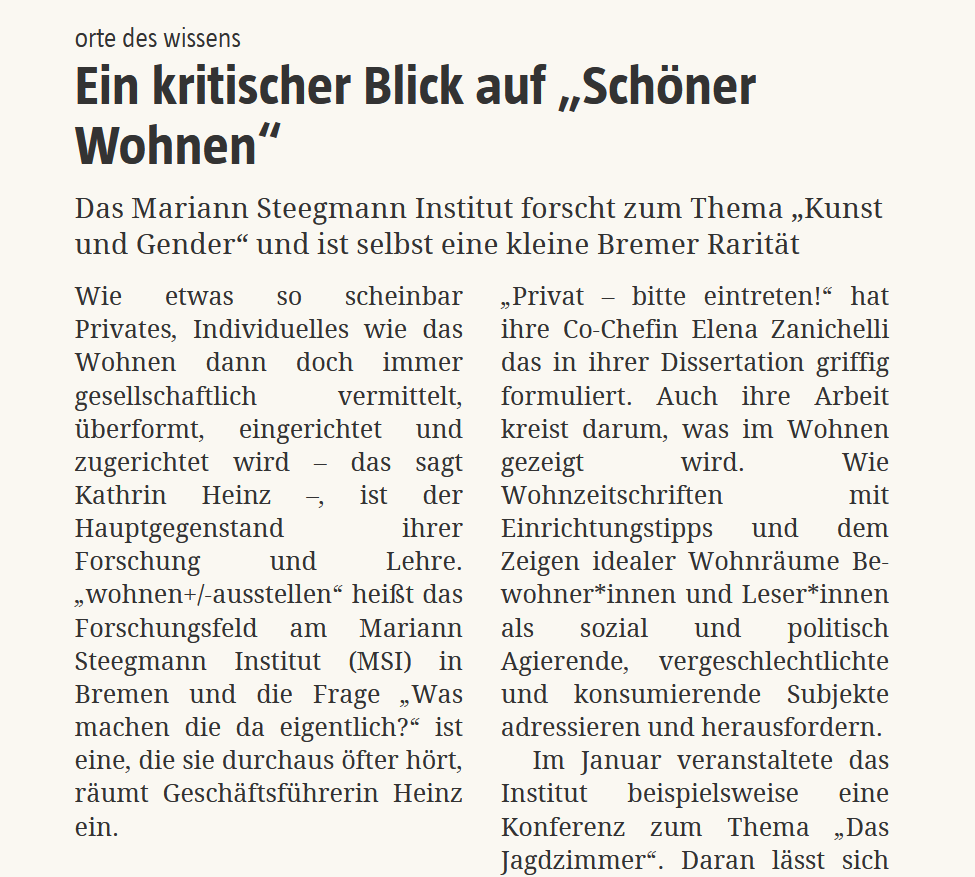
TV

https://vimeo.com/730905515/2d3d91d601

https://www.butenunbinnen.de/videos/talk-mariann-steegmann-institut-kathrin-heinz-100.html
Alle Ausgaben finden sich online einsehbar unter: www.fkw-journal.de
Die Zeitschrift FKW ist das einzige Publikationsorgan für Geschlechterforschung und visuelle Kultur im deutschsprachigen Raum. FKW analysiert visuelle Repräsentationen und Diskurse in ihrer gesellschaftlichen und geschlechterpolitischen Bedeutung. So verbindet FKW kunst- und kulturtheoretische, bild- und medienwissenschaftliche, genderspezifische, politische und methodische Fragestellungen zu einer kritischen Kulturgeschichte des Visuellen.
Die Mariann Steegmann Stiftung und weiterführend das MSI fördern seit 2005 die Zeitschrift, um die seit drei Jahrzehnten in FKW stattfindenden theoretischen und methodischen Auseinandersetzungen im Feld der feministischen Kunst- und Kulturwissenschaften zu unterstützen. FKW erscheint seit 2013 als peer reviewed journal im Open Access-Format.
Dr. Kathrin Heinz ist seit 2005 Redaktionsmitglied und Mitherausgeberin einzelner Hefte. Seit 2022 ist Rosanna Umbach Redaktionsmitglied. Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus ist seit 2012 im Wissenschaftlichen Beirat.
Master – Studienprofil Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft
Lernort: MSI / Forschungsfeld wohnen+/–ausstellen
Die Studienbibliothek des Mariann Steegmann Instituts ist ab 14. Oktober 2025, wieder wöchentlich am Dienstag von 11.00 bis 13.00 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.
Terminvergabe per Mail unter: msi-bibliothek@msi.uni-bremen.de
Tel. +49 421 218 697 12
msi-bibliothek@msi.uni-bremen.de
MSI
-
1112156c-9329-4f48-be5b-d1433e84fc6a
-
de50cade-b623-4eb2-b920-040a22a4505b
-
c1ef2483-5e6e-4ec9-81b6-d26b0c84a69a
-
a31d55a7-8b39-47a8-96a8-4ae4a364ee00
-
aae62471-8e10-44b1-b9e6-6f1f8eb9bfaa
-
ed1e9e63-199f-4e3d-9362-b3f21f18ab3d
-
8f733999-1274-4816-baee-5ee711d117da
-
d62521d0-bc31-4e9f-8dc7-d7a7244c35a2
-
f1835896-152a-4fa3-8010-b25db8be175f
-
5daf6995-b881-4f69-af6a-a9c6716f88ab
-
e56a45d2-0cf5-4811-83b8-800fa41c9626
-
d969dee7-620d-4d09-9d86-7af5298b413a
-
fbd7006f-dae9-4463-9eac-b0f2d6ea5e8f
-
60460a5a-41e7-48e0-82c8-0bc0342f50b5
-
4a679fda-d3f1-41a5-985d-48efffd571e0
-
fdb174ec-2307-46f1-9e95-db258e4aecda
-
14a84e6d-0e11-46c0-8005-783d69e04826
-
ff259a2e-c4a7-465c-ae84-cedc26ecf54f
-
bbab8385-537b-4882-8a3e-8b69b02e9881
Die Seite konnte nicht gefunden werden.
Mariann Steegmann Institut
Kunst & Gender
c/o Universität Bremen
FVG M1060/1061
Celsiusstr. 2
28359 Bremen
Tel +49 421 218 697 11
Tel +49 421 218 697 12
info@msi.uni-bremen.de
www.mariann-steegmann-institut.de
Herausgeberin
Mariann Steegmann Institut
Kunst & Gender
c/o Universität Bremen
Celsiusstr. 2
28359 Bremen
Tel +49 (0)421 218 697 11
Tel +49 (0)421 218 697 12
info@msi.uni-bremen.de
www.mariann-steegmann-institut.de
Vertretung durch den Vorstand des
Mariann Steegmann Instituts:
Dr. Kathrin Heinz
Dr. Urs Brunner
Prof. i.R. Dr. Irene Nierhaus (beratend)
Inhaltliche Konzeption und Redaktion
Mariann Steegmann Institut
Kunst & Gender
c/o Universität Bremen
Celsiusstr. 2
28359 Bremen
Konzeption, Gestaltung und Webdesign
Christian Heinz
Webprogrammierung
Haftungsauschluss
Haftung der Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.
Datenerfassung auf dieser Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. Sofern über die Website Verträge geschlossen oder angebahnt werden können, werden die übermittelten Daten auch für Vertragsangebote, Bestellungen oder sonstige Auftragsanfragen verarbeitet.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.
2. Hosting
Wir hosten die Inhalte unserer Website bei folgendem Anbieter:
Externes Hosting
Diese Website wird extern gehostet. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters / der Hoster gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.
Das externe Hosting erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen. Wir setzen folgende(n) Hoster ein: Universität Bremen
3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Mariann Steegmann Institut Kunst & Gender c/o Universität Bremen Celsiusstr. 2 28359 Bremen
Telefon: Tel +49 (0)421 218 697 11, Tel +49 (0)421 218 697 12
E-Mail: info@msi.uni-bremen.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Speicherdauer
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.
Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website
Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.
Empfänger von personenbezogenen Daten
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit verschiedenen externen Stellen zusammen. Dabei ist teilweise auch eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an diese externen Stellen erforderlich. Wir geben personenbezogene Daten nur dann an externe Stellen weiter, wenn dies im Rahmen einer Vertragserfüllung erforderlich ist, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind (z. B. Weitergabe von Daten an Steuerbehörden), wenn wir ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Weitergabe haben oder wenn eine sonstige Rechtsgrundlage die Datenweitergabe erlaubt. Beim Einsatz von Auftragsverarbeitern geben wir personenbezogene Daten unserer Kunden nur auf Grundlage eines gültigen Vertrags über Auftragsverarbeitung weiter. Im Falle einer gemeinsamen Verarbeitung wird ein Vertrag über gemeinsame Verarbeitung geschlossen.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO). WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen: Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.